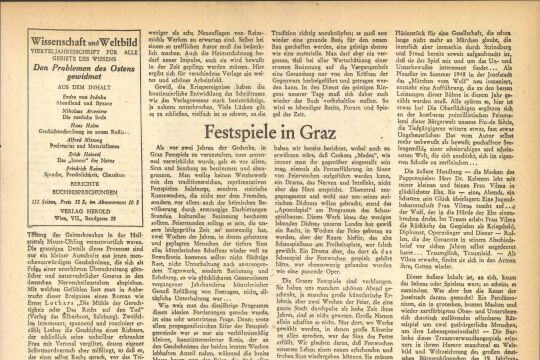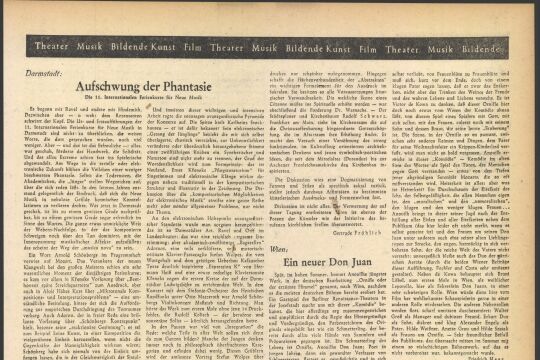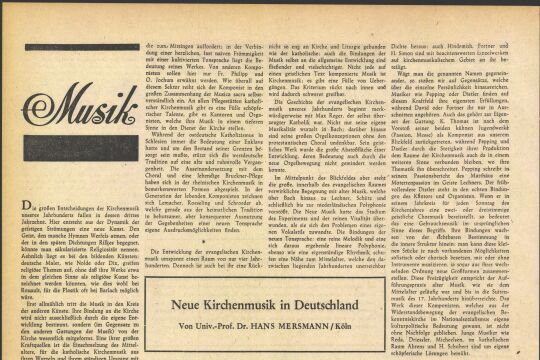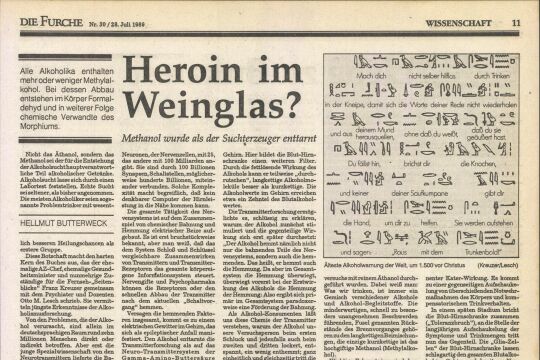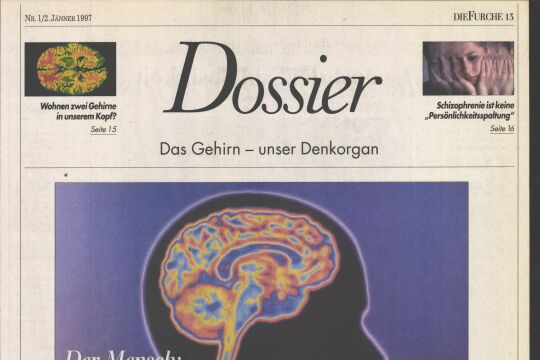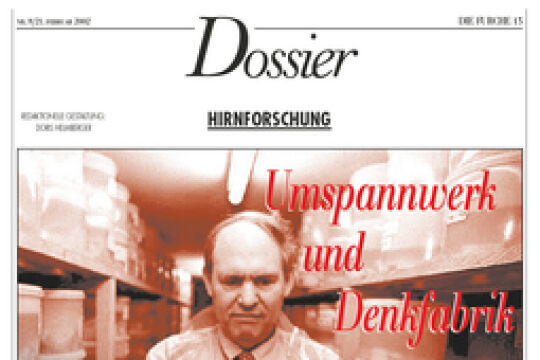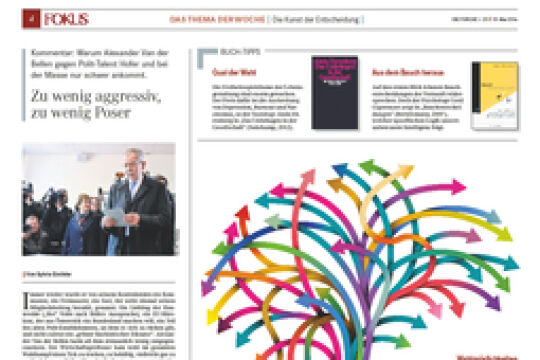Sinnlich swingende Synapsen
„Musik und Gehirn“ hieß ein mehrteiliger Schwerpunkt im Rahmen des diesjährigen Musikfestivals Wien Modern. DIE FURCHE lauschte und staunte, was die geladenen Top-Wissenschafter so alles zu berichten wussten.
„Musik und Gehirn“ hieß ein mehrteiliger Schwerpunkt im Rahmen des diesjährigen Musikfestivals Wien Modern. DIE FURCHE lauschte und staunte, was die geladenen Top-Wissenschafter so alles zu berichten wussten.
Wenn Affen zwischen Musik und Stille wählen können, so entscheiden sie sich stets für die Ruhe. Anders der Mensch, wie wissenschaftliche Experimente zeigen: Er fühlt sich grundsätzlich wohler, wenn ihn musikalische Klänge umgeben und nicht Lautlosigkeit. „Ein ausgeprägtes Interesse an Musik scheint eine grundlegende Eigenschaft des menschlichen Gehirns zu sein“, zeigt sich der Hirnforscher Stefan Koelsch überzeugt. Dennoch sei die Musik von den Kognitions- und Neurowissenschaften lange Zeit sträflich vernachlässigt worden, kritisiert der an der Universität von Sussex (England) lehrende Psychologe und Musikwissenschafter.
Diese Zeiten sind vorbei. Mit allen möglichen modernen Messmethoden wie Magnetresonanztomographie, Positronenemissionstomographie, Elektroenzephalographie oder Magnetenzephalographie untersuchen Wissenschafter, was in unserem Gehirn vor sich geht, wenn wir Musik hören oder Musik machen. So hat sich zum Beispiel gezeigt, dass das menschliche Gehirn keinen wesentlichen Unterschied zwischen Musik und Sprache macht. „In unseren Sätzen stecken Takt, Rhythmus und Melodie“, erklärt Koelsch. Musik wird zu einem großen Teil mit denselben kognitiven Prozessen und mit denselben zerebralen Strukturen verarbeitet wie Sprache. Das sogenannte Broca-Areal, eines der wichtigsten Sprachzentren des Gehirns, ist gleichermaßen für die Verarbeitung von Sprache wie von Musik verantwortlich.
Doch kein Mozart-Effekt
Als Irrtum entlarvt hingegen ist seit Kurzem der sogenannte Mozart-Effekt. Gemeint ist der 1993 durch eine Aufsehen erregende Studie untermauerte Mythos, dass sich die intellektuellen Leistungen verbessern, wenn man klassische Musik – speziell eine bestimmte Klaviersonate von Mozart – hört. Was den passiven Musikkonsum angeht, hat die moderne Hirnforschung die klassische Musik von ihrem Podest gestoßen: Ob Klassik, Jazz oder Pop – anhand der Hirnaktivitäten lässt sich nicht entscheiden, welche Musik ein Mensch gerade hört. „Für die Vermutung, moderne Unterhaltungsmusik sei, hirnlos‘, gibt es hirnphysiologisch keinen Beleg“, betont der Neuropsychologe und –physiologe Lutz Jäncke von der Universität Zürich. Sehr wohl aber macht es einen Unterschied, welche emotionale Wirkung Musik auf den Hörer ausübt. Die positiven Auswirkungen, die dem „Mozart-Effekt“ zugeschrieben wurden, waren letztlich darauf zurückzuführen, dass sich unter den Versuchspersonen viele Liebhaber klassischer Musik befanden.
„Der Kern von Musik ist die Generierung von Gefühlen“, meint Jäncke. Es ist offenbar die ungeheure emotionale Wirkung der Musik, die deren Magie ausmacht. Musik kann das Limbische System aktivieren, das unter anderem für die Ausschüttung von Endorphinen verantwortlich ist. Es handelt sich um dieselben Aktivierungsmuster, die auch bei Sex oder der Befriedigung von Süchten zu messen sind. „Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft“, das hatte schon Richard Wagner begriffen.
Erstaunlich viele Menschen jedoch lassen sich die Glücksgefühle entgehen, weil sie Musik konsumieren, die sie in Wahrheit nicht ausstehen können. Tests mit deklarierten Liebhabern klassischer Musik haben ergeben: Bei 60 Prozent der Versuchspersonen erregte das Hören von Klassik das Lustzentrum. Bei 20 Prozent hingegen kam es zu Reaktionen im sogenannten Mandelkern, der für emotionale Abwehrreaktionen verantwortlich ist. Bei weiteren 20 Prozent wurde gar keine Gefühlsreaktion gemessen. Doch dieser Zwiespalt zwischen Bewertung und Empfindung ist nicht etwa ein Charakteristikum des Bildungsbürgertums: Auch die Gehirne vieler Angehöriger der Hip-Hop-Jugendkultur sträuben sich gegen Rap-Musik. Nur bei 40 Prozent reagierte das Lustzentrum, wenn sie ihrer vermeintlichen Lieblingsmusik lauschten. Beim Rest wurden Ablehnung oder Gleichgültigkeit gemessen.
Eindeutig erwiesen ist, worauf Menschen grundsätzlich mit emotionaler Ablehnung reagieren: auf dissonante Musik. Beim Anhören eines Klavierstückes reagiert das Gehirn heftiger auf irreguläre als auf reguläre Akkorde – sogar bei Menschen, die sich als völlig unmusikalisch einschätzen. Schon vier Monate alte Babys empfinden Wohlklänge als angenehm und verspüren Unbehagen bei schrägen Tönen. Diese Erkenntnisse sind den meisten Hirnforschern peinlich, daher versuchen sie diese zu relativieren. Vor allem wenn sie auf einem Avantgardemusikfestival wie Wien Modern referieren, wo konsonante Klänge verpönt sind. So seien die in der Forschung eingesetzten dissonanten Klänge nicht vergleichbar mit Musik von Arnold Schönberg oder ähnlichen Komponisten, betont Stefan Koelsch. Immerhin: Ein gewisses Maß an Dissonanz tut dem messbaren Musikgenuss keinen Abbruch. Schon bei Wagner oder im klassischen Jazz – beides durchaus „Gänsehautmusik“ – kommen dissonante Klänge vor.
Musikalisch geformte Gehirnwindung
Nicht nur über Musikhörer, auch über Musiker hat die Hirnforschung einiges herausgefunden. So kommt es bei professionellen Pianisten und Geigern zu anatomischen Veränderungen: An jener Stelle der Großhirnrinde, die für die Feinmotorik der Hände zuständig ist, bildet sich eine mit bloßem Auge deutlich sichtbare Gehirnwindung. Schon nach den allerersten 20 Minuten Klavierspielen entstehen neue Verbindungen zwischen Nervenzellen. Binnen Stunden und Tagen wachsen neue Nervenzellenfortsätze (Dendriten), neue Synapsen entstehen, neue Blutgefäße werden gebildet, um die aktivierten Nervenzellen besser mit Blut zu versorgen. „Ein Musiker beginnt bereits im frühen Kindesalter, sein Gehirn zu formen“, erklärt Eckart Altenmüller, Leiter des Instituts für Musikphysiologie und Musiker-Medizin der Musikhochschule Hannover.
Die positiven Auswirkungen dieser Veränderungen: Musiker haben ein wesentlich besseres verbales Gedächtnis als Nicht-Musiker. Und sie erkranken weniger häufig an Alzheimer. Das Risiko von regelmäßig praktizierenden Berufsmusikern, infolge dieser Krankheit ihr Gedächtnis zu verlieren, ist über 60 Prozent geringer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!