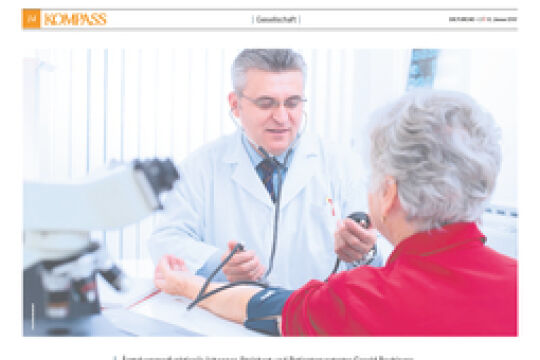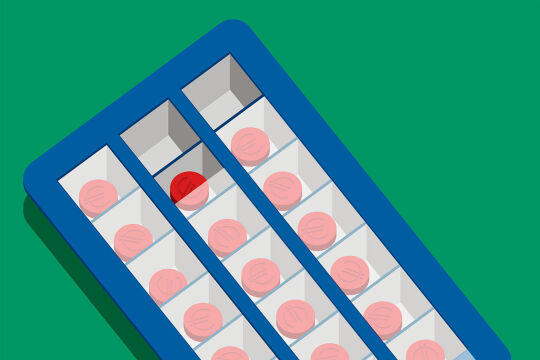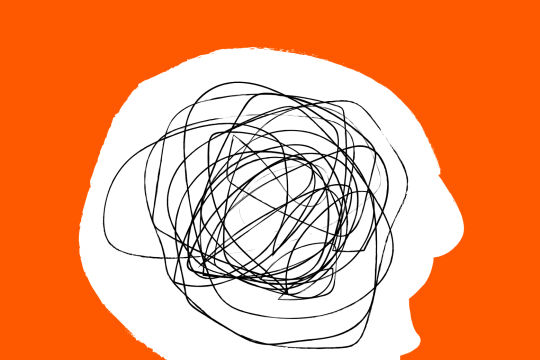Wegen der Altersstruktur von Ärztinnen und Ärzten droht in wenigen Jahr ein Mangel an | Medizinern. Die Bewerbung des Nachwuchs bei freien Stellen nimmt bereits ab.
"Als ich in den Beruf eingestiegen bin, war ich mitten in der Ärzteschwemme“, erzählt Günther Wawrowsky: "Wenn ich in Pension gehe, wird es einen Ärztemangel geben. Für mich als zukünftigen Patienten ist das bedrohlich“, bekennt der Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer. In den nächsten zehn Jahren gehen 37 Prozent der Allgemeinmediziner und 31 Prozent der niedergelassenen Fachärzte, darunter wohl auch der niederösterreichische Internist Wawrowsky, in Pension. Doch schon jetzt wird die Nachbesetzung von Ordinationen immer schwieriger. "Es ist fünf vor zwölf“, warnt Wawrowsky: "Wenn nicht gegengesteuert wird, dann ist die wohnortnahe medizinische Versorgung im niedergelassenen Bereich in Gefahr.“
Kamen in Salzburg vor zehn Jahren noch 20 Bewerber auf eine Kassenplanstelle im ländlichen Raum, so sind es heute nur drei bis vier. Ähnlich ist es in Niederösterreich: "Noch vor fünf Jahren gab es bis zu zehn Bewerber für eine Kassenstelle. Heute sind es nur noch zwei - oder gar keiner, sodass die Stelle abermals ausgeschrieben werden muss“, erklärt Christoph Reisner, der Präsident der Ärztekammer Niederösterreich.
Eine Bedrohung für Ordinationen in kleinen Gemeinden ist das Verschwinden der Hausapotheken. Gibt es in der Nähe keine Apotheke, so darf der Arzt seinen Patienten Medikamente verkaufen. Siedelt sich jedoch in den Nähe eine Apotheke an, so muss der Arzt seine Hausapotheke schließen. Das Problem: Gerade in kleinen Gemeinden können Ärzte ohne die Zusatzeinnahmen aus der Hausapotheke wirtschaftlich nicht überleben. "Die Hausapotheke ist nichts anderes als eine Querfinanzierung von Kassenstellen in Randlagen“, erläutert Wawrowsky. Derzeit gibt es rund 100 Ordinationen, die nach Schließung der Hausapotheke nicht nachbesetzt werden können. In Tirol drohen 116 Kassenplanstellen ihre Hausapotheke zu verlieren. "Es ist zu befürchten, dass 60 Prozent davon nicht nachbesetzt werden können. Damit verlieren 70 Gemeinden ihren Hausarzt“, warnt Wawrowsky.
Viel Arbeit bei niedrigerer Lebensqualität
Es sind nicht nur finanzielle Gründe, die den Beruf des niedergelassenen Arztes im ländlichen Raum zunehmend unattraktiv machen. "Die Lebensqualität rückt immer mehr in den Mittelpunkt“, fasst Reisner die Lebenseinstellung der jüngeren Medizinergeneration zusammen. Immer weniger Ärzte sind bereit, ihr Privatleben zugunsten des Berufes zu opfern. Gerade am Land sind die Anforderungen an die Ärzte enorm: Man steht den Patienten gleichsam rund um die Uhr zur Verfügung, es sind zahlreiche Hausbesuche in abgelegenen Gebieten mit weiten Wegstrecken zu absolvieren. Dazu kommt, dass den Ärzten und ihren Angehörigen das in der Studienzeit lieb gewonnene kulturelle und soziale Umfeld fehlt.
"Diese Voraussetzungen sind familienfeindlich und passen nicht in das Lebenskonzept der Jungmediziner. Vor allem für Frauen sind diese Arbeitsbedingungen untragbar“, meint Wawrowsky. Angesichts der von den Ärzten so bezeichneten "Verweiblichung der Medizin“ ist das ein alarmierender Befund: Jetzt schon sind 53 Prozent der Allgemeinmediziner Frauen; von den Turnusärzten, also den am Spital in Ausbildung befindlichen Medizinern, sind sogar 62 Prozent weiblich. "Wenn zwei Kinder zu Hause warten, dann gibt es keine Diskussion, ob man jetzt noch länger in der Ordination bleiben oder noch einen Hausbesuch machen soll“, weiß Wawrowsky.
Die zunehmende Schwierigkeit, offene Stellen zu besetzen, ist jedoch nicht nur bei den Landordinationen, sondern auch in den Krankenhäusern zu beobachten. Mussten angehende Mediziner früher oft jahrelang auf eine Turnusstelle warten, so ist heute in den Bundesländern ein Ausbildungsplatz binnen kürzester Zeit zu bekommen. Lediglich in Wien beträgt die Wartezeit zwei Jahre. Auch Führungspositionen sind immer schwerer zu besetzen. "Früher haben sich für ein Primariat einer psychiatrischen Abteilung ein Dutzend Mediziner beworben, darunter drei habilitierte. Heute gibt es oft nur noch einen ernst zu nehmenden Bewerber“, berichtet Peter Hofmann von der Universitätsklinik für Psychiatrie in Graz. Auch Robert Hawliczek, Vorstand des Instituts für Radioonkologie am Wiener Donauspital, berichtet Ähnliches von seinem Krankenhaus: Für die Leitung einer Abteilung für Innere Medizin meldete sich überhaupt kein Bewerber von außer Haus. "Probleme bei der Nachbesetzung freier Stellen sind die Vorboten des Ärztemangels“, warnt Hawliczek.
Überbelastung, konsequente Missachtung der Arbeitszeithöchstgrenzen durch Spitalsträger und überbordende Bürokratie: Diese Gründe hält Thomas Szekeres für ausschlaggebend dafür, dass auch die Arbeit am Spital für Jungärzte zunehmend an Attraktivität verliert. "Forschung findet überhaupt nur noch in der Freizeit statt“, erzählt der klinische Labormediziner an der Medizinischen Universität Wien. Die Folge: akute Burn-out-Gefährdung (siehe unten). Die Turnusärzte würden als Hilfskräfte zur Bürokratiebewältigung missbraucht, fährt Szekeres fort: Anstatt von erfahrenen Ärzten am Patientenbett etwas zu lernen, seien sie fast ausschließlich mit Papierkram beschäftigt. "Daher entscheiden sich immer mehr Ärzte nach dem Ende ihrer Ausbildung gegen eine Arbeit im Krankenhaus oder in einer Ordination, und gehen zum Beispiel in die Pharmawirtschaft.“ Psychiater Hofmann, beklagt, dass auf diese Weise das Berufsbild kaputt gemacht werde: "Die Studenten sehen wie es zugeht und sagen sich:, Das tue ich mir nicht an.‘“
Falsche Kriterien in der Auswahl
Um diese Probleme in den Griff zu bekommen oder zumindest zu mildern, hat die Ärztekammer eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt: Zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle für Spitalsmitarbeiter, spitalseigene Betreuungsplätze für Kinder und die flächendeckende Installation von AdministrationsassistentInnen, die den Ärzten die zeitraubenden Verwaltungstätigkeiten abnehmen. Zugleich, so fordert die Ärztevertretung, solle der niedergelassene Bereich ausgebaut werden. Insbesondere die Rolle des Hausarztes solle gestärkt werden. Das "Hausarztmodell“ sieht vor, dass für jeden Bürger ein von ihm frei gewählter Arzt als erster Ansprechpartner und Drehscheibe in Gesundheitsfragen zur Verfügung steht. Diese Aufwertung könnte den Beruf Hausarzt wieder attraktiver machen, hoffen die Ärztevertreter.
Hier nämlich liegt ein weiteres gravierendes Problem: Kaum jemand will heute noch Allgemeinmediziner werden. "Nur einer von zwanzig Turnusärzten setzt sich mit dem Gedanken auseinander, in eine Ordination zu gehen“, weiß Christoph Reisner. Das liegt auch daran, dass die allermeisten Ärzte während ihrer Ausbildung niemals eine Ordination von innen zu sehen bekommen. Theoretisch gibt es zwar die Möglichkeit, dass Turnusärzte eine Lehrpraxis in der Ordination eines erfahrenen Kollegen absolvieren - aber mangels Finanzierung durch die öffentliche Hand kann es sich kaum ein niedergelassener Arzt leisten, einen Turnusarzt zum Kollektivvertrag anzustellen.
Das Desinteresse der Jungärzte an der Allgemeinmedizin könnte auch mit der Zugangsbeschränkung zum Studium zu tun haben. Robert Hawliczek glaubt, dass viele jener Ärzte, die heute hervorragende Allgemeinmediziner sind, seinerzeit an einer Aufnahmeprüfung gescheitert wären. "Wir suchen uns die Genies unter den Studenten heraus“, kritisiert Hawliczek: "Für die Medizinuniversitäten ist das gut, für den niedergelassenen Bereich schlecht. Wir brauchen nämlich in den Medizin nicht nur Genies, sondern auch Handwerker.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!