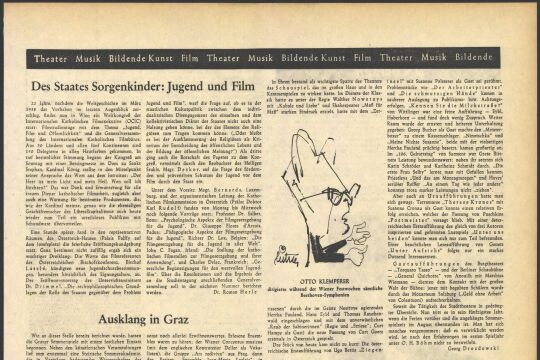Die 59. Berlinale bewies Mut bei der Filmauswahl, die Jury Mut bei der Preisvergabe. Die Stars des diesjährigen Festivals stammen aus Südamerika: Regisseurin Claudia Llosa mit „La teta asustada“ sowie Filmemacher Adrian Biniez mit „Gigante“.
Berlinale-Chef Dieter Kosslick hat keinen risikoreichen Job mehr: Er verlängerte seinen Vertrag soeben bis 2013 und kann darob jetzt richtig mutig sein. Die Finanzkrise sei zwar spürbar, kümmere ihn aber wenig. „Die Berlinale ist dafür da, das Kino zu feiern“, sagt Kosslick. Wohl wissend, wie wichtig der ans Festival angeschlossene „European Film Market“ ist, bei dem in diesem Jahr – gar nicht so mutig – weniger Vertriebsdeals geschlossen wurden als sonst. „Die Filmeinkäufer sind vorsichtiger geworden“, tönt es aus der Branche.
Bei seiner Filmauswahl bewies Kosslick jedenfalls Mut: Denn die 18 Wettbewerbsbeiträge waren weder glamourös (mit Ausnahme des 50er-Jahre-Komödie „My One and Only“ mit Renée Zellweger) noch massentauglich. Dafür brachte die Berlinale sozialkritische und politische Filme sowie mutige Experimente: Etwa Sally Potters abstrakte Talkshow „Rage“, in der die Figuren ausschließlich in Interviewsituationen vor einfärbigem Hintergrund parlieren. Mutig, diesen als Abrechnung mit der Modebranche gemeinten Nicht-Film im Wettbewerb zu zeigen.
Auch die Jury unter Tilda Swinton zeigte Courage: Mit dem Goldenen Bären für den ersten peruanischen Film, der am Berlinale-Wettbewerb teilnahm, zeichnete man ein Drama aus, in dem es zuallererst um Lebensmut geht. Und das vermutlich hierzulande kaum Zuseher finden wird – wie schon die Sieger vergangener Jahre. „Tropa de Elite“ (2008) kam nicht in unsere Kinos.
Mut zur Courage
Trotzdem ist „La teta asustada“ (dt. „Milch des Leids“) ein würdiger Sieger. Die 32-jährige Regisseurin Claudia Llosa, eine Nichte des Schriftstellers Mario Vargas Llosa, zeigt eine junge Frau, die als Kind einer Vergewaltigung die traumatischen Folgen der Militärjunta durchlebt. Zwischen 1980 und 2000 wurden in Peru tausende Menschen umgebracht, entführt und vergewaltigt. Ihre Mutter säugte sie mit der „Milch des Leids“, über die die psychischen Schäden und der Schmerz an das Kind weitergegeben wurden – ein weit verbreiteter Mythos in Peru. Um sich selbst vor Vergewaltigern zu schützen, führt die junge Frau eine Kartoffel in ihre Vagina ein; eine Abschottung, um den nötigen Lebensmut aufbringen zu können.
Mutig war die Entscheidung, den als Favorit gehandelten „London River“ fast gänzlich zu negieren. Das Drama von Rachid Bouchareb dreht sich um eine Mutter (Brenda Blethyn), die nach den Londoner Terroranschlägen vom Juli 2005 verzweifelt nach ihrer vermissten Tochter sucht. Sie trifft einen Afrikaner (Silberner Darsteller-Bär für Sotigui Kouyate), der auf der Suche nach seinem Sohn ist. Nur langsam kann die Mutter akzeptieren, dass die beiden Vermissten ein Paar waren und ihre Tochter gar die arabische Sprache erlernte. „Arabisch? Wer spricht denn schon Arabisch?“, fragt sie einmal. Zu groß ist ihre Angst vor dem Unbekannten. Es braucht ihren ganzen Mut, sich der Andersartigkeit zu stellen und später traurige Tatsachen zu akzeptieren.
Brenda Blethyn war die herausragendste Schauspielerin dieser Berlinale, nur die Jury war nicht dieser Meinung und gab den Silbernen Bären an Birgit Minichmayr. In „Alle anderen“ von Maren Ade verkörpert sie eine junge Frau in einer Beziehungskrise.
Minichmayrs Silberner Bär
„Alle anderen“ teilte sich den großen Preis der Jury mit „Gigante“, dem Erstlingsfilm von Adrian Biniez aus Uruguay, der zwei weitere Preise erhielt. Biniez folgt einem Kaufhaus-Nachwächter, der sich via Überwachungskamera in eine Putzfrau verliebt. Den Mut, sie persönlich anzusprechen, findet er lange Zeit nicht. Der Mut dieses Regisseurs liegt in der stoischen Ruhe, die er seinen Bildern verleiht. Darin platziert er unauffällige, beinahe banal-unpolitische Charaktere.
Politische Filme, das Markenzeichen der Berlinale, wurden mit dem Regiepreis für den Iraner Ashgar Farrhadi für seinen Film „About Elly“ und dem Drehbuchpreis für das US-Drama „The Messenger“ bedacht. Letzterer erzählt etwas konstruiert von zwei Soldaten (Woody Harrelson, Ben Foster), die Todesmeldungen gefallener Kameraden überbringen.
Aus Österreich liefen in der Sektion Panorama zwei Filme, die ebenfalls konstruiert wirken: Bei der Wolf-Haas-Verfilmung „Der Knochenmann“ mit Josef Hader geht diese Konstruktion aber gut in einem von Lokalkolorit gespeisten Krimi auf, der Film wäre wettbewerbstauglich gewesen.
Michael Glawoggers Haslinger-Verfilmung „Das Vaterspiel“ hingegen scheitert an der versuchten Gratwanderung zwischen romanhafter Dichte und in künstlerischer Eitelkeit erdachten Fantasy-Elementen. Ein Übriges tun zwei der Hauptdarsteller, die keine authentische Intonierung der Dialoge schaffen. Glawogger hatte Mut, diesen versatzstückhaft und unmotiviert montierten Film nach Berlin zu schicken. Er selbst kam nicht, weil er mit Dreharbeiten in Bangladesch beschäftigt war.
Der Mut des François Ozon
Den größten Mut bewies aber der Franzose François Ozon mit seinem neuen Film „Ricky“: Was als soziales Familiendrama beginnt, wird schnell zur Fantasy-Fabel, die sich als Humoreske lesen lässt, oder als Seitenhieb auf sensationsgierige (Medien-)Welt: Einem Baby wachsen hier Flügel (!) aus dem Rücken, die aussehen wie Chicken Wings. Bald fliegt es engelsgleich durch einen Supermarkt. Diesen Film in den Wettbewerb um den Goldenen Bären zu hieven, verursachte vielerorts heftiges Kopfschütteln. Aber Dieter Kosslick wusste: Alles andere wäre feige gewesen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!