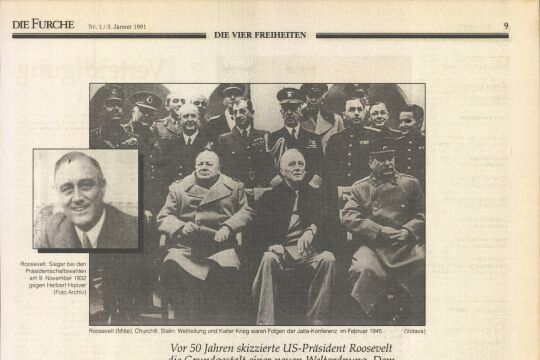Venus und Mars wieder versöhnt. Zehn Jahre nach dem US-Angriff auf den Irak läuft der damals arg ins Stottern geratene transatlantische Motor wieder im Takt - ein Sieg der Symbolpolitik.
Es gibt Dinge, die ändern sich nie: Zum Beispiel der starke Einfluss der US-Waffenlobby auf die amerikanische Politik und die regelmäßigen Massaker infolge des exzessiven Waffenbesitzes in den USA. Der Film "Bowling for Columbine“ prangert diesen privaten Rüstungswahn und seine verheerenden Folgen an. Am 23. März 2003 erhielt der Regisseur Michael Moore dafür den Oscar in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm“.
Und es gibt Dinge, die sind einem ständigen Auf und Ab unterworfen: Zum Beispiel das transatlantische Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Mit der Bombardierung ausgewählter Ziele in Bagdad durch die US-Luftwaffe am 20. März 2003 war der absolute Nullpunkt auf dem amerikanisch-europäischen Beziehungsthermometer erreicht. Die größte Herausforderung für das transatlantische Verhältnis seit dem Zweiten Weltkrieg war da und die Sorge, dass der Rosenkrieg in einer Scheidung endet. Michael Moore jedenfalls redete im Kodak Theatre in Hollywood den Europäern aus der Seele: "Wir sind gegen diesen Krieg, Mr. Bush!“ wetterte er gegen den Kriegspräsidenten und: "Schämen Sie sich! Und jedes Mal, wenn Sie den Papst und die Dixie Chicks gegen sich haben, ist Ihre Zeit abgelaufen …“ An dieser Stelle wurde Moore vom Orchester zu übertönen versucht, doch Moore schimpfte weiter: "Shame on you, Mr. Bush. Shame on you …“
Die Macht- als Gretchenfrage
Moore erntete für seine harten Worte mäßigen Applaus und viele Buh-Rufe. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung war zu diesem Zeitpunkt der Meinung, die USA sollten militärisch gegen Saddam Hussein vorgehen. Auch der Kongress befürwortete trotz Streitigkeiten um Details den Kriegskurs des Präsidenten. Und die deutliche Wiederwahl von Bush im November 2004 bestätigte ebenfalls sein kompromissloses Vorgehen.
Bush war der Amerikaner, Moore der Europäer. Robert Kagan, neokonservativer Denker, Historiker und Berater der Bush-Administration, lieferte dafür die passende Theorie: Das eigentliche Problem hinter dem transatlantischen Beziehungsstreit erklärte Kagan damit, dass die Europäer von der Venus kämen, die Amerikaner jedoch vom Mars. So jedenfalls wurde Kagans damaliges Buch mit dem Titel "Macht und Ohnmacht“ zusammengefasst.
Venus und Mars: In der Mythologie sind die Liebesgöttin und der Kriegsgott entweder ein Liebespaar oder erbitterte Feinde, oft sind sie beides zugleich. In einem Gemälde von Sandro Botticelli dazu schläft er nackt, während sie, gekleidet im höfischen Stil ihrer Zeit, daneben wacht. In Botticellis Bild haben Liebe und Frieden den Schrecken des Krieges überwunden. In Kagans Buch aber wandte sich Europa von der Machtpolitik ab, während die USA diese übernommen hatten. Kagan: "Wir sollten nicht länger so tun, als hätten Europäer und Amerikaner die gleiche Weltsicht oder als würden sie auch nur in der gleichen Welt leben. In der alles entscheidenden Frage der Macht […] gehen die amerikanischen und die europäischen Ansichten auseinander.“
Trittbrettfahrer im Kant’schen Reich
Mit der Zuschreibung der Venus für Europa ging bei Kagan ein vorwurfsvoller Unterton einher. Denn durch den Kampf der USA in der (realen) Hobbes’schen Welt, so Kagan, könnten sich die Europäer als Trittbrettfahrer im (illusorischen) Kant’schen Reich des Ewigen Friedens bequem einrichten und gleichzeitig, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, ihren friedvollen Weg als den moralisch besseren anpreisen.
Zumindest als moralischer Sieger in diesem Planetenstreit ging letztlich die europäische Seite hervor, als bewiesen wurde, dass die beiden Argumente, mit denen Bush seinen Angriff auf den Irak begründete, falsch waren. Der transatlantischen Beziehung hat diese offizielle Abstempelung Bushs als Lügner gut getan. Die Schuld am Zerwürfnis war eindeutig zuordenbar. Der Präsident war das Problem, Amerika konnte wieder geliebt werden. Oder wie es der britische Historiker Timothy Garton Ash beschrieben hat: "Natürlich kann man Ally McBeal lieben und George W. Bush hassen, sich mit einem BigMac stärken, bevor man zur Demo gegen die amerikanische Außenpolitik geht. Das ist es, was viele junge Europäer tun. Wenn sie Antiamerikaner sind, dann sind sie durch und durch amerikanisierte Antiamerikaner. Aber die meisten Europäer sind durchaus in der Lage zwischen einer Regierung und einer Nation zu unterscheiden. Auf die im Sommer 2003 gestellte Frage ‚Was ist das Problem mit Amerika?‘ antworteten in Frankreich und Deutschland fast drei Viertel jener, die sich zu einem negativen Amerikabild bekannt hatten: ‚Vor allem Bush‘, wohingegen weniger als ein Viertel sagte: ‚Amerika als solches‘.“
2003 war auch das Jahr des "Konvents für die Zukunft Europas“, der einen Entwurf für eine Europäische Verfassung erarbeitete. Doch anstatt über die Verfasstheit Europas diskutierten die meisten Europäer über die US-Politik und den Irak-Krieg, stellte Garton Ash zurecht fest: "Der Präsident, über den sie debattierten, war nicht der künftige EU-Präsident, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten.“
Mit der Wahl Barack Obamas 2008 zur neuen Nummer eins in Washington war man auf dieser Seite des Atlantiks wieder gänzlich mit den Staaten versöhnt. Werner Weidenfeld, Direktor des Münchner "Centrums für angewandte Politikforschung“, hatte schon vorher Entwarnung im Rosenkrieg gegeben: "Die Wogen der Aufregung haben sich gelegt, der Ton ist moderater geworden. Es ist seismographisch spürbar, dass die USA und Europa wieder aufeinander zugehen. Beide wissen, dass sie einander brauchen. Beide wissen, dass keine konkurrenzfähige Alternative zur transatlantischen Kooperation existiert.“
Wie sehr Europa auf dieses neue Gesicht gewartet hat, bestätigte das norwegische Nobel-Komitee mit der Verleihung des Friedensnobelpreises 2009 an den neuen US-Präsidenten: "Es kommt nur sehr selten vor“, hieß es in Oslo, "dass eine einzelne Person es in dem Maße wie Obama schafft, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zu ziehen und den Menschen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben.“
US-Politik "vom Rücksitz aus“
Venus war ins Weiße Haus eingezogen. Doch im Unterschied zum Botticelli-Gemälde legte sich Mars nicht schlafen. Selbst Kagan bewertet deswegen die Außenpolitik des Präsidenten recht positiv: "Obama tat das Gegenteil von dem, was sein Vorgänger getan hatte. In groben Zügen kann man sagen, er verbesserte das Bild der Vereinigten Staaten im Ausland, indem er eine freundlichere Sprache pflegte und der muslimischen Welt und auch Russland die Hand reichte.“ Die zweite Phase, so Kagan, war jedoch von der Rückkehr zu den Realitäten geprägt: "Obama entdeckte, dass die Welt die Vereinigten Staaten braucht. Obama verstärkte auch die amerikanische Präsenz in Afghanistan, er vervielfachte die Zahl der Drohnenangriffe und intervenierte in Libyen, um Gaddafi zu stürzen.“
Letzteres taten die USA aber "vom Rücksitz aus“, wie diese neue Linie für Militäreinsätze im Pentagon heißt. Das kommt billiger und verhindert als aggressive Supermacht wahrgenommen zu werden. Damit steigen aber die Erwartungen an die Europäer. Venus Europa muss auf den Vordersitz rutschen, wie es in Libyen und gerade erst in Mali bereits der Fall war. Dafür wird sie mit einer netten Geste belohnt, machte der neue US-Außenminister John Kerry doch Europa zum Ziel seiner ersten Auslandsreise - und nicht Asien, wo Vorgängerin Clinton startete.
Aber so funktionieren eben Beziehungen. Ein Blumenstrauß im richtigen Moment bringt sehr viel wieder ins Lot. Das hat schon Winston Churchill gewusst - und im Falle Amerikas sollte Europa auf die Briten hören: "Die Amerikaner“, sagte Churchill, "werden immer das Richtige tun - nachdem sie alle Alternativen bemüht haben.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!