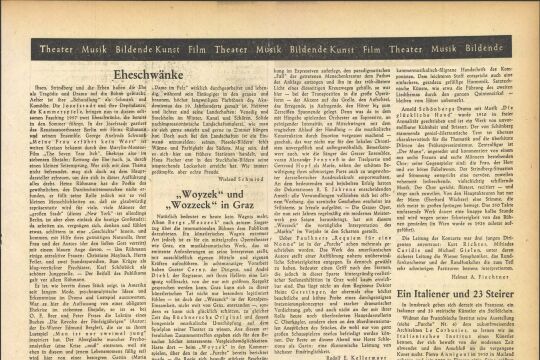Wiener Festwochen: stylisches und modisches Musiktheater
Philippe Quesne versuchte mit Gustav Mahlers „Das Lied der Erde“ „ökologisches Musiktheater“.
Philippe Quesne versuchte mit Gustav Mahlers „Das Lied der Erde“ „ökologisches Musiktheater“.
Inmitten der einem Raumschiff nachempfundenen Bühne eine ihre Augen heftig rollen lassende Sängerin (Sofia Jernberg), die als Bischöfin mit violett-rosa Birett kostümiert ist und zwischendurch ihre Zähne putzen darf, was den Blick von ihren respektablen vokalen Leistungen zuweilen ablenkt, und die exzellent musizierenden, oft zu ungewöhnlicher Gestik angehaltenen, häufig ihre Plätze wechselnden Mitglieder des Klangforum Wien, in einer Art Priesterkleidung mit verkehrt geknöpften Hemden und umgekehrt gegurteten Hosen: eine unmissverständliche Anspielung auf kirchliche Doppelmoral.
An der Spitze dieses so unkonventionell wie entbehrlich mit einer Prince (!)-Kultnummer („Nothing Compares 2 U“) eröffneten Musiktheaters der mit lockerer Souveränität durch die Partitur führende Dirigent Ingo Metzmacher. Er durfte mit besonderer Hingabe zwischendurch auf Italienisch den Satz „Ich habe meinen Vater getötet, Menschenfleisch gegessen und jetzt zittere ich vor Glück“ zitieren. Warum? Auch diese Pointe erschloss sich – wie so vieles – nicht in dieser grellen Bilder- und Assoziationsfolge, die Marlene Monteiro Freitas eingefallen ist zu den Texten und der Musik von Arnold Schönbergs Klassiker „Pierrot lunaire“ – im Original ein auf 21 Gedichten von Albert Giraud in der deutschen Übersetzung von Otto Erich Hartleben basierender Zyklus für Singstimme und Kammerensemble.
Diesem Konzept versuchte die aus Kap Verde stammende Regisseurin ihre sich intellektuell gebärdende, vor billigen Effekten nicht zurückschreckende choreografische Lesart entgegen zu stellen. Mit dem Ergebnis, dass dieser „Pierrot“ sich bald als Ort bunter Beliebigkeit präsentierte. Schönbergs Intentionen blieben auf der Strecke. Oder wollte man sich mit ihnen gar nicht näher auseinander setzen?
Gleich Schönbergs „Pierrot“ benötigt auch Mahlers „Das Lied von der Erde“ keine szenischen Erläuterungen. Auch hier genügt ein Versenken in Wort und Musik, um in die Tiefe dieses symphonischen Werks zu gelangen.
Philippe Quesne versuchte es modisch als Art ökologisches Musiktheater zu deuten. Ein den Gehalt des Werks nicht nur kontrapunktierendes, sondern auch deshalb problematisches Unterfangen, weil sich dieser Ansatz bloß aus den atmosphärischen, die Apokalypse andeutenden Bühnenbildern erschließen ließ. Zu den Protagonisten ist dem französischen Regisseur und Bühnenbildner kaum etwas eingefallen. Da hätte man es gleich bei einer konzertanten Aufführung belassen können. Allerdings mit einer anderen, adäquateren Besetzung: Michael Pflumm zeigte sich bei seinem Part mehrfach überfordert, Christina Daletska bemühte sich um Wortdeutlichkeit, ohne die Magie des Finales deutlich machen zu können.
Und was nutzt ein zumeist perfekt agierendes Klangforum Wien – aufgeführt wurde dieser Mahler in der exzellenten Kammermusikversion von Reinbert de Leeuw –, wenn es der Dirigent, Emilio Pomàrico, mit kaum mehr als mit Routine zu führen wusste. Da kommen der Charme und viele der Eigenheiten dieser Musik zwangsläufig unter die Räder.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!