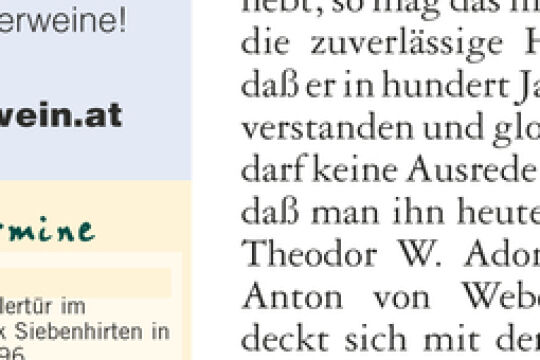Fulminanter Saisonauftakt am Wiener Volkstheater mit Ibsens "Peer Gynt".
Die totale Selbstverwirklichung: Er sucht sie im Sex, in Macht und Geld, in der Religion, in der Philosophie - doch am Ende seines Lebens muss Peer Gynt feststellen, dass er trotz all seiner Unternehmungen ein Niemand geblieben ist: einer, der nicht aus der Masse heraussticht; einer der es nicht wert ist, zu Höllenqualen verdammt oder in die Himmelsseligkeit gehoben zu werden. Statt der erstrebten Selbstverwirklichung hat er es nur zum "Kaiser der Selbstsucht" gebracht.
Mit dieser aktuellen Deutung von Henrik Ibsens "Peer Gynt" ist dem Wiener Volkstheater ein fulminantes Saisondebüt gelungen. Das Stück gilt ja als "nordischer Faust" und Regisseur Michael Sturminger hat es bravourös geschafft, den damit verbundenen Ansprüchen gerecht zu werden. Dieser "Peer Gynt" ist tatsächlich nichts weniger als eine Parabel über den Menschen von heute: über den ewig jugendlichen, verantwortungslosen Hedonisten, der nicht merkt, dass er seinen vermeintlichen Individualismus mit Millionen anderen vermeintlich einzigartigen Individuen teilt. Dringt man durch all seine Hüllen und Selbsttäuschungen, so bleibt nichts übrig von ihm - wie bei der Metapher der geschälten Zwiebel in Ibsens Drama.
"Sei Dir selbst genug!"
Der Peer Gynt des brillanten Raphael von Bergen ist kein romantischer Träumer, sondern ein körperlich sehr präsenter, von Selbstgefälligkeit triefender Ellenbogenmensch. Als todkranker Patient auf einer Krebsstation halluziniert er einen von ihm als erstrebenswert erachteten Lebensweg, wobei er die Menschen um sich herum in seine Phantasien mit einbezieht. Aus der Putzkolonne des Krankenhauses werden jene Trolle, die ihn sein Lebensmotto lehren: "Sei Dir selbst genug." In eine - wie er - infolge Chemotherapie glatzköpfige Mitpatientin (Annette Isabella Holzmann als Solveig) projiziert er die große Liebe, die er nie hatte. Daher gibt es am Ende für ihn keine Erlösung, sondern den anonymen Spitalstod, begleitet vom monotonen Warnsignal des zum Stillstand gekommenen Elektrokardiogramms.
Die mitunter von Live-Musik untermalte Aufführung ist bis in die kleinsten Rollen hervorragend besetzt, genannt seien stellvertretend Thomas Kamper und Christoph F. Krutzler. Allein Beatrice Frey als Peer Gynts Mutter Aase agiert so hölzern, ans Skurrile grenzend, dass ausgerechnet die berühmte Szene, in welcher der Sohn die Mutter sanft vom Leben in den Tod geleitet, beinahe in die Hose gegangen wäre. Doch hier erweist sich - neben der Darstellungskraft von Bargens - der Text als stark genug, um die Sterbeszene zu retten. Trotz zahlreicher Textstriche nämlich wurde Ibsens dramatisches Gedicht nicht zertrümmert, sondern vermag nach wie vor für sich allein zu stehen. Wer will, kann zwischen den beiden sich immer wieder erstaunlich präzise berührenden Parallelwelten hin und her switchen: zwischen dem alten, märchenhaften Text und der modernen Interpretation. Diese allerdings erweist sich als so durchdacht und so schlüssig, dass man sich ihr letztlich nicht entziehen kann.
So soll Theater sein!