Hrdlickas Darstellung des Abendmahls als homoerotisches Gelage, Kippenbergers gekreuzigter Frosch: Zeitgenössische Kunst im christlichen Kontext vermag nach wie vor zu provozieren. Anmerkungen zu einem notorischen Spannungsverhältnis.
Der Witz lautet ungefähr folgendermaßen: Ein Galeriebesucher schlendert durch eine Ausstellung, und gerade als er den beschaulichen Ort wieder verlassen möchte, holt ihn der Galeriebetreiber hastigen Schrittes ein und meint ganz aufgeregt: "Zeitgenössische Kunst provoziert wieder!" Der Besucher antwortet mit schweren Augenlidern und im Tonfall eines herzhaften Gähnens: "Ach ja …" Zumindest kann man nach wie vor über sie lachen, über die Kunst. Und wenn schon nicht lachen, dann zumindest schmunzeln. Als Objekt mehr oder minder gelungener Belustigung dient die Kunst noch, und wenn das zu hoch gegriffen erscheint, dann wenigstens zu einer belanglosen Unterhaltung, weil der Bedeutungsschwangerschaft keine Geburt folgt.
Bleibendes Skandalon
Die jüngsten Vorkommnisse in Wien und Bozen strafen aber den Witz Lügen. Die Reaktionen der Museumsbesucher - so sie denn tatsächlich dort waren - nährten sich vor allem von einem: von tief erschütternder Provokation. Alfred Hrdlickas Abendmahlsdarstellung als Gelage einer Männerrunde durfte ebenso wenig bis zum geplanten Ende der Ausstellung sichtbar bleiben wie Martin Kippenbergers gekreuzigter Frosch. Konnten denn die Jünger beim Abendmahl tatsächlich so ausgelassen feiern, wie es Hrdlickas Andeutungen von homoerotischen Akten nahelegen? Kann ein besoffener Frosch am Kreuz denn etwas anderes ins Gesichtsfeld bringen als eine gezielte Verhöhnung des Prototyps eines Gekreuzigten in der abendländischen Kulturgeschichte, des Jesus von Nazareth?
Weder Hrdlickas süffisante Anmerkung, es konnten sich eben nur Männer in dieser Form ihre Zuneigung eingestehen, weil eben keine Frauen anwesend waren, noch Kippenbergers doppelte Identifikation, einmal mit der erbärmlichen Kreatur des Frosches und dann mit Christus als der Zusammenfassung alles menschlichen Leidens, lassen die Darstellungen harmlos erscheinen, sodass sich damit alle Aufregung über diese beiden Arbeiten aus der Welt schaffen ließe. Das wollen sie aber auch gar nicht. Der Gekreuzigte als bleibendes Ärgernis: mit dieser für den damaligen Kontext nicht minder blasphemischen Grundannahme hat bereits Paulus hohe, weil sperrige Theologie betrieben.
Was ist passiert, dass die damalige (sowohl für die hellenistischen als auch für die jüdischen Zuhörer) Blasphemie heutzutage höchstes Ansehen genießt, die aktuellen Blasphemien à la Hrdlicka und Kippenberger - die sich in eine lange Liste ähnlicher Fälle einreihen - aber an diesen Status gebunden bleiben und deswegen bekämpft werden (müssen)? Reicht es, einfach auf die beinahe zweitausendjährige Erfolgsgeschichte der theologischen Kunstwerke von Paulus in Form von Briefliteratur zu verweisen, die eine derartige Fülle von Interpretationen mit sich gebracht hat, dass die Ungeheuerlichkeit seiner Aussage damit wegerklärt wäre?
Einlullende Gewöhnung
Mit Sicherheit nicht, dieser Urskandal des Christentums bleibt unumstößlich aufrecht. Er unterwandert jede Generation von christlichen Existenzen samt ihren Vorstellungsmustern aufs Neue, auch wenn diese ihn aufgrund der sachte einlullenden Gewöhnung nicht mehr wahrnehmen. Das Christusereignis selbst behauptet sich als ein blasphemischer Akt gegenüber allen Gottesvorstellungen, zu denen Menschen bis dahin fähig waren, der Philipperbrief besingt es als "Entäußerung" (Phil 2,6-11). Wenn Kunst sich Themen annimmt, die aus den großen Berichten des Christentums stammen, dann wird sie in logischer Konsequenz in vielen Feldern blasphemisch sein, gerade dort, wo dies den Betrachtern schlichtweg entgeht.
Das Übersehen dieser unerhörten Grundlage von Kunstwerken im christlichen Kontext ergibt sich aber nicht nur aus der Gewöhnung, sondern auch aus der Kanonisierung bestimmter Bildformen. Wir nehmen daher eine Kreuzigungsdarstellung in der überkommenen Art nicht mehr als blasphemisch wahr. Sinnvollerweise kann man daher zwischen einer "guten" und einer "schlechten" Blasphemie unterscheiden. Wobei die Grenzziehungen zwischen dem, was wir als ein bildliches Erschließen unseres Glaubens ansehen können, und dem, was wir als Verschleierung dessen betrachten, immer eine Wanderbewegung vollziehen. Das war schon immer so, wie ein historisches Beispiel belegt: Über Jahrhunderte zeigten Darstellungen den Gekreuzigten immer in seiner göttlichen Herrlichkeit als "König am Kreuz", als eine "gute Blasphemie". Im Zuge der spirituellen Umorientierung der via moderna verschob sich das Interesse völlig, gerade der Aspekt des menschlichen Leidens eroberte die Bildgestaltungen. Die aus damaliger Perspektive zunächst "schlechte Blasphemie" hat sich im Laufe der Zeit zu einer "guten Blasphemie" gewandelt.
Nitschs Eingemeindung
Dass diese Wandlungen nichts mit Beliebigkeit zu tun haben, sondern schwer errungen sind, zeigt nicht nur die Geschichte, sondern auch das eine oder andere Ereignis aus unserer Zeitgenossenschaft. Darüber hinaus sehen wir, dass schnelle Eingemeindungen von Kunstwerken als prophetische Elemente, die im kirchlichen Diskurs dann zurechtgerückt werden, nicht funktionieren. So laufen etwa die Argumente der christlichen Verteidiger von Hermann Nitsch darauf hinaus, dass er wie kaum ein anderer Künstler das "Opfer Christi" neu verständlich mache. Dummerweise lehnt Nitsch aber just diesen Aspekt als kruden "Merkantilismus" ab - ihm geht es rein um die Oberflächenästhetik und den Warencharakter von rituellen Handlungen. Nicht dass das per se schlecht wäre, ganz im Gegenteil, aber es folgt daraus eine ganz andere Anfrage an den christlichen Diskurs darüber. Bei Nitsch fließt Tierblut, oft mit roter Farbe vorgetäuscht, das "Opfer Christi" hat diese "heidnische" Inszenierung längst hinter sich gelassen. Ganz anders die Aktionen von Nitschs französischem Kollegen Michel Journiac, der sein eigenes Blut, Menschenblut, verwendet hat. Sollte man sich da nicht eher an Journiac wenden?
Das wäre auch ein Verzicht auf das Vordergründige der Provokation. Bernhard Fruehwirth schuf für eine Wand an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien eine Großgrafik, die als "Höllentor" mit der zentralen Botschaft, dass das Leben ein Witz sei, dieses Arbeitsumfeld provozierte (siehe obenstehendes Bild). Ganz still, trotz der raumgreifenden Ausmaße. Bernhard Fruehwirth ist ein Preisträger des Otto-Mauer-Preises, eines kirchlichen Kunstpreises. Wann wird davon von den Kanzeln herunter gesprochen? Oder von den Aktivitäten im Kulturzentrum Minoriten in Graz, oder vom dortigen Kunstpreis, oder vom Kardinal-König-Preis in Salzburg, oder vom Kunstraum Kirche in Innsbruck, oder vom Institut für Kunst in Linz, um nur einige zu nennen.
Dort fänden sich Anregungen zuhauf, weil die nämlich wissen, dass der Versuch, große Namen einzukaufen, mit den Möglichkeiten des Kunstmarktes nicht mithalten kann; und weil die auch wissen, dass man alle diese Bildfindungen nicht festhalten kann, wie die Kunsttheorie des Evangeliums in der Verklärungsperikope klarstellt. Endlich ist den Jüngern ein Auge aufgegangen, sie sehen buchstäblich eine Verwandlung, eine Umgestaltung ihrer bisherigen Blickgewohnheit. Der Versuch dafür Hütten - Galerien, Museen, Bibliotheken - zu bauen, läuft als naive Variante ins Leere. Die Grenzen wandern seit damals weiter, und auch die Verklärungen halten weiter an.
Der Autor leitet seit 2001 das Ausstellungsprojekt "die SCHAU!" (vgl. www.die-schau.at) an der Universität Wien und den daran angekoppelten Forschungsschwerpunkt "Kunstwerk Dogmatik" am Institut für Dogmatische Theologie.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!











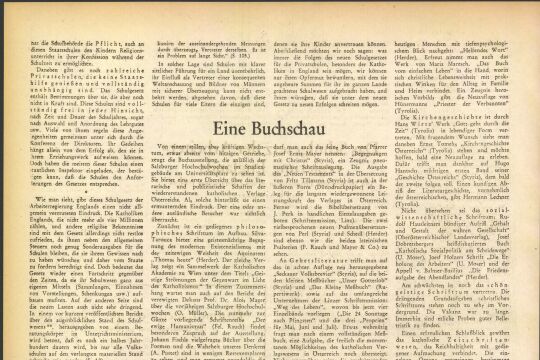








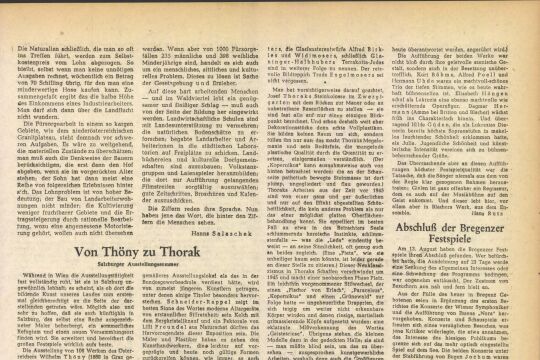



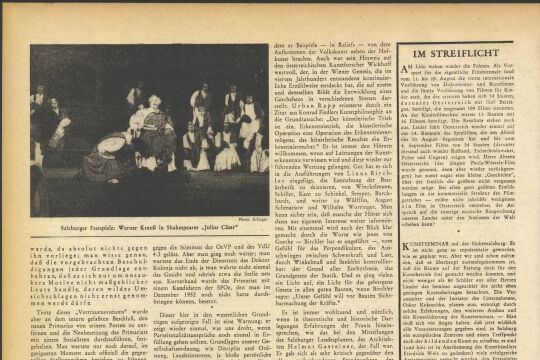





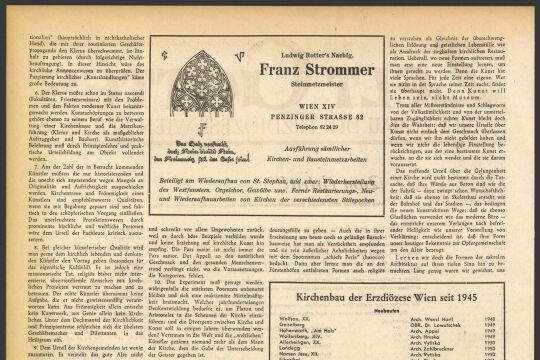

































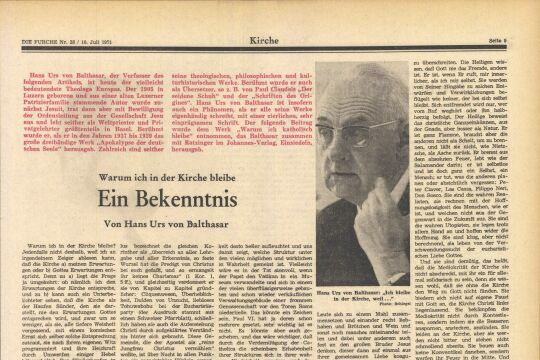
























.jpg)




