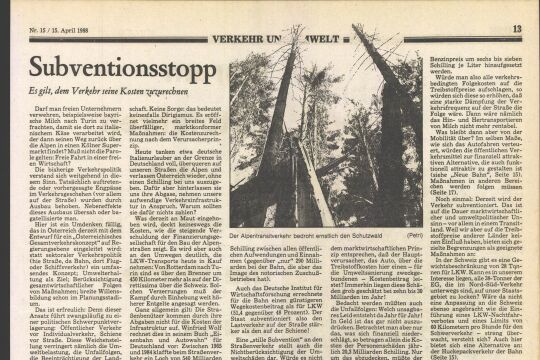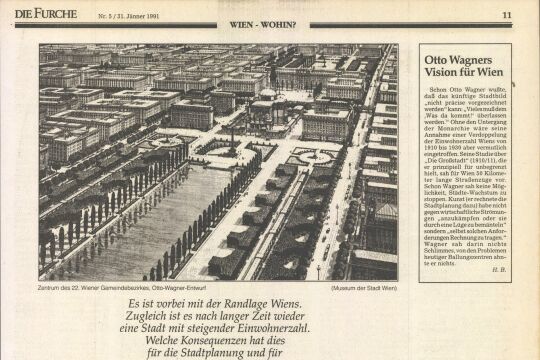Trotz quantitativen Wachstums verlieren unsere Städte zunehmend an urbaner Substanz. Die Entwicklung geht klar zu Lasten der Zentren und zu Gunsten der Speckgürtel.
In der jüngst wieder aufgeflammten Debatte um die Pendlerpauschale kritisierten Verkehrsexperten einmal mehr dessen nachteilige Folgen für unsere Siedlungsentwicklung. Tatsächlich sind es nicht nur die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, also die klassischen Instrumente der kommunalen Raumplanung, die über Wohl und Weh der österreichischen Städte und Gemeinden entscheiden. Und noch weniger Wirkung geht von den meist zahnlosen Landesraumordnungsgesetzen und -programmen aus. Die bauliche Entwicklung unseres Lebensraums wird deutlich stärker durch öffentliche Investitionen, Steuerregelungen und Förderungen bestimmt als durch Pläne.
So kommt auch das Pendlerpauschale überwiegend nicht mehr dem Zuerwerbsbauern aus dem Weinviertel oder der Supermarktkassierin aus dem Burgenland zu Gute, die nach Wien zur Arbeit fahren müssen, sondern den Pendlern aus den nach wie vor boomenden Speckgürteln im Umkreis von bis zu zwanzig Kilometern um die großen Städte - genauer jenen, die mit dem Pkw fahren. Damit werden jene Haushalte bezuschusst, die sich die Bodenpreise im Stadtumland, ein eigenes Häuschen und dazu noch zwei bis drei Autos leisten können - also die soziale Mittel- und Oberschicht, die keinerlei Subventionierung bedürfte. Und noch viel schlimmer: Förderungen wie diese machen es für immer mehr Menschen attraktiv, ja lukrativ, der Stadt mit ihrer fußläufig erreichbaren Nahversorgung und ihrem öffentlichen Verkehrsnetz den Rücken zuzukehren und sich suburban anzusiedeln.
Sozialer, teurer Wohnbau
Doch sind natürlich auch die Städte selbst daran schuld, dass sich Tausende Bürger alljährlich zur Abwanderung ins Grüne entscheiden: Die dicht bebauten Stadtviertel sind geprägt vom chronischen Lärm und den gesundheitsgefährdenden Abgasen des Autoverkehrs - sommers von bodennahem Ozon, winters von Feinstaub. Im öffentlichen Raum ist schon lange kaum mehr Platz für Aufenthalt, Kommunikation und Spiel, denn wo keine Autos fahren, stehen parkende Autos herum. Dazu kommt ein sozialer und dennoch teurer Wohnbau "von der Stange“, der in mancher Hinsicht auf dem Niveau der 1970er-Jahre stehen geblieben ist - ja bezüglich Belichtung, Freiflächengestaltung und Gemeinschaftseinrichtungen mitunter sogar dahinter zurückfällt. Das Häuschen mit eigenem Garten, und sei es aus dem Fertigteilkatalog, wird so zum Wunschtraum vieler Städter. Der gegenläufige Trend - zurück in die City, am besten in eine Dachgeschoßwohnung mit Terrasse - bleibt dagegen (allein finanziell bedingt) ein Minderheitenprogramm.
Der Substanzverlust der Kernstädte, also der kompakt bebauten Innenbereiche unserer Ballungsräume, beschränkt sich nicht auf Bewohner allein. Längst ist der automobile Einkauf jenseits der Stadtgrenze zur Normalität geworden - mit den bekannten Folgen für die innerstädtische Nahversorgung: Allein in Wiens traditionellen Geschäftsstraßen und ihrem direkten Umfeld stehen über 100.000 Quadratmeter Verkaufsfläche leer. Die dadurch bedingte Verödung der Erdgeschoßzonen trägt noch ein Übriges dazu bei, dass die Attraktivität der Zentren zunehmend schwindet.
Zu guter Letzt verlagert sich auch noch die Funktion Arbeit merklich von der Kernstadt ins Stadtumland - dank Wirtschaftsförderungen von Bund und Ländern, die ihre Subventionen an keinerlei raumplanerische Kriterien knüpfen. So stehen den 260.000 täglichen Einpendlern nach Wien bereits über 60.000 Wiener gegenüber, die in die Ostregion auspendeln - und dies zu 93 Prozent mit dem Pkw tun. Damit nähern sich unsere Städte tendenziell dem alles andere als nachhaltigen US-amerikanischen Siedlungsmodell an: im Zentrum die City mit Verwaltungs-, Sozial- und Kultureinrichtungen, Rechts- und Finanzdienstleistungen sowie Wohnviertel für eine schmale urbane Elite beziehungsweise für sozial schwache Gesellschaftsschichten - und darum herum weitläufige autoabhängige Suburbs sowie Shopping- und Entertainment-Center für die breite Mittelschicht.
Zweiter Speckgürtel innerhalb der Stadt
Die heimischen Strategien, um die Kernstädte im Wettkampf mit ihrem Umland zu stärken, scheinen mehrheitlich nicht dazu angetan, diesen Trend umzukehren. Denn anstatt die Lebensbedingungen in den dicht bebauten Gebieten grundlegend zu verbessern - sei es durch Investitionen in den öffentlichen Raum, in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie in qualitätsvolle Wohnbauten, sei es durch eine massive Eindämmung des Pkw-Verkehrs bei gleichzeitiger Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs - beschreiten die Städte die vor Jahrzehnten eingeschlagenen Wege heute teils noch vehementer oder treten gar in Konkurrenz zu ihren Speckgürteln.
So entstanden etwa in Wien seit den 1990er-Jahren große Wohnviertel ohne jegliche Freiraumqualität, die an Dichte die gründerzeitlichen Massenquartiere ebenso übertreffen wie die "unmenschlichen“ Großsiedlungen der 1960er- und 70er-Jahre. Gleichzeitig gab das Rathaus ab 1992 mehr als 20.000 Kleingartenparzellen zur Bebauung durch freistehende Einfamilienhäuser frei und schuf damit einen zweiten Speckgürtel innerhalb der Stadtgrenze - angereichert durch immer neue Handelseinrichtungen in abgelegenen Gewerbegebieten, ungeachtet des bereits bestehenden Überangebots an Einkaufszentren und Fachmärkten. Neben dieser Art Siedlungspolitik trägt auch die Verkehrspolitik der Städte zum stadtzerstörerischen Boom des Autoverkehrs bei. Noch nirgends in Österreich wurde eine City-Maut eingeführt, wie sie in vielen europäischen Städten bereits erfolgreich eingehoben wird. Und auch die Gebühren für das Parken im öffentlichen Raum sind hierzulande vergleichsweise sozial.
Falsche politische Signale
Man muss den heimischen Städten allerdings zubilligen, dass sie bei der Bewältigung ihrer mitunter überregionalen Probleme vom Bund und den Ländern im Stich gelassen werden. So wäre es Aufgabe der Bundesregierung, endlich Kostenwahrheit im - weit über die Pendlerpauschale hinaus - subventionierten Straßenverkehr herzustellen, was vor allem im urbanen Raum zu einem sofortigen Rückgang des Pkw-Gebrauchs führen würde. Ebenso müsste der Bund viel mehr Geld in den öffentlichen Personennahverkehr investieren, mit dessen überfälligem Ausbau die Kommunen und Länder budgetär überfordert sind.
Die Länder wären als übergeordnete Raumordnungsbehörden in der Pflicht, die Städte vor der ruinösen Konkurrenz durch ihre Nachbargemeinden zu schützen: durch klare regionalplanerische Vorgaben, welche Entwicklungen an zentralen, suburbanen und peripheren Standorten möglich oder eben auch nicht möglich sind. Und schließlich hätten sie es über diverse Förderinstrumente in der Hand, die Siedlungsentwicklung nachhaltiger zu gestalten. An vorderster Stelle steht dabei die Wohn-bauförderung in Höhe von derzeit 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, deren Vergabe kaum an stadt- oder ortsplanerische Ziele gekoppelt ist. In Nordrhein-Westfalen etwa wird die Wohnraumförderung ganz bewusst eingesetzt, um die Wohnbautätigkeit in den stagnierenden Großstädten zu konzentrieren. Daher gewährt die Landesregierung zum Basisförderbetrag von 20.000 bis 45.000 Euro einen sogenannten Stadtbonus in Höhe von weiteren 20.000 Euro, wenn Wohnraum in einer der 32 größten Städte des Landes geschaffen wird. Zudem genießt die Sanierung von Wohnungsbestand Vorrang gegenüber dem Wohnungsneubau. Damit signalisiert die Politik unmissverständlich, dass sie die Entwicklung der urbanen Zentren über ein weiteres Wachstum an der Peripherie stellt.
Der Autor ist Stadtplaner, Filmemacher und Fachpublizist in Wien sowie Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung