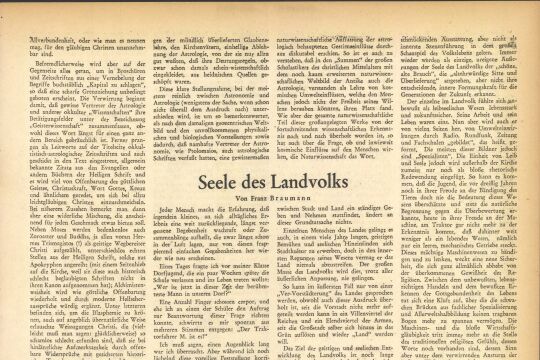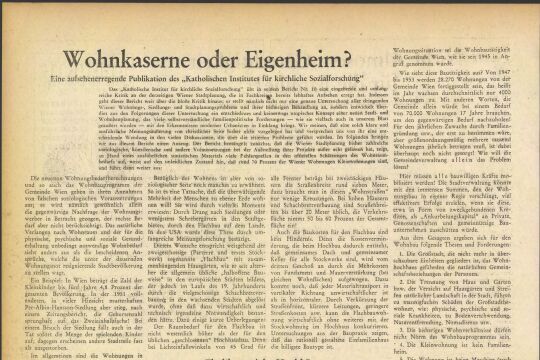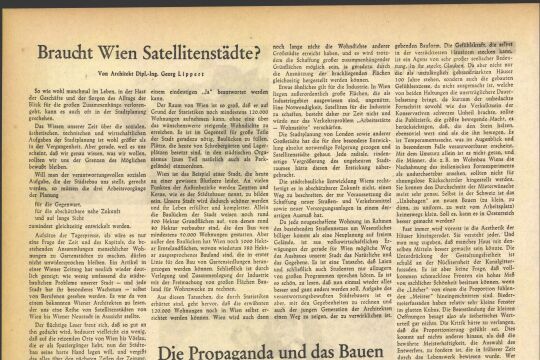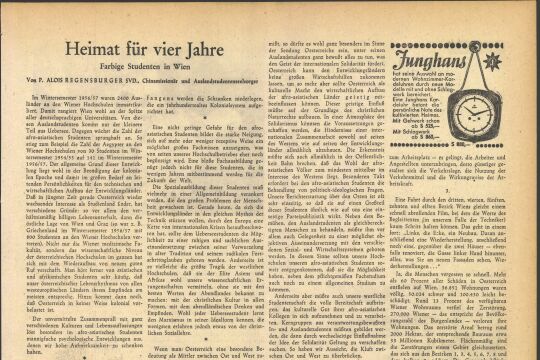Die Wiener Gemeindebauten der Jahre 1919-34 waren weltweit einzigartig. Heute herrscht das Mittelmaß.
Im Jahr 1919 hatten nur fünf Prozent aller Wiener Wohnungen fließendes Wasser. und lediglich sieben Prozent verfügten über elektrisches Licht. Die meisten Wohnungen waren zudem überbelegt und aufgrund der dichten Bebauung der gründerzeitlichen Massenquartiere schlecht belichtet und belüftet. Die Tuberkulose grassierte in dieser Zeit wie eine Seuche und hieß bezeichnender Weise "Wiener Krankheit". So überrascht es nicht, dass die Sozialdemokratische Arbeiterpartei als Siegerin der Wiener Kommunalwahlen von 1919 den Wohnbau als ihre vordringlichste politische Aufgabe sah.
Quantensprung von 1919 ...
Die Einnahmen aus Luxussteuer, Wertzuwachssteuer und Wohnbausteuer ermöglichten der neuen Stadtregierung den Ankauf Tausender Hektar Bauland und ab 1923 die Errichtung von insgesamt 64.000 kommunalen Wohnungen. Erlaubte die Bauordnung vor 1919 einen Verbauungsgrad von bis zu 85 Prozent der Grundstücksfläche, so wurde dieser Wert von der sozialdemokratischen Stadtverwaltung zunächst auf 60 Prozent reduziert, um die Besonnung aller Wohnungen sowie ausreichend Freiraum zu gewährleisten. Später sank der Bebauungsgrad bis auf 24 Prozent - etwa beim George-Washington-Hof (1927- 1930), mit über 10.000 Bewohnern einer der so genannten "Superblocks" des Roten Wien.
Bis heute erstaunt die hohe Ausstattungsqualität der Gemeindebauten: Jede Wohnung hatte ein Vorzimmer, Toilette, Wasser- und Gasanschluss (allerdings kein Badezimmer) sowie meist auch Balkon, Loggia oder Erker - was gemessen an den gründerzeitlichen Arbeiterquartieren einen Quantensprung bedeutete. An Gemeinschaftseinrichtungen fanden sich in den Anlagen Badehäuser, Waschküchen, Kindergärten und Spielplätze, an weiterer Infrastruktur Gesundheits- und Sozialdienststellen, Büchereien, Postämter, Geschäfte und Gaststätten. Dennoch waren die Mieten für alle erschwinglich: Eine durchschnittliche Gemeindewohnung kostete lediglich vier bis acht Prozent eines Arbeitermonatslohns. Die Mieteinnahmen sollten der Stadt auch keine Gewinne einbringen, sondern lediglich die laufenden Instandhaltungskosten decken.
... mit Ständestaat zu Ende
Mit der Errichtung des Ständestaats 1934 ging diese Blütezeit des sozialen Wohnbaus abrupt zu Ende. Und in der darauffolgenden ns-Diktatur verlor die Stadt nicht nur viele der über 200 Architekten des Roten Wien, sondern auch jene engagierten Politiker, die für das soziale Wohnbauprogramm verantwortlich zeichneten. Dieser geistig-kulturelle Aderlass schlug sich in zahlreichen kommunalen Wohnanlagen der 1950er, 60er und frühen 70er Jahre unmittelbar nieder. Die Per-Albin-Hansson-Siedlung, die Großfeldsiedlung, die Wohnhöfe auf den Trabrenngründen oder Am Schöpfwerk zeugen bis heute von der Maxime "Masse statt Klasse". In den relativ liberalen 70ern gewährte die Politik allerdings auch so manchem Wohnbau-Experiment den nötigen Spielraum: sei es Harry Glücks Wohnpark Alt Erlaa, der wohl einzige Großwohnbau seit 1945, dessen Freiraum- und Ausstattungsqualität an die Modelle der 1920er und 30er Jahre anknüpft, sei es die sanfte Stadterneuerung, die den immensen Altbauwohnungsbestand Wiens sozial verträglich aufwertete.
Mitte der 1980er Jahre schien der Wohnraumbedarf der Wiener Bevölkerung endlich gedeckt - und das sozialpolitische wie experimentelle Engagement der Stadtväter zusehends dem Drang nach mehr Ästhetik zu weichen. Wien versuchte nun - teils mit großzügigen Subventionen aus der kommunalen Wohnbauförderung - internationale Stararchitekten für die Errichtung sozialer Wohnbauten zu gewinnen. Jean Nouvel etwa realisierte in der Leopoldauerstraße Anfang der 1990er Jahre Eigentumswohnungen, deren Gesamtpreis - am Beispiel einer 105-Quadratmeter-Maisonette - von rund 3,2 Millionen Schilling (233.000 Euro) durch einen "nicht-rückzahlbaren Baukostenzuschuss" der Stadt Wien in Höhe von rund 1,1 Millionen Schilling (80.000 Euro) um mehr als ein Drittel reduziert wurde. Nicht nur, dass Wohnungen in dieser Preisklasse kaum mehr Förderungen aus dem sozialen Wohnbaubudget rechtfertigen - etliche Lofts in Nouvels Vorzeigeprojekt standen zudem jahrelang leer.
Wohnen im Gasbehälter?
Mit nicht-rückzahlbaren Zuschüssen sowie einer beispiellosen, öffentlich finanzierten Werbekampagne wurden auch die Apartments in den denkmalgeschützten Gasometern an den Mann gebracht. Der Einbau von über 600 Wohnungen samt einer Shopping Mall in die historischen Ziegelhüllen galt als Prestigeprojekt des Wiener Wohnbaustadtrats. Ob ausgediente Gasbehälter tatsächlich ein geeigneter Ort zum Wohnen sind, ob der Standort inmitten eines Gewerbegebiets am East End von Wien, begrenzt von zwei Autobahnen, ein lebenswertes Umfeld bieten kann, wurde dabei nie hinterfragt. So entstanden Wohnungen, die hinsichtlich Belichtung und Besonnung zwangsläufig nur ein Kompromiss sein konnten, und enge Innenhöfe, deren Bewohner mehr akustischen und visuellen Kontakt zu ihren Nachbarn haben als ihnen lieb sein kann. So entstand ein Wohnviertel, das über keinerlei Grün-, Spiel- und Erholungsflächen verfügt.
Dichte und Enge, als Missstände der Gründerzeit vergessen geglaubt, prägen mit dem Anspruch einer "neuen Urbanität" auffallend viele Wohnbauten der letzten Jahre. An der Wagramer Straße drängen sich, vom Autoverkehr durch eine elfgeschoßige Häuserzeile abgeschirmt, sechs Wohntürme - ebenfalls aus der Hand renommierter Architekten. Im Schnitt entfallen dabei die untersten 14 Etagen auf genossenschaftliche Mietwohnungen, deren Ausblick lediglich zur benachbarten Straßenbebauung reicht. Zwischen 15. und 19. Stock, wo der Verkehrslärm der Wagramer Straße noch wahrnehmbar ist, liegen geförderte Eigentumswohnungen. Darüber folgen drei Geschoße mit frei finanzierten Wohnungen - und im 22. Stockwerk schließlich ein luxuriöses Penthouse mit großzügiger Dachterrasse.
Dass öffentlich geförderter Wohnraum übereinander gestapelt wird, um als Fundament für den Fernblick weniger exklusiver Apartments zu dienen, rechtfertigt die Stadt mit der vermeintlichen sozialen Durchmischung innerhalb der Hochhäuser. Kritiker hingegen empfinden dies als blanken Zynismus und als Umverteilung der Wohnbauförderung von unten nach oben - im doppelten Sinn des Wortes. Der Freiraum zwischen den sechs Türmen entlang der Wagramer Straße sind bloße Restflächen, wo sich Kinder mangels ausreichenden Spielplatzangebots zwischen den Entlüftungsschächten der Tiefgaragen aufhalten. Innerhalb der Hochhäuser herrscht ein ebensolcher Mangel an Spielgelegenheiten, Gemeinschafts- oder Hobbyräumen. Harry Glück hatte auf den Dächern seines Wohnparks Alt Erlaa bereits vor 30 Jahren gemeinschaftliche Schwimmbäder errichtet - die Dachzonen der meisten Türme im Wohnpark an der Alten Donau sind für die Bewohner nicht einmal zugänglich.
Tiefpunkt Hochhausviertel
Bezeichnend für die Qualität heutiger Projekte ist, dass mit Alt Erlaa eine Großwohnanlage aus den 70er Jahren nach wie vor die höchsten Wohnzufriedenheitswerte erzielt - gefolgt von zwei weiteren Objekten des Wohnbau-Veteranen Glück. Dies ergab eine Studie der Wiener Stadtplanung aus dem Jahr 2000, die durch eine Untersuchung des Bautenministeriums aus dem Jahr 2001 bestätigt wird. Demnach liegen die Großprojekte der letzten zehn Jahre in punkto Wohnzufriedenheit deutlich hinter vergleichbaren Wohnanlagen der 70er, 80er und frühen 90er Jahre. Ungeachtet dessen verkündet Wiens Wohnbaustadtrat unentwegt, dass der soziale Wohnbau immer besser werde - und bezeichnet das jüngste Hochhausviertel am Wienerberg gar als Vorzeigeprojekt, obwohl die städtebauliche Enge, die gegenseitige Beschattung der Wohntürme und die Knappheit an Freiflächen einen neuen Tiefpunkt des sozialen Wohnbaus bedeuten.
"Zweite Gründerzeit"
Der Architekt und Wohnbauforscher Kurt Leitner erkennt hinter den Projekten der letzten Jahre eine gewisse Eigendynamik: "Wiens Wohnbaupolitik orientiert sich nun seit geraumer Zeit schon am Mittelmaß. Wenn man aber anstatt nach oben ständig nach der Mitte strebt, sinkt der Durchschnitt immer weiter ab - das heißt, die Wohnungsqualität wird tendenziell schlechter." Als die Wiener Stadtregierung Anfang der 1990er Jahre unter dem Eindruck der Ostöffnung eine "Zweite Gründerzeit" ankündigte, klang das nach einer Verheißung. Aus heutiger Sicht wirkt dies mehr als Prophezeiung eines wohnbaupolitischen Rückfalls hinter so manche Errungenschaft des Roten Wien.
Der Autor ist Stadtplaner, Filmemacher und Fachpublizist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!