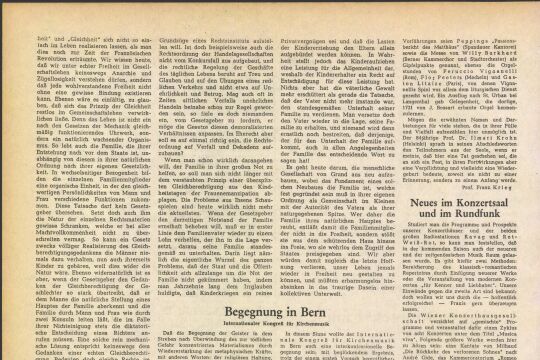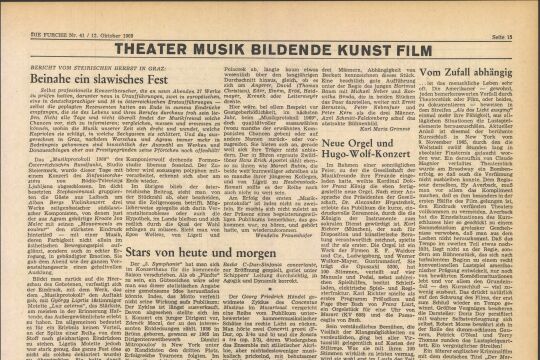Der Komponist Franz Schmidt (1874–1939) bewegt wieder Gemüter und Wissenschafter: Anlässlich der jüngsten Aufführungen seines „Buchs mit sieben Siegeln“ in Wien wurde erneut thematisiert, inwieweit Schmidt ein Sympathisant des NS-Regimes war. Aber auch eine geplante Neuinszenierung seiner Oper „Notre Dame“ in Dresden wirft Fragen auf.
„Geschichte einer ungewöhnlichen Familie“ ist der Untertitel des 2007 in London, im Vorjahr auf Deutsch erschienenen Buches von Alexander Waugh über die Familie Wittgenstein. Der Vater, Karl, einer der einflussreichsten Stahlmagnaten, in dessen Haus Brahms, Mahler und Strauss zu den regelmäßigen Gästen zählten. Die Kinder hochbegabt, aber unterschiedlich in der Lage, ihr Leben zu meistern. Drei der fünf Söhne endeten durch Selbstmord. Ludwig wurde als Philosoph weltberühmt, sein um zwei Jahre älterer Bruder Paul als Pianist. Allerdings erst, nachdem ihn ein verheerender Schicksalsschlag getroffen hatte: Bei Kämpfen in Galizien verlor er im August 1914 den rechten Arm. Normalerweise das Ende der Karriere. Nicht so bei Paul.
Paul Wittgensteins linke Hand
Mit eisernem Willen begann er seine linke Hand zu trainieren. Zuerst im Lazarett, wo er auf einer Kohlenkiste die Klaviertasten zeichnete, bald schon auf dem Klavier. Er vertiefte sich in die vorhandene Klavierliteratur für die linke Hand. Später gab er zahlreiche Werke in Auftrag. Unter anderem an Prokofjew, Hindemith (die er nie spielte) und Ravel, dessen D-Dur-Konzert er gegen den Willen des Komponisten zugunsten solistischer Brillanz veränderte. Besonders gern spielte er die für ihn maßgeschneiderten Stücke von Franz Schmidt, selbst nicht nur ein ausgezeichneter Cellist, sondern auch Pianist.
„Spätromantiker, aber nicht Epigone“ betitelte Norbert Tschulik das erste Kapitel seiner 1972 erschienenen Schmidt-Monografie. Zuvor hatten bereits Andreas Liess und der spätere Grazer Operndirektor Carl Nemeth Schmidt-Biografien herausgebracht. Durch Nemeths Standardwerk wurde auch der in Graz studierende Fabio Luisi auf Schmidt aufmerksam. Heute zählt der Wiener-Symphoniker-Chef und Generalmusikdirektor der Dresdner Semper-Oper zu den glühendsten Schmidt-Aposteln. Er hat dessen Symphonien, die Klavierkonzerte und „Das Buch mit sieben Siegeln“ – Schmidts Vertonung der Apokalypse – eingespielt, setzt sich im Konzertsaal und in der Oper immer wieder für Schmidts Schaffen ein.
Als er 2004 beim Concertgebouw Orchester im Amsterdam debütierte, hatte er die vierte Symphonie auf dem Programm. Am 24. und 25. März führt er im Musikverein mit den Wiener Symphonikern die Zweite auf. Für 2012 ist unter Luisi im „Goldenen Saal“ eine Aufführung des „Buchs“ geplant.
Vergangenen Dezember feierte damit Nikolaus Harnoncourt mit den Wiener Philharmonikern, dem Singverein und erlesenen Solisten im Musikverein seinen 80. Geburtstag. Nicht ohne Begleitmusik. Ein Zuhörer monierte, dass dies eine Gelegenheit gewesen wäre, auf Schmidts Nazi-Vergangenheit hinzuweisen. Seine letzte, unvollendet gebliebene Komposition, die Kantate „Deutsche Auferstehung“, und seine Äußerung gegenüber dem Naziregime, „Ich bitte den Allmächtigen, er möge mir die rechte Kraft geben, den Dank, den Jubel und den Glücksrausch eines ganzen Volkes in einem großen Tonsatz gestalten zu vermögen!“, werden dafür stets als Beleg angeführt.
Bis heute liegen die Umstände, die Schmidt zur Komposition dieser Kantate geführt haben, nicht klar zutage. Wollte er damit nur seinem Freund, dem exzellenten Organisten Franz Schütz, den die Nationalsozialisten zum Präsidenten der Gesellschaft der Musikfreunde gemacht hatten, einen Gefallen tun und ihm ein für die Musikvereinsorgel entsprechend effektvolles Werk schreiben? Waren es Herren der Wiener Gauleitung, die bei zwei Besuchen Schmidt zu diesem Werk zwangen? Wurde Schmidt damit wider Willen zu einem Regime-Sympathisanten gemacht? Wie freiwillig war die Auseinandersetzung mit diesem Sujet vor dem Hintergrund vor Schmidts dramatischen gesundheitlichen Problemen, die wenig später, im Februar 1939, zu seinem Tod führten? Wollte er so von seinem unehelichen Sohn aus einer Beziehung mit einer Jüdin ablenken?
Erstaufführung an der Semper-Oper?
Wie stets, wenn Politik und Kunst zusammentreffen: Was auf den ersten Blick eindeutig erscheint, erweist sich bei einem weiteren nicht selten als ungewohnt vielschichtig. Nicht nur hier: Auch Aufführungsdaten soll man nicht ohne Weiteres glauben. Für 18. April hat Fabio Luisi an der Desdner Oper eine Neuinszenierung von Franz Schmidts Zweiakter „Notre Dame“ angesetzt. Eine Erstaufführung? Nicht wenn man so mancher Sekundärliteratur glauben darf. Selbst in „Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters“ liest man, dass „Notre Dame“ 1916 erstmals in Dresden aufgeführt wurde. Dokumente, die dies belegen, wie Aufführungszettel oder Zeitungsberichte, fehlen aber. Ist eine Briefstelle Schmidts an seine Mutter Beleg genug? Spannend, was man dazu im Programmheft der Dresdner Premiere wird lesen können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!