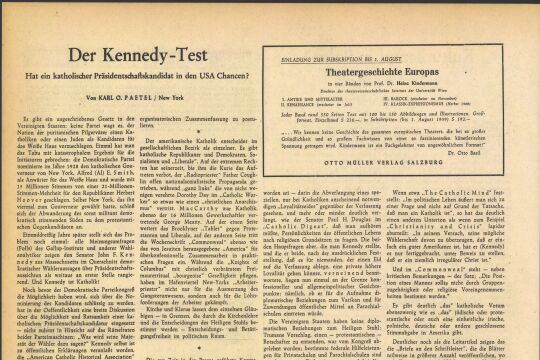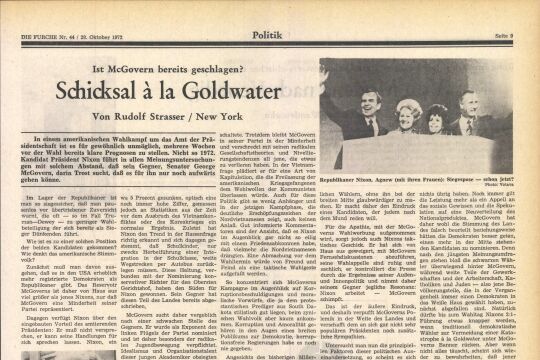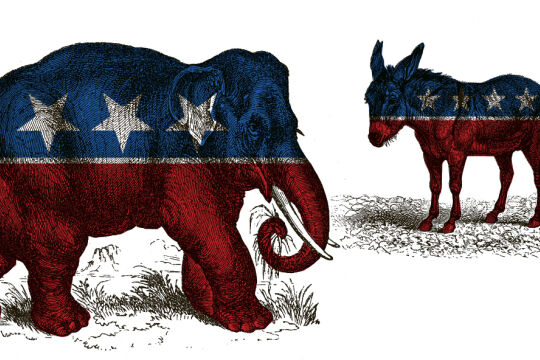Was Washington macht, ist belanglos - US-Politik am Scheideweg
Die Wahlen in den Vereinigten Staaten zeigten, dass die Frage nach der Grenze zwischen individueller und gemeinschaftlicher Verantwortung immer noch Kern der politischen Auseinandersetzung ist. Und diese Frage wird auch im 21. Jahrhundert die politische Auseinandersetzung bestimmen.
Die Wahlen in den Vereinigten Staaten zeigten, dass die Frage nach der Grenze zwischen individueller und gemeinschaftlicher Verantwortung immer noch Kern der politischen Auseinandersetzung ist. Und diese Frage wird auch im 21. Jahrhundert die politische Auseinandersetzung bestimmen.
Als sich im späten Sommer dieses Jahres der amerikanische Vizepräsident Al Gore und der texanische Gouverneur George W. Bush mit viel Energie in die Schlacht ums Weiße Haus warfen, ahnten nur wenige, dass das Ergebnis eine der hartumkämpftesten Kampagnen und eines der knappsten Ergebnisse der letzten fünfzig Jahre sein würde. Zu groß schienen Gores Vorteile zu sein: allen voran eine florierende Wirtschaft, Vollbeschäftigung mit anhaltender geringer Inflation und immer neuen Rekorden auf den Aktienmärkten. Darüber hinaus wurde Bush allgemein als nett, charmant und umgänglich, aber intellektuell doch als eher unterbemittelt und deshalb für das höchste politische Amt in den Vereinigten Staaten als nur äußerst bedingt geeignet beurteilt.
Am Ende kam es jedoch ganz anders. Im Laufe des Wahlkampfes geriet Al Gore immer mehr in Bedrängnis und konnte am Ende nicht einmal sicher sein, in seinem Heimatstaat Tennessee als Sieger hervorzugehen. In den letzten Wochen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab, so dass bis in die letzten Tage vor dem Wahltermin es keiner der zahlreichen Experten wagte, den Ausgang der Wahlen vorherzusagen. Einige Beobachter gingen sogar so weit, nicht auszuschließen, dass einer der beiden Kandidaten (Bush) zwar die Mehrheit der Stimmen erringen könnte, der andere (Gore) jedoch die Mehrheit der 538 Stimmen des Electoral Colleges oder sogar, dass keiner der beiden Kandidaten eine Mehrheit im Electoral College auf sich vereinen könnte. Damit würde die Entscheidung dem neukonstituierten Repräsentantenhaus zufallen. Damit einher ging die Befürchtung, dass dies eine ernsthafte Legitimationskrise hervorrufen könnte. Spannung war in jedem Fall vorausgesagt.
Internet kam erstmals voll zum Einsatz Trotz aller Ungewissheit um den Ausgang und trotz aller Versuche beider Kandidaten, die Wähler zu mobilisieren, war das Interesse der Bevölkerung eher verhalten. Schon vor dem Ende der Kampagne galt es als wahrscheinlich, dass diese Wahlen einen neuen Minusrekord in der Wahlbeteiligung - vor allem bei jüngeren Wählern - bringen würden.
Das liegt sicherlich nicht an mangelnder Information über die beiden Kandidaten oder ihre programmatischen Vorstellungen. Dies waren die ersten Präsidentschaftswahlen, bei denen das Internet voll zum Tragen kam. Dem interessierten Konsumenten erschloss es eine schier unerschöpfliche Anzahl von Informationsquellen mit Analysen und interaktiven Partizipationsmöglichkeiten, die die Unterschiede zwischen den Kandidaten bis ins Detail erhellten und von allen Seiten beleuchteten. Gerade diese Wahlen zeigten, dass das Internet das Potential dazu hat, einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der Demokratie zu leisten.
Es lag sicherlich nicht daran, dass die beiden Kandidaten kein programmatisches Profil aufwiesen. Im Gegenteil. Eine der vielleicht erstaunlichsten Tatsachen bei diesen Wahlen war, dass den Wählern eine echte, klar abgegrenzte Alternative geboten wurde. Es hat schließlich auch nichts damit zu tun, dass die Amerikaner heute noch politikverdrossener wären als sie es ohnehin bereits seit Jahrzehnten sind. Zwar trugen weder Clintons persönliche Eskapaden noch das aggressive Verhalten der republikanischen Mehrheit im Kongress etwas dazu bei, das Vertrauen der Bevölkerung in seine Vertreter nachhaltig zu stärken; doch gibt es seit einiger Zeit Anzeichen eines etwas positiveren Trends in der öffentlichen Meinung was Washington betrifft.
Der tiefere Grund liegt darin, dass Politik in der öffentlichen Wahrnehmung ihren Stellenwert verloren hat; zum einen, weil Politik in der heutigen Unterhaltungsgesellschaft mehr denn je Teil des Spektakels geworden ist und somit um mediale Marktanteile kämpfen muss. Und da schneidet die Politik nicht immer besonders gut ab; zum anderen, weil, wie Josef Joffe kürzlich treffend bemerkte, "die Gesellschaft lernt, für sich selbst zu sorgen." Politik, und hier vor allem nationale Politik (im Gegensatz zu regionaler und kommunaler Politik) wird von immer mehr Menschen als nicht nur wenig unterhaltsam, sondern vor allem als irrelevant für die unmittelbaren eigenen Lebensumstände erachtet. Das Ergebnis ist eher gelangweilte Indifferenz als Misstrauen gegenüber Politik und der politischen Klasse. Umfragen bestätigen diesen Trend. So meinten im letzten Jahr in einer vom angesehenen Pew Research Center for the People and the Press in Washington durchgeführten Erhebung fast 60 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, was in Washington geschieht, sei einfach langweilig; und fast 40 Prozent meinten, was dort verhandelt wird, sei für sie persönlich weitgehend belanglos.
Zweifellos hat die Erfahrung anhaltender Prosperität seit Mitte der neunziger Jahre dazu beigetragen, diese Einstellung weiter zu verfestigen. Zum Teil hat es wohl mit Clintons Strategie zu tun, die eher im Verborgenen den Erfolg suchte und somit weit weniger publicityträchtig war als eine Strategie, die auf den großen Wurf angelegt gewesen wäre (wie dies die gescheiterte Gesundheitsreform am Anfang der Clinton-Ära war). Damit machte sich der Eindruck breit, die Wirtschaft gehorche einem Selbstlaufmechanismus, den es am besten nicht zu stören gilt. Dies mag ein Grund dafür sein, warum zwar die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung - einschließlich derer, die ihn aufgrund seiner moralischen Verfehlungen zutiefst verabscheuen - Bill Clinton für das Wirtschaftswunder der letzten Jahre Kredit einräumt, dabei aber oft nicht genau sagen kann, worin sein Verdienst eigentlich genau besteht; außer vielleicht, dem Chef der Amerikanischen Notenbank, Alan Greenspan, nicht ins Handwerk gepfuscht zu haben.
Apathie und Indifferenz könnten sich jedoch sehr schnell als fatal erweisen, spätestens dann, wenn der Wirtschaftsaufschwung an Schwung verliert und die Euphorie um die New Economy einer neuen Ernüchterung Platz macht. Denn Politik macht trotz fehlender Akzeptanz in der Öffentlichkeit auch im Zeitalter von Globalisierung, postmoderner Mediakratie und Freizeit- und Unterhaltungsgesellschaft einen Unterschied. "Politics matters" - auch in den USA.
Zentrale Frage: mehr oder weniger Staat?
Davon bemerkte man während der Auseinandersetzung zwischen Bush und Gore wenig. Trotz klarer und zum Teil diametral entgegengesetzter Vorstellungen in fast allen relevanten Politikfeldern war der Wahlkampf weniger von Positionen (issues) als von der Persönlichkeit der Kandidaten bestimmt. Dabei ging es vor allem um die Frage der Authentizität, und da schnitt der oft hölzern und von außen gesteuert wirkende Al Gore mehr schlecht als recht ab. Im Vergleich zu einem jovialen, charmanten und sich seiner Unzulänglichkeiten voll bewussten George W. Bush vermittelte Gore den Anschein, als wüsste er weder so recht, wer er eigentlich war, noch wer er eigentlich sein wollte. Damit ergab sich die paradoxe Situation, in der zwar eine Mehrheit der registrierten Wähler in Sachfragen in den meisten Fällen eher mit Gore als Bush übereinstimmte, Bush aufgrund seiner umgänglichen Persönlichkeit jedoch in den meisten Umfragen die Nase leicht vorne hatte.
Es wird immer sehr schnell vergessen, dass es sogar im Medienzeitalter nach wie vor um politische Inhalte geht. Und diese Wahlen waren diesbezüglich keine Ausnahme. Alle Umfragen belegten, dass die amerikanische Bevölkerung ein ziemlich klares Problembewusstsein hat, und das trotz Prosperität und Vollbeschäftigung. Prioritäten waren zum einen die Sicherung des Rentensystems für zukünftige Generationen sowie Verbesserungen im Gesundheitswesen und vor allem die Versorgung von Rentner mit erschwinglichen Medikamenten; zum anderen die Forderung nach einer tiefgreifenden Reform des zum Teil maroden Bildungswesens, vor allem was Grundschulen und High-Schools betrifft.
All diese Problemfelder sind zweifellos von hervorragender Bedeutung für die Zukunft der amerikanischen Bevölkerung. Ihre Lösung ist - vor allem im Bildungswesen - von absoluter Dringlichkeit, wollen die Vereinigten Staaten von Amerika auch weiterhin im globalen Wettbewerb bestehen. Und zusammen ergeben diese Problemfelder die Konturen eines umfassenden Projekts, das durchaus in der Lage sein könnte, generationsübergreifend zu wirken, einen gewissen Ausgleich zwischen Jung und Alt zu leisten, und damit einen potentiellen Konfliktherd zu bändigen, der auch in den Vereinigten Staaten in Zukunft virulent werden könnte. Zum anderen wäre dieses Projekt zumindest im Ansatz angetan, den Ausbau des amerikanischen Sozialstaats voranzutreiben und damit auch auf diesem Gebiet mit den europäischen Konkurrenten gleichzuziehen.
Ob und inwieweit dies in den nächsten Jahren geschehen wird, hängt vom Ausgang dieser Wahlen ab, bei denen es trotz aller Diskussionen über die persönlichen Mängel der beiden Kandidaten vor allem um grundverschiedene Gesellschaftsentwürfe gegangen ist. Dies wurde deutlich, als George W. Bush am Ende der dritten Fernsehdebatte fragte: "Who do you trust, the government or the people?" Nur auf diesem Hintergrund werden Bushs Vorstellungen und Pläne zur Steuer- und Rentenpolitik verständlich, die darauf abzielen, die Individualisierung voranzutreiben. Damit würde der Staat wieder einer seiner tragenden Rollen beraubt. Sollte sich dagegen Al Gore behaupten, wird der Staat weiterhin eine zentrale Rolle im Leben eines jeden Amerikaners spielen, ob er oder sie das will oder nicht.
Gerade die diesjährigen Wahlen haben unter anderem wieder einmal gezeigt, dass die Frage nach der Grenze zwischen individueller und gemeinschaftlicher Verantwortung immer noch der Kern der politischen Auseinandersetzung ist, und dass diese Frage auch im 21. Jahrhundert die politische Auseinandersetzung bestimmen wird. Wie so oft werden die Vereinigten Staaten hier eine Vorreiterrolle spielen, in welche Richtung die Entwicklung auch gehen mag. Gerade aus diesem Grund hätten gerade diese Wahlen ein Mehr an ernsthafter Aufmerksamkeit verdient.
Der Autor ist Professor für Political Science am Centre for German and European Studies York University, Toronto, Canada.