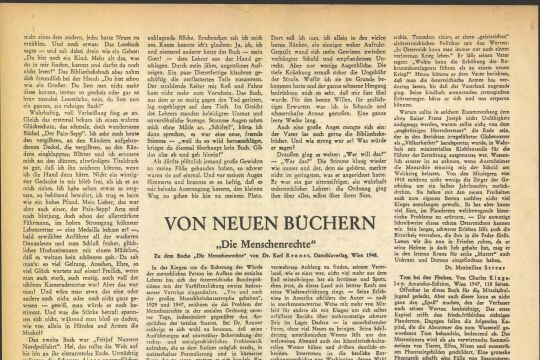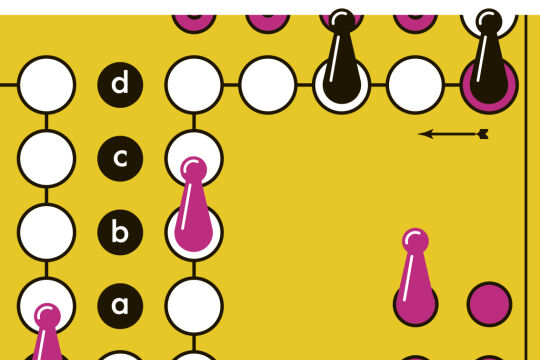Ehemalige Linke sind im Establishment angekommen, schreiben die Geschichte um und verkünden ihre neuen Gewissheiten.
In seiner Jugend näherte sich Willi Hemetsberger, heute Vorstandsdirektor der BA-CA, "ganz in der Tradition von Marie Jahoda und ihrer Studien über die Arbeitslosen von Marienthal den Entrechteten in den Gemeindebauten". Was wäre daran falsch? Was war gar falsch an der Tradition einer Marie Jahoda, an die sich die österreichische Sozialdemokratie irgendwie blasser erinnert als an den wendigen Karl Renner? Dass "das Proletariat" in dem ungebetenen Besucher "partout nicht den Befreier erkennen" wollte: rückt es den Versuch, die Interessen der Unterprivilegierten wahrzunehmen, ins Unrecht?
Das jedenfalls suggeriert nicht nur der selbstironisch-hochmütige Ausdruck "Entrechtete", mit denen ein Banker die in Wahrheit zwar nicht entrechteten, aber um mancherlei Rechte geprellten Bewohner von Gemeindebauten mehr als sich selbst der Lächerlichkeit preiszugeben gewillt ist, sondern gleich ein ganzer Aufsatzband mit dem schillernden Titel Die Fantasie und die Macht und dem Untertitel 1968 und danach. Da sie 1968 die Fantasie nicht an die Macht bringen konnten, haben sich einige von der undankbaren Geschichte bitter Enttäuschte entschlossen, lieber mit der Macht zu paktieren.
Was war falsch?
Elizabeth T. Spira beendet ihren autobiografischen Beitrag mit dem lakonischen Satz: "Ich bin eine Geburtslinke ohne Parteilokal." Falsche Bescheidenheit. Auch Elizabeth T. Spira hat das Linke nicht in den Genen. Ihre heutige Position beschreibt sie so: "Ich bin Realpessimistin geworden." Dafür gibt es doch gute Gründe. Welche aufrechte Linke, welcher aufrechte Linke könnte in der Welt, wie sie sich heute präsentiert, noch Optimist sein? Es sind nicht die Gene, es ist noch nicht einmal allein die Sozialisation, was Spira und andere zu Linken und zu Pessimisten gemacht hat. Es sind Erkenntnisse. Dafür braucht man sich nicht zu schämen. Die muss man nicht auf den Müll kippen wie Schuhe, die aus der Mode geraten sind.
In seinem poetisch-politischen Essay erklärt Robert Schindel die Siebzigerjahre zum "womöglich dümmsten Jahrzehnt des Zwanzigsten Jahrhunderts". Schon zuvor hatte er in der Österreichausgabe der Zeit die einstige Solidarisierung mit den unterdrückten Völkern der Dritten Welt inklusive dem palästinensischen zu den größten Dummheiten der Linken gezählt. Was dem einen die Bewohner der Gemeindebauten, waren und sind dem anderen die Völker der Dritten Welt inklusive der Palästinenser. Robert Schindel liebt offenbar den Superlativ. Die Siebzigerjahre - dümmer als die zehner oder die dreißiger Jahre, in denen man sich zum Krieg wappnete und nationalistische oder rassistische Parolen nachbrüllte? Die Solidarisierung mit den unterdrückten Völkern der Dritten Welt inklusive des palästinensischen - eine größere Dummheit als die Absage an die "bürgerliche Kultur", als die bedingungslose Verklärung der Sowjetunion?
Öffentliche Selbstkritik, wenngleich eine stalinistische Gepflogenheit, die in der Regel bedeutend unangenehmere Folgen hatte als anerkennendes Schulterklopfen und ein Autorenhonorar - schön und gut. Aber was berechtigt eigentlich dazu, im Plural zu sprechen und für die eigenen Dummheiten eine ganze Generation in Haft zu nehmen? Sinnvoller wäre es, heute Dummheiten zu vermeiden und jene kritisch zu betrachten, mit denen man sich wirklich verbunden fühlt. Mit großem Pathos hat Schindel verkündet, er werde nicht zulassen, dass man Nennings "Kind" - er meinte damit den "Austrokoffer" - umbringen werde, aber er findet keine Worte der Verteidigung für jene libanesischen Kinder, die ganz unmetaphorisch von "seinen Leuten" umgebracht werden. Eine flächendeckende Bombardierung im Libanon rechtfertigt Robert Schindel im erwähnten Beitrag für Die Zeit damit, dass das Volk Führer dulde, die ihre militärische Infrastruktur inmitten der Zivilbevölkerung verstecken. Für RbertSchindel wollen die Führer der Palästinenser die anderen - Israel - vernichten, "die anderen wollen bloß in sicheren Grenzen leben".
Schindel und "seine Leute"
Die Zahlen der Opfer auf beiden Seiten sprechen für eine andere Asymmetrie. Aber Robert Schindel plädiert gar nicht für Symmetrie. Er hat sich entschieden: für "meine Leute". Pech für jene, die nicht dazu gehören. Man kann nur hoffen, dass Robert Schindel, der nicht mehr eine verfrühte Jugend für sich in Anspruch nehmen kann, alt genug wird, die tatsächlichen Dummheiten von heute zu korrigieren. Im Übrigen repräsentiert Schindel ein Paradigma, das sich bei zahlreichen jüdischen Linken (oder linken Juden) beobachten lässt: die kognitive Dissonanz, die doppelte Loyalität, der sie sich - insbesondere angesichts der sowjetischen Politik gegenüber Israel - ausgesetzt sahen, haben sie zugunsten des Judenstaats aufgelöst. Sie haben sich von der antizionistischen Linken verabschiedet. Wie sehr ihre (nahezu) bedingungslose Verteidigung der israelischen Politik ihrer einstigen Hörigkeit gegenüber der UdSSR ähnelt, scheinen sie nicht zu bemerken.
Die Schizophrenie der Renegaten ist konstitutiv. Da schreibt der bereits zitierte Hemetsberger (naturgemäß: mit dem Gestus des Rechthabers): "Wer genau weiß, dass er Recht hat, für den sind alle jene, die Unrecht haben, verzichtbare Größen." Drei Seiten weiter notiert derselbe Autor: "Eigentum erhöht die Sicherheit und wird deswegen zu mehr Wachstum führen." Spricht so einer, der die Möglichkeit des Irrtums einkalkuliert?
Das ist die Methode der im Establishment Angekommenen: Sie erklären ihre früheren Gewissheiten zur verabscheuungswürdigen Rechthaberei und predigen ihre heutigen Gewissheiten, wie sie denn auch die Rechthaberei derer, die diese Gewissheiten immer schon geteilt haben, ausblenden. Glaubten etwa die Stützen des Systems, glaubten die Kirchenvertreter, die CVer, die Burschenschafter vom RFS, die schon unter Kreisky Karriere machen durften, weniger als die 68er, dass sie Recht hatten? Haben sie nicht, wo sie konnten, auf ihre Gegner verzichtet? Tun sie es nicht nach wie vor - unter Mithilfe der Renegaten, die sich ihnen zugesellt haben? Wie viele Linke, die den Idealen von 68 treu geblieben sind, hat man in den Medien, den akademischen Institutionen, den Leitungsetagen der Wirtschaft, den Vorständen der Banken aufgenommen?
Mit der zunehmenden Dreistigkeit, mit der greise Nazis und Austrofaschisten sich selbst und vor allem deren Töchter und Söhne ihre früher oft skeptisch beäugten Eltern von jeglicher Schuld freisprechen, korrespondiert ein penetranter Waschzwang unter einstmals Linken. Das muss objektive Gründe haben. Die Geschichte wird umgeschrieben. Der Zusammenbruch des Sowjetimperiums, der Kollaps der maoistischen Illusion, die gescheiterten Reformen der 68er und einer längst diesseits der christlichen Sozialethik gestrandeten Sozialdemokratie scheinen den endgültigen Sieg des Kapitalismus besiegelt zu haben.
Sieg des Kapitalismus
Das Wünschenswerte wird mit dem Faktischen in Übereinstimmung gebracht. Da möchte man nicht auf der Verliererseite stehen. Da möchte man ein paar Krümel abbekommen vom Tisch der Reichen. Da liefert man ihnen frei Haus die Geständnisse, die diese längst zu erpressen versucht haben, mal reumütig, mal ironisch, mal kleinlaut, mal salbungsvoll, stets aber jenen gegenüber, die dieses Ritual nicht mitmachen, mit der überheblichen Geste dessen, der seinen Opportunismus als Lernfähigkeit camoufliert.
Hat auch nur eine, hat auch nur einer von den angeblich Einsichtigen für seine öffentliche Beichte Nachteile erfahren? Das, immerhin, wäre ein Glaubwürdigkeitsindiz. Lothar Baier, der, älter werdend, den umgekehrten Weg, immer weiter nach links ging, hat sich umgebracht. Über den Vater eines der Aufsatzschreiber, über Georg Hoffmann-Ostenhofs Vater kursiert eine Anekdote, wonach der überzeugte Sozialdemokrat auf den Rat seines vorgesetzten Professors an der Universität, sich an ihm ein Beispiel zu nehmen und, da er nicht mehr ganz jugendlich sei, der ÖVP beizutreten, geantwortet habe: "Nein, Herr Professor, wenn ich alt bin, möchte ich gütig und weise sein." Es hat seiner Karriere wahrscheinlich nicht genützt. Aber die nachfolgende Generation könnte sich diese Haltung tatsächlich zum Beispiel nehmen.
Den entscheidenden Satz formuliert, wenn auch mit zweimaligem falschem Dativ, Peter Kreisky ganz hinten im Buch: "Der Bedarf an einer ,Neuen Linken' ist heute - in Zeiten neoliberaler Globalisierung, den maßlos agierenden USA, einer um sich greifenden weiteren Relativierung der Menschenwürde und dem existentiell wirksam werdenden Verteilungskampf um die letzten fossilen Energie-und anderen natürlichen Ressourcen - mindestens so gegeben wie vor 40 Jahren." Was wäre daran falsch?
Der Autor ist Literaturwissenschaftler an der Uni Stuttgart.
Die Fantasie und die Macht
1968 und danach Hg. v. Raimund Löw. Czernin Verlag, Wien 2006, 385 S. geb., e 23,50
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!