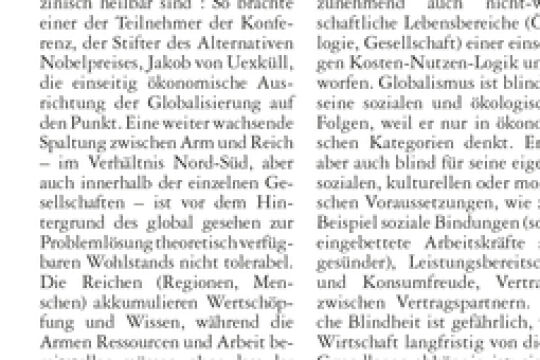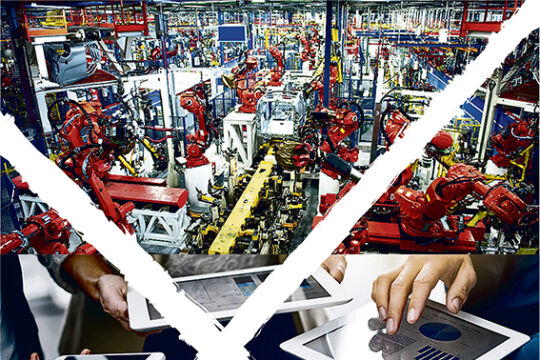Wissen fällt nicht vom Himmel: Immer ist es Teil von kulturellen und gesellschaftlichen Systemen, und damit gleichzeitig Ursache und Folge von einer bestimmten Arbeitsteilung, von Machtkonstellationen, Wirtschaft, Geschlechterbeziehung, dem Umgang mit Technologien und erkenntnistheoretischen Vorstellungen. Wissen dient dem Verständnis unseres Lebens und dessen vielfältigen Rahmenbedingungen. Es rationalisiert und strukturiert unsere Erfahrungen, erweitert die Räume unseres Denkens und Handelns. Auch, wenn kanonisierte Wissensbestände oft glauben machen wollen, dass sie über Zeit und Raum hinweg Gültigkeit erlangt haben: Wissen ist niemals statisch.
Das betrifft auch das Wissen, das Entwicklungszusammenarbeit definiert. Seit Beginn der industriellen Revolution wurde Entwicklung als stete exponentielle Steigerung des Wachstums, der Produktivität und des energetischen Grundumsatzes auf Basis fossiler Energien verstanden.
Grandioser Reichtum für ein Fünftel
Daraus resultierte ein grandioser gesellschaftlicher Reichtum, an dem heute ein Fünftel der Weltbevölkerung partizipiert, und der in den OECD-Ländern eine noch vor einhundert Jahren schier unglaubliche Verlängerung der Lebenserwartung bedingt hat. Ein Reichtum aber auch, der zu gewaltigen industriellen Kollateralschäden geführt hat, derer wir uns erst allmählich bewusst werden. Dem gesellschaftlichen Luxus des Überflusses steht die reale Gefahr des Klimawandels gegenüber, der noch in diesem Jahrhundert riesige Flächen unbewohnbar machen und zu extremen sozialen Verwerfungen auf globaler Ebene führen könnte.
Nicht zuletzt aufgrund dieser möglichen Szenarien und aufgrund unseres Wissens über die Verwundbarkeit unseres Planeten hat sich ein rigoroser Wandel des Begriffes und des Verständnisses von Entwicklung - allmählich auch von Entwicklungspolitik - angebahnt.
In den letzten Dekaden war Entwicklungszusammenarbeit durch ein Wissen bestimmt, das die Welt in Kategorien von Nord und Süd, Arm und Reich, Zentrum und Peripherie, Geber und Nehmer, oder industrialisiert und agrarwirtschaftend geteilt hat. Dieser Kategorisierung folgten auch die Vorgaben der UN-Milleniumsziele, die seit der Jahrtausendwende die entwicklungspolitische Diskussion maßgeblich bestimmt haben. Ihre quantitativen Indikatoren gaben empirisch messbare Ziele an, die durch fokussierte Investition der weltweiten Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit erreicht werden sollten -und auch teilweise erreicht wurden.
Das Verhältnis zwischen Geber und Nehmer war - und ist auch teilweise heute noch - paternalistisch charakterisiert. Der Armut, die einseitig durch "Bedürftigkeit" definiert wird, steht eine entwicklungspolitische Expertokratie gegenüber, die nicht selten nach dem Motto "Wir haben die Lösung, wo ist euer Problem" agiert. Durch einseitige ökonomische und politische Interessen, sowie durch Konditionalitäten bei der Mittelvergabe werden Problemlösungskompetenzen, die auf lokalem Wissen aufbauen, nicht nur nicht mitgedacht, sondern oft von vornherein im Keim erstickt.
Zudem musste die große Erzählung von der Armutsbekämpfung an ihrer eigenen ambitiösen Zielsetzung aufgrund der bescheidenen Mittel, die zu ihrer Durchsetzung aufgewendet wurden, scheitern. Denn eine weltweit staatliche Entwicklungsleistung von rund 140 Milliarden Dollar stellt kein adäquates Potential dar, womit sich globale Armut effektiv -in einem makroökonomisch und volkswirtschaftlich relevanten Sinn -bekämpfen lässt.
Spätestens seit dem Weltgipfel in Rio 1992 hat sich vorerst im entwicklungspolitischen, dann auch im transnationalen Diskurs eine Revision des Begriffs Entwicklung abgezeichnet, die auf einer anderen Wahrnehmung von Welt und auf neuen Wissensbeständen beruht.
Veränderte Wahrnehmung der Welt
Schon damals stand fest, dass sich ökologische Probleme ohne einen weltweiten sozialen Interessensausgleich nicht lösen lassen werden. Auch wenn für viele NGOs die Ergebnisse von Rio+20 unbefriedigend waren und die Green Economy gleichsam als allmächtige Wunderwaffe aus dem Sack der allgemeinen Ratlosigkeit gezogen wurde, haben die Diskussionen über die Nachhaltigen Entwicklungsziele, die die Milleniumsziele als Zielvorgabe ab Ende 2015 ablösen werden, doch wesentliche paradigmatische Veränderungen im entwicklungspolitischen Diskurs eingeleitet.
Heute wird von Entwicklung als Ermöglichung menschenadäquater, nachhaltiger Lebensräume gesprochen, die so gestaltet sind, dass unsere Kinder und Kindeskinder zumindest nicht weniger Lebensverwirklichungsmöglichkeiten vorfinden als wir. Durch die Zielsetzungen der Nachhaltigen Entwicklungsziele -die im Detail noch zu formulieren sind -werden alle Nationen der Welt gleichermaßen angesprochen, wodurch sich eine gemeinsame globale Verantwortung für die Zukunft der Menschheit ableiten und begründen lässt. Es geht nicht mehr um die Teilung der Welt in Geber und Nehmer, sondern um das Erkennen der eigenen individuellen, gesellschaftlichen, nationalen und schließlich transnationalen Rolle für die Förderung zukunftsfähiger Entwicklungen und die daraus ableitbaren politischen, ökologischen, sozialen, ökonomischen, rechtlichen und technologischen Implikationen.
Für die Entwicklungszusammenarbeit wird dieser Paradigmenwechsel weitreichende Folgen haben. Wir werden unsere Leistungen für eine sozial gerechtere Welt - als Voraussetzung der Lösung dringlichster ökologischer Probleme - viel stärker als bisher auf unsere eigene Lebensrealität rückbeziehen müssen. Wir können nicht mehr sagen: "Wir geben einen Teil unseres Reichtums ab -und damit hat es sich." Ganz im Gegenteil: Gerade auch wir müssen uns bewegen und zu anderen politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen gelangen, um den Nachhaltigen Entwicklungszielen mittelfristig gerecht zu werden. Dazu gehören die Energiewende und die weltweite Armutsbekämpfung, denn diese Sphären lassen sich aufgrund des neuen Wissens nicht mehr voneinander trennen. Sie stehen in unmittelbarer Wechselwirkung zueinander. Damit endet auch die paternalistische Bevormundung der reichen Staaten gegenüber den armen. Und der entwicklungspolitische Diskurs rückt in das Zentrum unserer eigenen Lebensrealität.
Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit antizipiert -trotz budgetärer Engpässe -dieses neue Paradigma und die darin angesprochenen Realitäten, auch durch zukunftsweisende Programme. Ein Beispiel dafür: Das seit 2009 bestehende Hochschulkooperationsprogramm APPEAR basiert auf dem zentralen Leitsatz, kein Interesse an einseitigem Wissenstransfer zu haben. Genau das ist die Antwort auf eine lange Zeit praktizierte Bevormundung durch westliche Geber.
Der gelebten Realität näherbringen
In diesem Programm arbeiten Wissenschafterinnen und Wissenschafter von österreichischen Hochschulen mit Kolleginnen und Kollegen aus den Schwerpunktländern der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit zusammen. Sie suchen gemeinsam kreative, sozial, ökonomisch, kulturell und ökologisch verträgliche Lösungen für zentrale -wissenschaftlich artikulier-und empirisch überprüfbare - Probleme, und setzen sie miteinander in den betroffenen Ländern um -etwa durch die Gestaltung akademischer Curricula. Es geht um die Ermöglichung transkultureller, auch transdisziplinärer Wissensräume, die unsere gemeinsamen Vorstellungen einer nachhaltig organisierten Welt bereichern und ein stückweit der gelebten Realität näherbringen. Die damit verbundene Förderung von Kapazitäten -so ist zum Beispiel auch ein Stipendienprogramm in APPEAR integriert -und die fächerübergreifende Kooperation unterschiedlichster kultureller und sozialer Identitäten verwirklichen ein neues Verständnis von Wissen -jenseits von Macht und Übervorteilung: Eine innovative Praxis von Wissensproduktion und -anwendung, die für die Einlösung des neuen globalen Entwicklungsparadigmas von zentraler Bedeutung ist.
Der Autor ist habilitierter Soziologe und Sozial-und Kulturanthropologe. Er leitet die Kommission für Entwicklungsforschung und das APPEAR-Programm.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




















































.jpg)