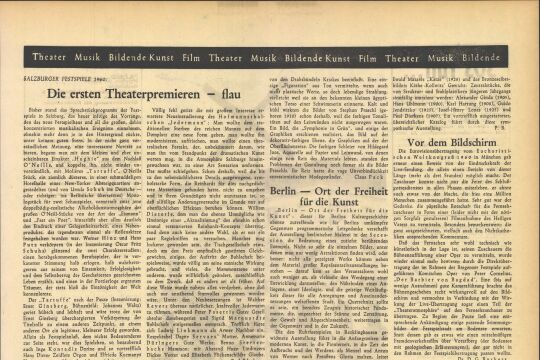Wenn die Zeit zu rasen beginnt
Keine "Jahrhundertaufführung", aber ein sehr guter - musikalisch und szenisch ungewöhnlicher - "Don Giovanni" in Salzburg.
Keine "Jahrhundertaufführung", aber ein sehr guter - musikalisch und szenisch ungewöhnlicher - "Don Giovanni" in Salzburg.
Achtung, auf der Westautobahn zwischen Salzburg und Wien befindet sich ein Geisterfahrer", tönt es aus dem Autoradio. "Einer? Dutzende!", feixt der Furche-Kritiker bei der Fahrt von den Salzburger Festspielen in den wohlverdienten Urlaub. Denn was er von Wolfgang Amadeus Mozarts "DonGiovanni" aus der Festspielstadt zu berichten hat, ist den beinhartenVerrissen seiner Kollegen diametral entgegengesetzt. Er hatte sich auf eine unsägliche Aufführung mit schwachsinnigen Regieeinfällen und voller verhatschter Tempi gefaßt gemacht, stattdessen wurde er Zeuge einer musikalisch und szenisch zwar ungewöhnlichen, jedoch sehr guten Aufführung. Freilich, eine sogenannte Jahrhundertaufführung war es nicht - aber vielleicht ist der Begriff "Jahrhundertaufführung" auch ein anachronistischer.
Lorin Maazel dirigiert extrem langsam und extra dry; so genau kann man selten in einen "Don Giovanni" hineinhören. Diese Auslegung der Partitur hat schon Wert für sich allein, obgleich irgendwelche Gralshüter auch in der zweiten Aufführung nicht mit Mißfallenskundgebungen sparten. Doch darüberhinaus war sich der Stardirigent nicht zu schade, auf das Konzept von Regisseur Luca Ronconi einzugehen, in dem die Zeit eine große Rolle spielt - daher das langsame Tempo. Ausgangspunkt der Geschichte ist gewissermaßen Salvador Dalis Gemälde "Die Beharrlichkeit der Erinnerung" mit seinen zerschmolzenen Uhren. Auf der von Margeritha Palli gestalteten Bühne liegen denn auch überdimensionale Uhren herum, allerdings nicht mehr im geschmolzenen Zustand, denn die Zeit verliert im Laufe dieses "Don Giovanni" immer mehr an Zähigkeit; immer schneller und immer schneller sprudelt sie dahin, wird digitalisiert, bis sie den Protagonisten schließlich davongaloppiert.
Die Geschichte beginnt in den zwanziger Jahren. Der maßlose Verführer Don Giovanni (Dmitri Hvorostovsky) ist ein größenwahnsinniger Beau, der im schicken Cabriolet unterwegs und schnell mit dem Springmesser zur Hand ist. Als er damit den Komtur (Robert Lloyd) ersticht, beginnt die Zeit zu laufen. Auch sein Chauffeur und Diener Leporello (Franz Hawlata) ist nicht kleinlich: als er die ehemaligen Geliebten seines Herrn aufzählt, karrt er gleich einen ganzen Eisenbahnwaggon mit Verflossenen heran. Doch in der zwischen Rachsucht und Liebe pendelnden Donna Elvira (Barbara Frittoli) erwächst Don Giovanni eine Gegenspielerin, die fortan alle seine Pläne vereiteln wird. Sie macht des Komturs Tochter Donna Anna (Karita Mattila) und ihrem biederen Verlobten Don Ottavio (Bruce Ford) klar, wer der Mörder ihres Vaters ist, und sie verhindert, daß Don Giovanni dem Mechaniker Masetto (Detlef Roth) seine Braut Zerlina (Maria Bayo) ausspannt. So wie der Inhalt einer Sanduhr kurz vor dem Ablauf immer schneller zu rieseln scheint, macht auch die Zeit in diesem "Don Giovanni" Riesenschritte. Am Schluß sind alle alt und grau, nur der Titelheld ist noch vital wie eh und je und fährt zum Hohn seiner ohnmächtigen Widersacher - Gipfel der Dekadenz - im elektrischen Rollstuhl herum. Erst als ihn der Steinerne Gast zu sich in die Hölle holt, verlassen den Lustgreis die Kräfte.
Die sängerischen Leistungen sind hochklassig, wobei die Frauen die Männer noch in die Tasche stecken. Leidenschaftlich ist Karita Mattila - ein Vulkan! -, reif und edel Barbara Frittoli, erdverbunden-lyrisch Maria Bayo. Dmitri Hvorostovsky liefert nach anfänglichem Zögern eine solide Titelpartie ab, Franz Hawlata mit seinem unverkennbaren Timbre legt den Leporello sehr buffonesk an.
Eines allerdings wäre der Aufführung fast zum Verhängnis geworden: der Aufführungsort. Das Große Festspielhaus mit seiner monströsen Bühne und der unerträglich engen Bestuhlung ist schlicht und einfach nicht geeignet für Mozarts Musik. Verloren sitzen die Wiener Philharmoniker im riesigen Orchestergraben herum, deplaziert wie ein Streichquartett in der Mehrzweckhalle von Sinabelkirchen. Eine Mozart-Besetzung vermag den riesigen Raum klanglich nicht zu füllen, vor allem das Cembalo klingt, als ob es sich sehr, sehr einsam in der großen Welt fühlte. Doch läßt man sich von der Aufführung mitreißen und ist man vom Sog der Ereignisse gefangen, vermag man diesen höchst ungünstigen Umstand zu vergessen. Des Kritikers Empfehlung: einfach loslassen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!