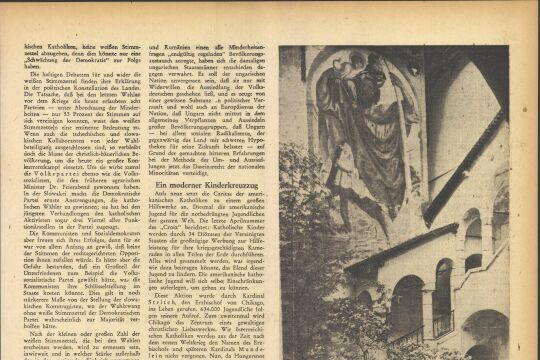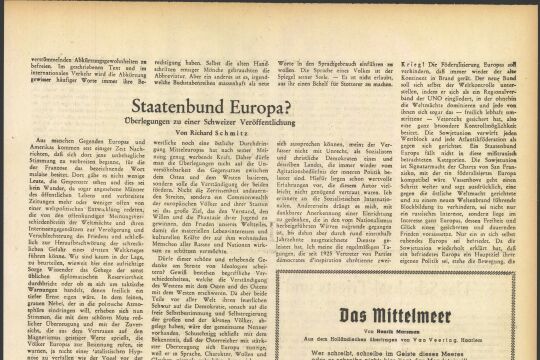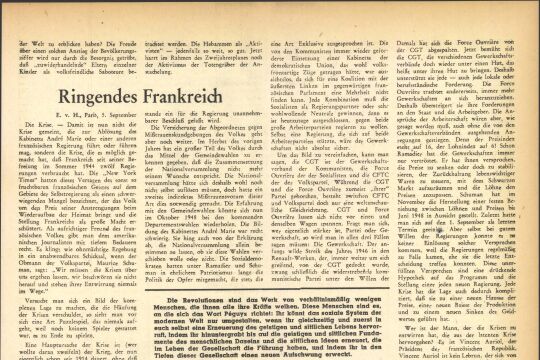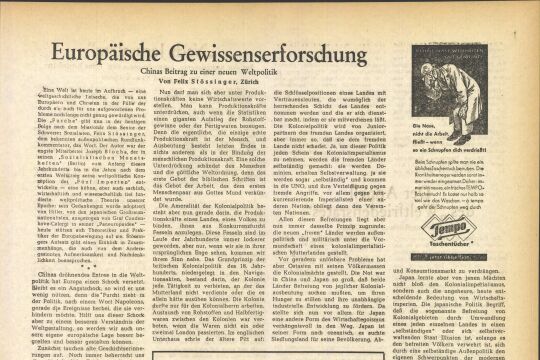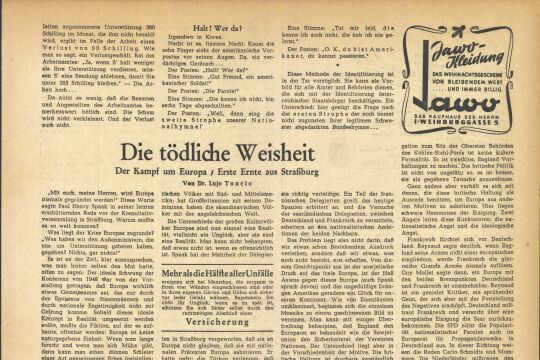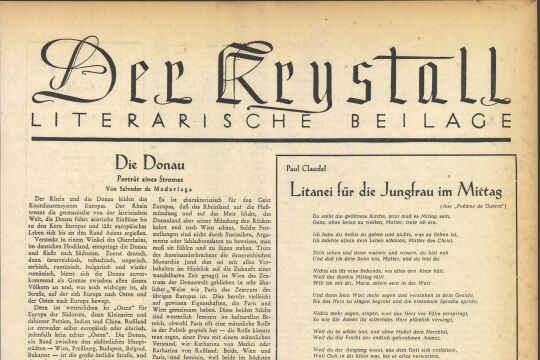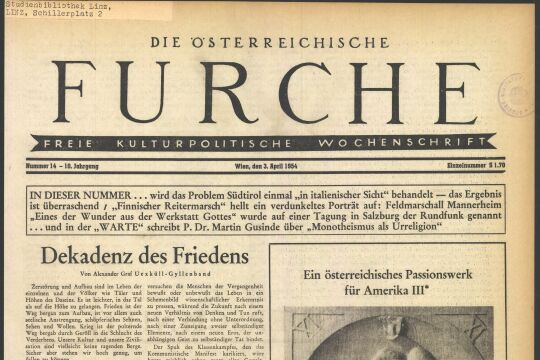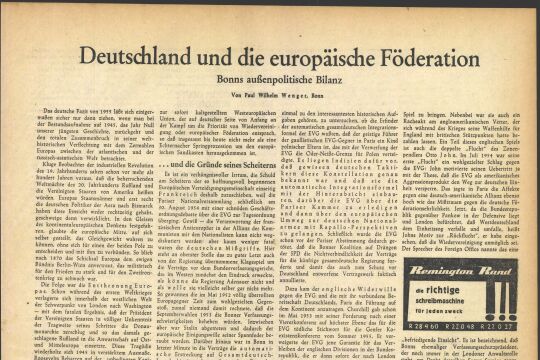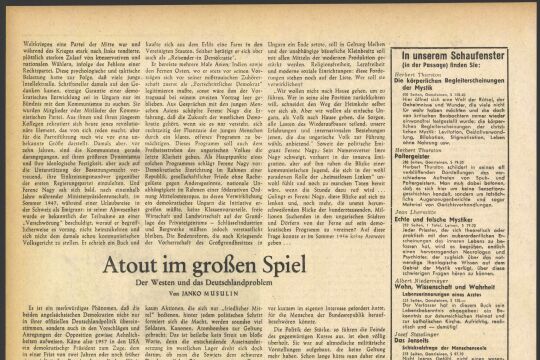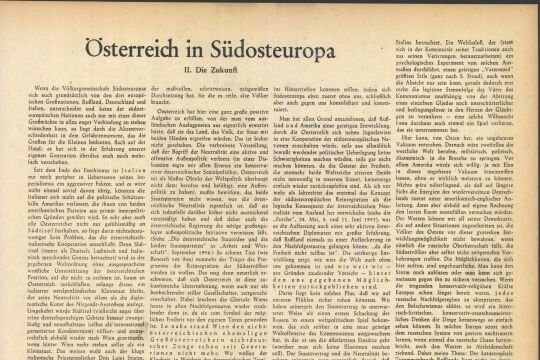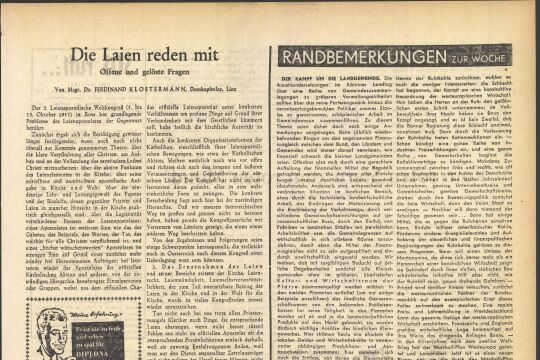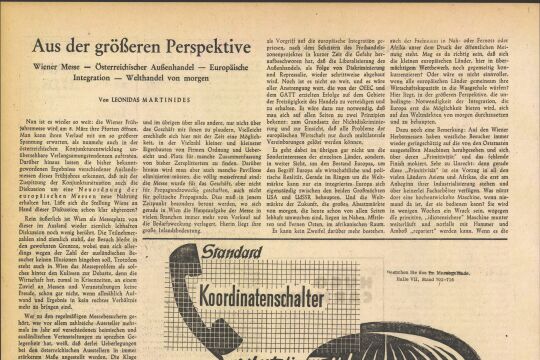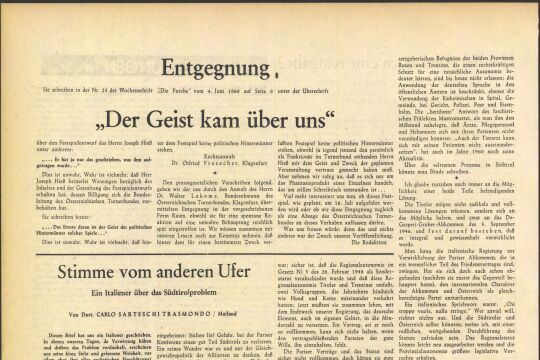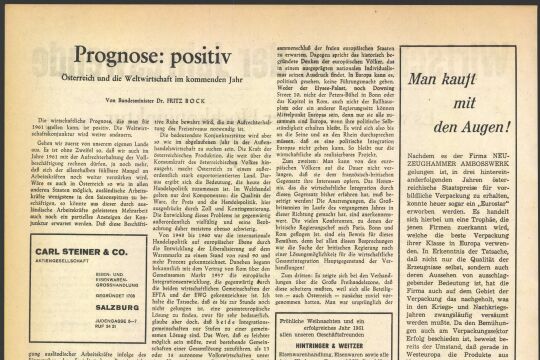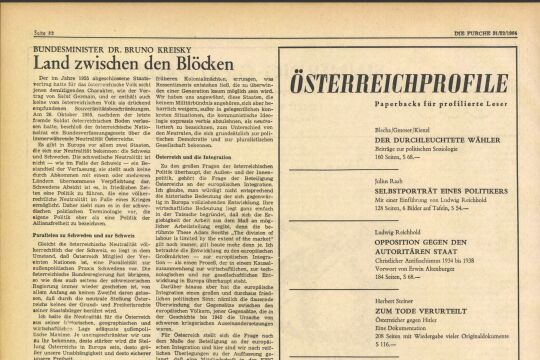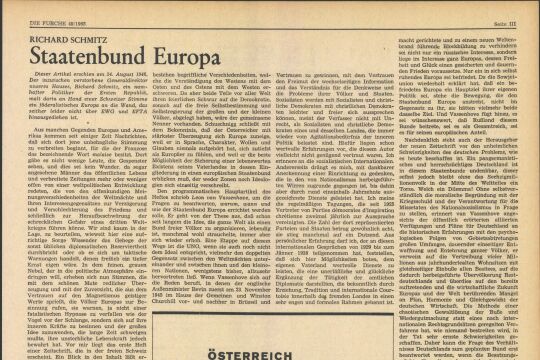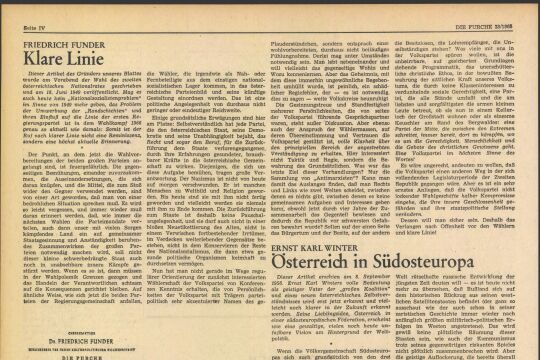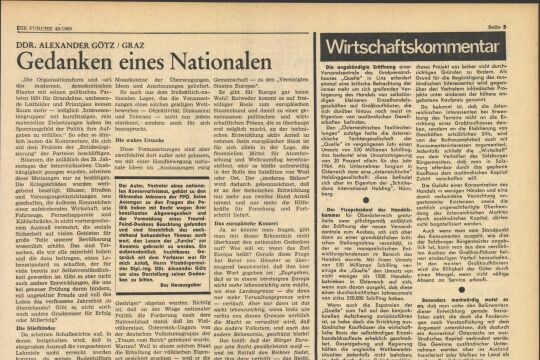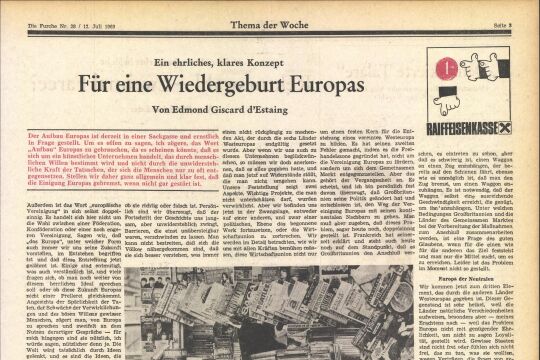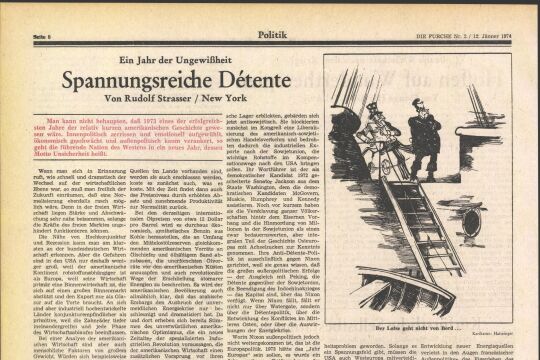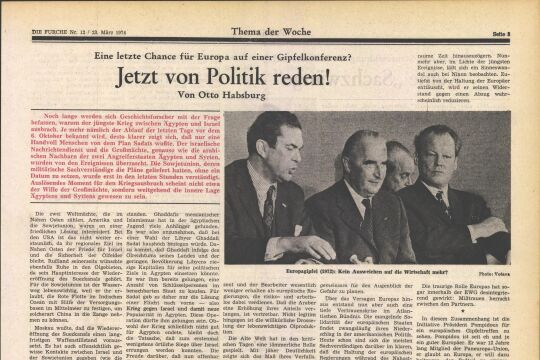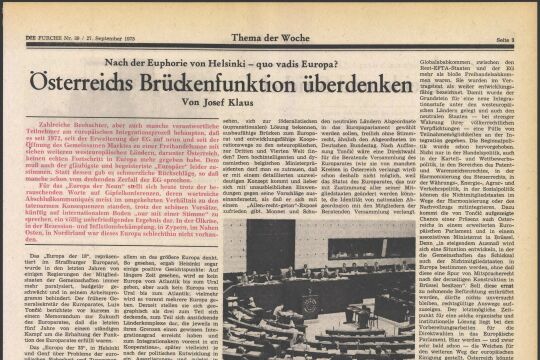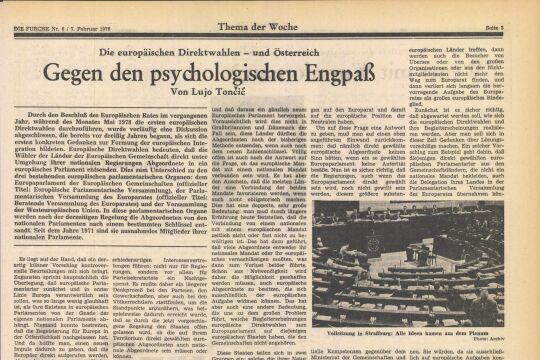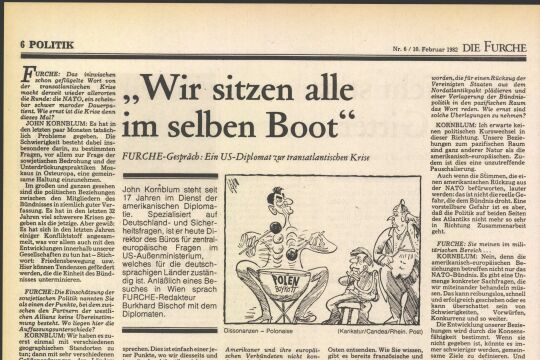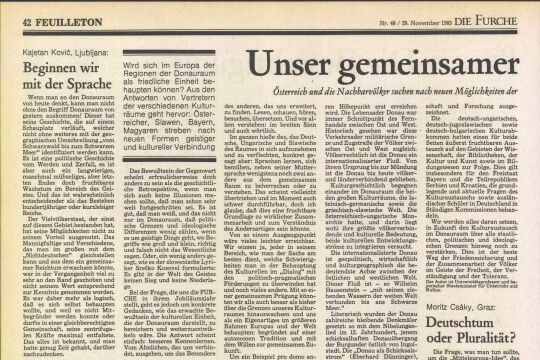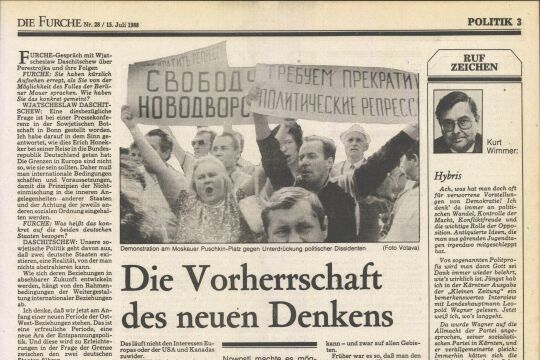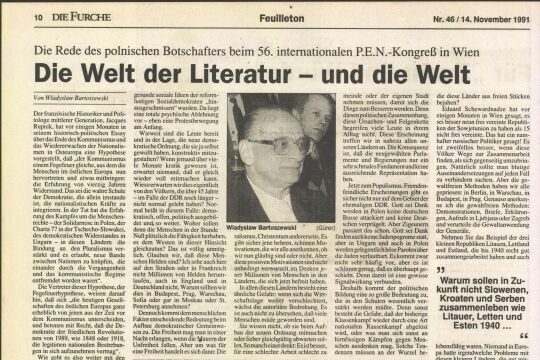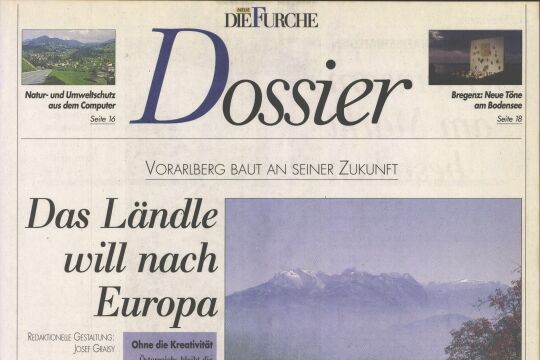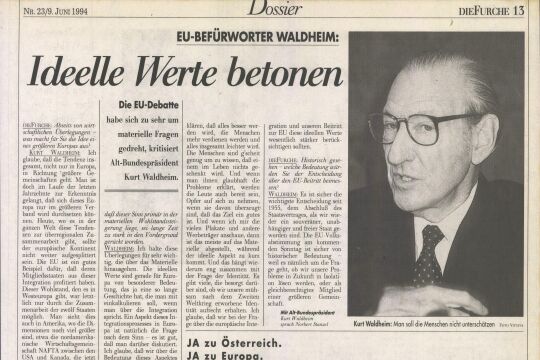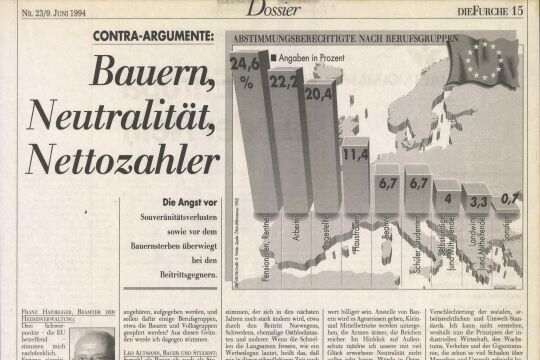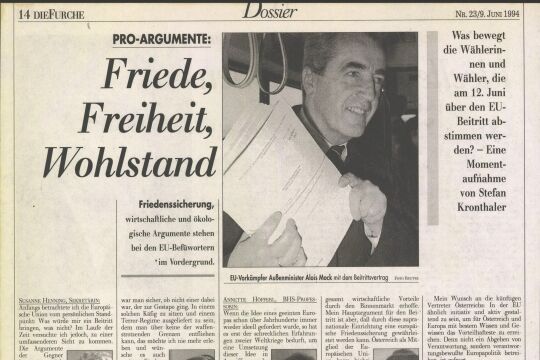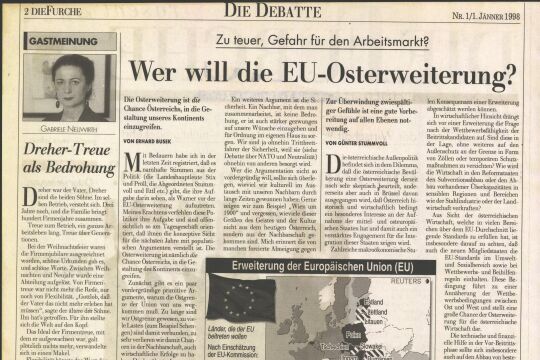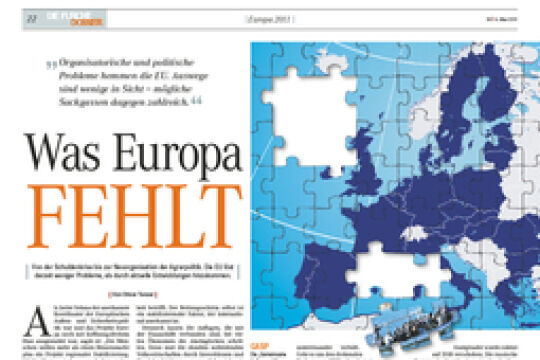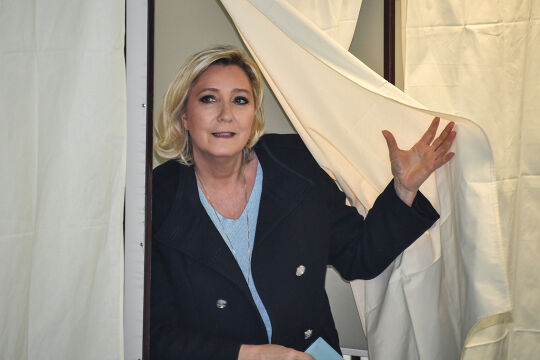Die europäische Integration wurde sehr lange wirtschaftlich gesehen. Das ist einerseits verständlich, aber es hat seinen Preis im Augenblick, in dem eine Rezession kommt. Wir sehen das deutlich an den Wahlergebnissen dieser EU-Wahlen. Sofort wird der Sinn der Integration in Frage gestellt. Kein anderer Wirtschaftsraum, weder die USA noch Russland, China, Japan oder Indien, sind in dieser Situation auf die Idee gekommen, wegen der Krise in kleinere Einheiten zu zerfallen.
Natürlich - keiner dieser Räume versteht sich primär als Wirtschaftsraum, sondern als Nation. Wir kommen zum kuriosen Schluss, dass ausgerechnet die EU ja viel mehr sein will als bloß eine Wirtschaftsgemeinschaft, die mehr als andere Gemeinschaften vom Auf und Ab der Wirtschaft abhängig ist. Aber: Europa ist trotzdem mehr als seine ökonomische Identität.
Das sieht man am größten proeuropäischen Protest in der Geschichte Europas. Jenem in der Ukraine. Auf Tschechisch heißt Ukrajina "nahe". Und tatsächlich ist die Ukraine "nahe". Nahe bei der EU, aber auch nahe bei Russland. Rein geografisch gehört es zu Europa, so wie übrigens auch ein Teil Russlands. Aber das ist nicht, was die Protestbewegung meinte, als sie "wir wollen nach Europa" skandierte. Sie meinte auch nicht den Reichtum Europas, oder nur in untergeordnetem Maß. Wenn wir nach diesem "fünften Element" suchen, werden wir folgendes finden: Der Wunsch, sich in einem System zu entfalten, das den Einzelnen nicht in die Korruption zwingt. Die Freiheit, den Präsidenten einen Versager zu nennen, ohne dafür bestraft zu werden. Die Gewissheit, nicht die Todesstrafe fürchten zu müssen. Was also ist Europa? Der Luxus, über solche Dinge nicht nachdenken zu müssen. Die Tradition, diese Errungenschaften für natürlich zu halten. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir sie so oft vergessen. Auch bei EU-Wahlen.
Der Autor ist Professor für Ökonomie an der Karlsuniversität Prag
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!