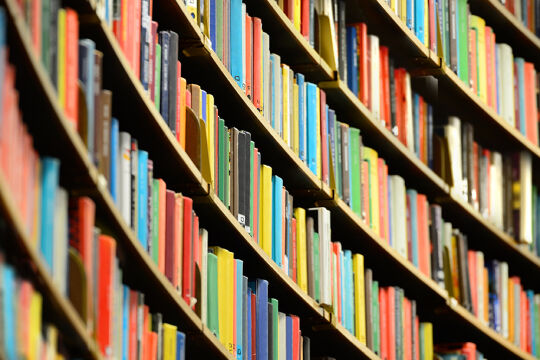Der Literaturnobelpreisträger José Saramago war bis zu seinem Tod ein widerständiger Geist. Sein hellwacher, kritischer Blick galt vor allem den „Ohnmächtigen“ – und der Sprache.
„Wir leben in der Welt der ökonomischen Tatsachen, Senhor Algor.“ Das bekommt der 64-jährige Töpfer Cipriano zu hören, als er wie immer seine Produkte abliefern will, sie ihm aber nicht mehr abgenommen werden. Mit einem Schlag sind sie, ist er nichts mehr wert. Diese Welt der ökonomischen Tatsachen ist zynisch und menschenfeindlich, das erkennt man auch an den überall affichierten Sprüchen:
„WIR WÜRDEN IHNEN ALLES VERKAUFEN, WAS SIE BRAUCHEN, WENN ES UNS NICHT LIEBER WÄRE, SIE WÜRDEN ALLES BRAUCHEN, WAS WIR IHNEN VERKAUFEN KÖNNEN.“
In Ciprianos Welt hingegen war das Töpferhandwerk noch mythisches Bild menschlichen Schaffens, machte die sinnliche Arbeit der Hände Freude. Doch für solche Arbeit und für Alte wie Cipriano gibt es in der Welt der ökonomischen Tatsachen keinen Platz mehr, es sei denn im „Zentrum“: in jener Konsumfestung, deren Fenster man nicht öffnen kann und in der der Alte sein Lebensende verbringen soll. Was Cipriano aber nicht tun wird – denn er ist eine Figur aus José Saramagos Roman „Das Zentrum“ (2000), und bei Saramago finden sich immer wieder Figuren, die sich auf ihre Weise gegen das System wehren, an dem sie leiden, während andere eifrig daran bauen und verdienen.
Übersiedlung nach Lanzarote
José Saramago, der 87-jährig am 18. Juni verstorben ist – glücklicherweise nicht abgeschoben in ein „Zentrum“, sondern in seinem Haus auf Lanzarote, wo er bis zuletzt geschrieben hat – war ein widerständiger Geist. In Erinnerung ist noch der „Skandal“ um seinen Roman „Das Evangelium nach Jesus Christus“ (1991), dessentwegen das portugiesische Kulturministerium Saramagos Nennung für den Europäischen Literaturpreis zurückgenommen hatte. Saramago zog die Konsequenzen und nach Lanzarote, wo er bis zuletzt kritisch und streitlustig die Gesellschaft der Gegenwart beobachtete – vor allem aber erzählte. Am 25. Juni erscheint ein neuer Roman auf Deutsch, „Die Reise des Elefanten“. 2011 kommt jener Roman über den biblischen „Kain“ auf den deutschsprachigen Buchmarkt, der in Portugal im Herbst 2009 Empörung auslöste. Die entrüsteten kirchlichen Stimmen sind freilich immer lauter und den Medien interessanter; kaum hört man von jenen Theologen, die Romane als das lesen, was sie sind, nämlich Literatur, und die nachzudenken beginnen. Man muss „Das Evangelium nach Jesus Christus“ nicht für Saramagos bestes literarisches Werk halten. Aber es kann Schriftstellern, ob atheistisch, ob gläubig, nicht verboten sein, zum Beispiel zu erzählen, dass Jesus im Sterben begriff, dass er „hinter das Licht geführt worden war.“ Und ist nicht ein solches Bild womöglich dem biblisch erzählten Gottverlassenheitsgefühl sogar ziemlich nahe?
Parteiisch war der politische Mensch Saramago als bekennender Kommunist. Das brachte ihm bis zuletzt den Vorwurf der Einseitigkeit ein. Einen „populistischen Extremisten“ nannte ihn L’Osservatore Romano im Nachruf. Als Schriftsteller zeigte sich Saramago parteiisch für jene Menschen, die sich von Systemen nicht kleinkriegen lassen. Die sehen, um die Metapher des Romans „Die Stadt der Blinden“ aufzugreifen, der 2008 verfilmt wurde.
Um sowohl die gesellschaftlichen Entwicklungen als auch Individuen in den Blick zu nehmen, gibt es in Saramagos Romanen ähnliche Verfahren. Der Autor erzählt oft zunächst unheimliche Ereignisse: etwa dass eine Stadt blind wird („Die Stadt der Blinden“, 1995) oder weiß wählt („Die Stadt der Sehenden“, 2004), oder dass in einem Land der Tod ausbleibt („Eine Zeit ohne Tod“, 2005). Er erzählt menschenverachtende und ethisch problematische Vorgänge, die sich aus solchen Situationen ergeben, etwa den Terror der Regierung oder die Abschiebung der Sterbenden über die Grenzen und in den Tod. Dabei stattet er die parabelhaften Handlungen kaum mit Interieur aus, lässt auch die Orte unbenannt: Was passiert, könnte jederzeit und überall passieren. Und was und wie gesprochen wird, ist entlarvend: In unverkennbaren Dialogen – mitreißende Satzungetüme ohne trennende Anführungszeichen – seziert Saramago Macht und ihre Mechanismen und wie sie in Sprache sichtbar werden. Dabei kommt alles aufs Tapet: Seien es pathetisch-religiöse Floskeln oder vaterländische Rhetorik, sei es von Politikern, Kirchenmännern oder Philosophen. In derart erfrischend zu lesenden Dialogen die Komplexität (und den Wahnsinn) von Systemen zu enthüllen: eine literarische Meisterleistung.
Poetik, Politik – und das Leben
Aussichtslose Lagen als Ausgangspunkt. Wenn alles im Chaos zu versinken droht, zoomt Saramago Individuen heran und beobachtet liebevoll-ironisch, wie sie sich plagen, Zivilcourage zeigen, Verantwortung übernehmen, ihre Leben meistern oder scheitern. Er scheint damit literarisch zu verwirklichen, was Elias Canetti einmal als Aufgabe der Dichter beschrieben hat: „Sie sollten imstande sein, zu jedem zu werden, auch zum Kleinsten, zum Naivsten, zum Ohnmächtigsten.“ Nicht selten erweist sich ein Hund als der bessere Mitmensch.
In dieser Hinsicht, mit diesem Blick auf das Individuum in Systemen ist Saramagos Literatur politisch und engagiert, ein wütender Protest gegen Unrecht. Der 1922 in einem portugiesischen Dorf geborene Sohn einer Landarbeiterfamilie schrieb während der Salazar-Diktatur in Oppositionszeitschriften über Literatur. Nach der Revolution wandte er sich ganz der Literatur zu. Breite Anerkennung fand er aber erst mit seinen Romanen „Hoffnung im Alentejo“ (1980) und „Das Memorial“ (1982). 1998 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. In die deutschsprachigen Schlagzeilen kam er zuletzt wegen seiner Blogs, die Rowohlt, sein deutscher Verlag, wohl wegen Saramagos scharfer Kritik an Israel „in der vorliegenden Form“ nicht veröffentlichen wollte. Saramago wechselte zu Hoffmann und Campe, wo sein „Tagebuch“ Anfang Juli erscheinen wird. Seine Literatur verformte er nie zu ideologischen Statements, sie blieb immer Literatur; und Literatur war Saramagos Stärke. Seine Leser lässt er nicht vergessen, dass sie sich in einem Text befinden. Seine Erzähler unterbrechen die Handlung und kommentieren selbstironisch das Geschehen und die Sprache sowie das Verhalten und Sprechen der Figuren: „Auf ein solches Was wäre wenn wird man nur schwerlich eine den Leser befriedigende Antwort finden“, heißt es in „Die Stadt der Sehenden“. „Außer der Erzähler wäre so ungewöhnlich aufrichtig zuzugeben, dass er sich nie wirklich sicher war, wie er diese einzigartige Geschichte … zu einem guten Ende bringen könnte.“
Diese Frage war bei Saramago nicht nur eine der Poetik, sondern wohl auch eine der Politik – und des Lebens.