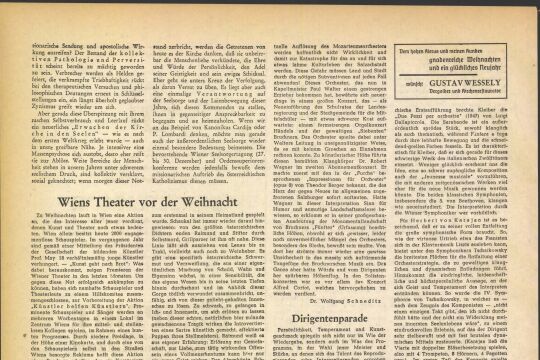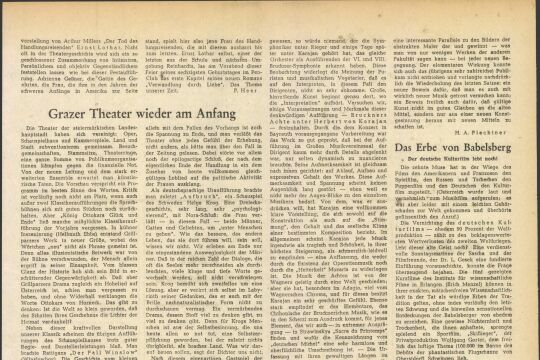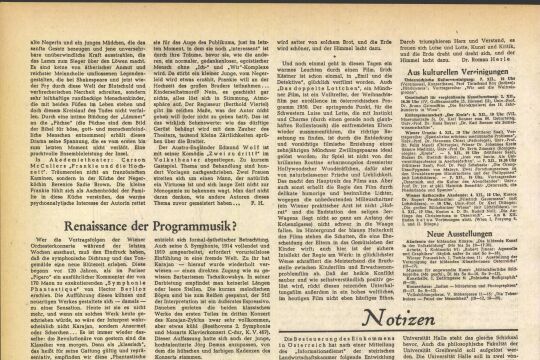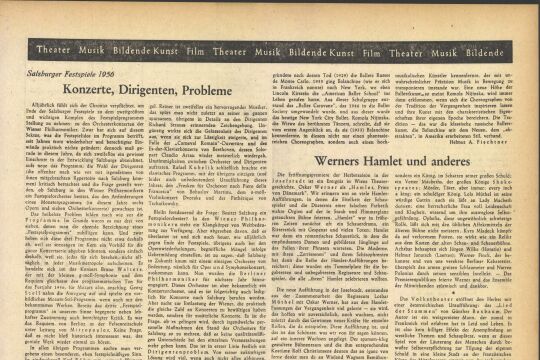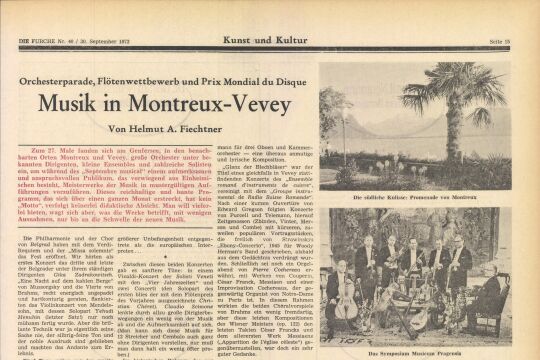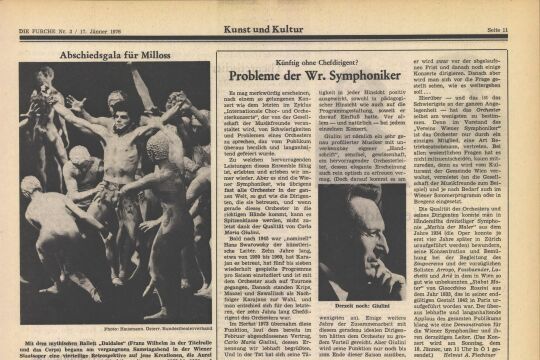Sein samtig-weicher Ton ist singulär, selbst kurze Einwürfe der Soloklarinette geraten solcherart zu Pretiosen. Karajan wollte ihn gar von den Wiener zu seinen Berliner Philharmonikern holen: Peter Schmidl, Doyen der Wiener Staatsoper, Beinahe-Konzertdirektor der Salzburger Festspiele und bekennender Computerfreak.
„So etwas, jetzt setzt er sich in ein fades Orchester und könnte eine Weltkarriere machen!“ Peter Schmidl hat noch gut diese Worte seiner Lehrerin am Wiener Reinhardtseminar, Susi Nicoletti, in Erinnerung, als er ihr sagte, dass er in das Orchester der Wiener Staatsoper engagiert wurde. Dabei hatte er erst ein Semester Schauspielunterricht hinter sich. Damit wollte er die nächsten drei Jahre überbrücken. Dann, so hoffte er, wäre die nächste Klarinettenstelle in der Staatsoper und nach einigen Jahren auch bei den Philharmonikern frei.
Es sollte aber anders kommen: Ein philharmonischer Klarinettist starb unerwartet während der Mozartwoche 1965 in Salzburg. Schmidl, der im Jahr zuvor das Klarinettenstudium an der Wiener Musikakademie abgeschlossen hatte, ging zum Probespiel und gewann es. Um sich gut vorbereiten zu können, hatte er sich vom Reinhardtseminar beurlauben lassen. Keine leichte Entscheidung, denn er hatte bereits einen Vertrag für die Tischgesellschaft in der „Jedermann“-Aufführung der Salzburger Festspiele 1965 in der Tasche. Nach dem erfolgreichen Probespiel verbrachte er diesen Festspielsommer dann nicht auf der Bühne, sondern im Orchestergraben und setzte damit eine Tradition fort. Denn der Großvater und der Vater waren beide Klarinettisten in der Oper und bei den Philharmonikern. Und zwar Solo-Klarinettisten, eine Stelle, die auch Schmidl seit 1968 bekleidet.
Fünf bis sechs Stunden täglich üben
Ab 1962 substituierte er in der Oper. Ehe er zum Probespiel antrat, wirkte er bei etwa 150 Opernaufführungen mit, nur zweimal im philharmonischen Konzert. Fünf bis sechs Stunden übte Schmidl täglich, um sich das entsprechende Rüstzeug zu holen. Eine Schule, die er auch seinen zahlreichen Schülern rät. Seit 1967 hat er eine Klarinettenklasse an der Wiener Musikuniversität, seit 1982 ist er dort Ordentlicher Professor. An die 80 Prozent der in Österreich tätigen Klarinettisten kommen aus seiner Klasse, darunter auch zahlreiche philharmonische Kollegen. Sie haben es schwerer als früher. Gerade frühere Ton- und Filmdokumente bestärken Schmidl in seinem Urteil, dass die Orchesterqualität in den letzten Jahrzehnten ungleich besser ist als etwa noch in den 1970er Jahren, womit er sich gegen so manche landläufige Ansicht stellt.
Freilich müsse man neben der Hebung des technischen Standards auch danach trachten, dass der charakteristische Klang des Orchesters erhalten bleibt. Solches hängt auch mit der typischen philharmonischen Spielweise zusammen. „Wir versuchen, die Intervalle möglichst rein und nicht temperiert zu spielen, die Dur-Terz extrem tief, die Quint höher, das macht teilweise den Klang aus“, lüftet er eines der philharmonischen Klanggeheimnisse. Im Übrigen erwartet er von einem guten Klarinettisten nicht nur eine profunde Technik, sondern auch, dass er „etwas hat, was die anderen nicht haben“.
Genau das war wohl der Grund, weshalb Herbert von Karajan Anfang der 1980er Jahre Peter Schmidl offerierte, als Solo-Klarinettist zu seinen Berlinern zu kommen – ohne Probespiel, versteht sich. Schmidl musizierte bei den Berliner Philhamonikern schließlich mehrmals unter Karajan, auch in Wien bei einem Gastspiel mit Ludwig van Beethovens Neunter. Zum Berliner Engagement ist es dann doch nicht gekommen; Schmidl blieb in Wien, sowohl in der Oper als auch bei den Philharmonikern.
Karajan zählt mit Bernstein zu den beeindruckendsten Dirigenten, die er während seiner langjährigen philharmonischen Tätigkeit erlebt hat. Was er nicht als einschränkend verstanden wissen will. Begeistert war er auch von Claudio Abbados philharmonischem Debüt 1965 mit Gustav Mahlers zweiter Symphonie bei den Salzburger Festspielen. Das Meiste an Orchesterkultur, ist er nach wie vor überzeugt, konnte man bei Karl Böhm lernen. „Er war ein Diener des Werks und wollte es ehrlich und getreu aufgeführt wissen.“ Eine „Missa solemnis“ und Aufführungen von Bruckner-Symphonien sind Schmidl besonders im Gedächtnis geblieben. Karajan und Bernstein schienen ihm, um eine Anleihe bei Hermann Hesse zu nehmen, wie „Narziss und Goldmund“. „Der eine, Karajan, apollinisch, der andere, Bernstein, dionysisch.“ Von Karajan konnte man sich richtiggehend hypnotisieren lassen, wie er aus einer Aufführung von Peter Iljitsch Tschaikowskys „Pathétique“ in Paris weiß. Ebenso schwärmen kann der philharmonische Solo-Klarinettist von seinen zahlreichen Auftritten unter Leonard Bernstein, unter anderem mit Mozarts Klarinettenkonzert oder Bernsteins im Jazz-Stil der 1940er Jahre geschriebenem Werk „Prelude, Fugue and Riffs“. Auch Kammermusik hat Schmidl zeitlebens musiziert, zuerst mit seinem philharmonischen Kollegen Wolfgang Schulz, dann im Rahmen von philharmonischen Oktettformationen. Vieles davon wurde für Platte eingespielt. Die Jungen, beklagt er, haben es schwer, denn dieses Repertoire wird so gut wie nicht mehr aufgenommen, wertvolle Dokument gehen damit verloren.
Eineinhalb Perioden wirkte Schmidl als Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker. „Die Philharmoniker sind sehr verehrt, sie könnten noch mehr geliebt sein“, nennt er hier sein Motto. Also versuchte er zusammen mit den übrigen Funktionären neue Wege zu gehen. Der Computerfreak stellte die Administration auf EDV um, das Kartenbüro wurde aus dem Musikverein an den Ring verlegt und mit dem Konzert in Schönbrunn bewusst versucht, ein breites Publikum zu erreichen. Die Idee eines Chefdirigenten freilich hat er nicht einmal angedacht: „Will er uns oder wollen wir ihm den Stempel aufdrücken?“, stellt er als Frage in den Raum, um sie gleich selbst zu beantworten: „Wir haben eine solche Eigenart, die kann man nur ohne Chefdirigent erhalten. Viel machen mit einigen wenigen, ihnen aber keine Macht geben.“ Eine Idee, die er auch in seiner Geschäftsführerzeit verwirklichte. Hier stellt er drei Dirigenten bewusst ins Zentrum: Nikolaus Harnoncourt, weil er am besten demonstriert, dass Musik eine Sprache ist, Seiji Ozawa als Musikdirektor der Wiener Staatsoper und Riccardo Muti, „ein ganz großer Mann, der die Philharmoniker liebt und damals keine Verpflichtungen mit anderen Konzertorchestern hatte“.
„Weicher, weniger akzentuiert“
Mittlerweile ist Peter Schmidl in der Nachfolge des früheren Philharmoniker-Vorstands Werner Resel Doyen der Wiener Staatsoper und hat damit das Privileg, über die Pensionsgrenze von 65 Jahren noch zu bleiben. Eine Funktion, bei der er die zuweilen unterschiedlichen Auffassungen zwischen dem Direktor im Haus am Ring und den Interessen der Wiener Philharmoniker hautnah miterleben kann. Aber auch hier lautet seine Maxime: „Man sollte sich gut zusammenstreiten.“ Schließlich geht es um eine gemeinsame Sache: Musik in bestmöglicher Qualität.
Die hätte er beinahe auch in Salzburg als Konzertdirektor verwirklicht. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Dass er trotz der Vielfalt seiner Interessen und Aktivitäten immer noch Zeit für anderes hat, beweist er mit regelmäßigem Joggen, Bergsteigen und überdurchschnittlichen EDV-Kenntnissen. „Ich bin fast krankhaft ehrgeizig, aber ich lasse die anderen leben“, beschreibt er sich zuweilen selbst. Bestes Beispiel: Er fordert seine Schüler bis zum Äußersten und setzt alles daran, dass die Besten in den philharmonischen Reihen zu finden sind. Damit braucht man sich auch nach drei Generationen Schmidl nicht um das charakteristische philharmonische Klangprofil sorgen. „Weicher, weniger akzentuiert“, beschreibt er kurz und konzise den philharmonischen Klang, den er vor allem auf eine Wurzel zurückführt: die Wiener Mundart.
Zu Gast bei den Wiener Philharmonikern
Von Walter Dobner, mit Fotos von Philipp Horak, Styria Verlag 2009, 244 S., geb., e 29,95
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!