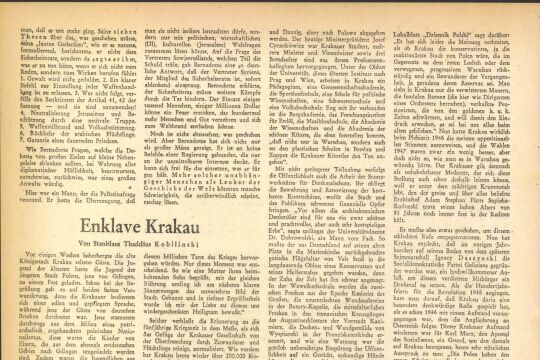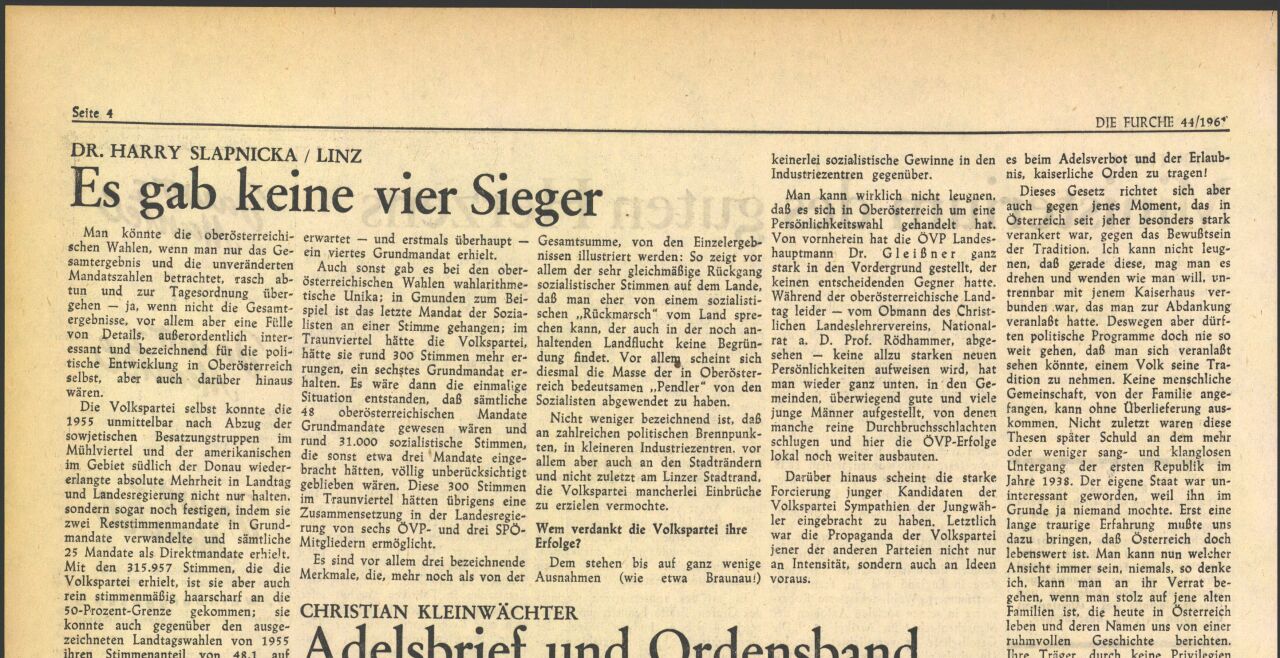
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Adelsbrief und Ordensband
Wer hat nicht schon bemerkt, wie sehr sich die meisten Menschen heutzutage bemühen, aus ihrer Umgebung hervorzustechen? Man hält es fast für unmöglich, bei gesellschaftlichen Veranstaltungen im bloßen Frack ohne Auszeichnung zu erscheinen. Man trachtet, so bald wie möglich einen akademischen Ehrentitel zu erhalten, und wäre überglücklich, wenn ein noch so kleines Prädikat vor dem Namen stünde. All dies, um zu zeigen, daß man einer gehobeneren Kaste angehört. Wenn solche Ambitionen in einer Monarchie wahrnehmbar würden, so würde man dies mit der Regierungsform erklären. Tatsache ist, daß noch nie so viele Anstrengungen nach einer Auszeichnung gemacht wurden wie gerade heute, in der Republik.
Insgeheim lächeln wir iib.ęr . diese menschliche Schwäche. Und doch hat sie . eine tiefere Ursache, als wir vielfach glauben. Unser technisiertes Zeitalter ist recht arm geworden an jenen Dingen, die nicht, oder sagen wir nur schwer mit Geld zu kaufen sind. Daneben geht der heutigen Zeit gerade jene Ehrfurcht vor dem Mitmenschen ab, die vor nicht so langer Zeit bereits begonnen hatte, Allgemeingut der Menschheit zu werden. Dieses Zeichen einer gesunden Humanität wurde durch zwei große Katastrophen der beiden Weltkriege restlos ausgetilgt. Die heutige Sehnsucht nach Auszeichnungen jeder Art geht sicherlich zunächst auf jene Diffamierung zurück, die nach dem ersten Weltkrieg begangen wurde. Wenige Monate nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, im April 1919 bereits, beschloß die österreichische Nationalversammlung, eilends den Adel abzuschaffen, seine Führung zu verbieten und Zuwiderhandlungen unter Strafe zu stellen. Wie so manches Gesetz, das einem augenblicklichen Ressentiment entsprungen ist, war auch dieses völlig sinnlos. Hatte man damals wirklich geglaubt, daß Adelige jene Katastrophe verschuldet hatten? Ich kann es nicht glauben. Dafür aber hatte man Menschen gekränkt, die, wie andere auch, nicht unerhebliche Opfer für das Vaterland gebracht hatten. Irgend ein Nutzen ist der Republik aus diesem-i Qesc a er wachsen. Nun.sagt eine alte politische Weisheit,..daß man eher qineu Gegner töten, als ihn dauernd Kranken soll. Dieses Gesetz war nur eine Kränkung, sonst nichts. Schon lange vor dem verlorenen Krieg war der österreichische Adelstitel nur mehr ein Zeichen besonderer Anerkennung gewesen, wie es Orden und ehrende Titelverleihungen auch waren und heute noch sind. Allerdings wurde durch die Verleihung des Adels eine Gesellschaftsschichte immer wieder erneuert, deren Lauterkeit und Sauberkeit im großen gesehen außer Diskussion stand und in die hineinzukommen sich jeder be mühte. Der tiefere Grund des Erlasses dieses Gesetzes aber dürfte das Bestreben gewesen sein, gerade diese Gesellschaftsschichte zu treffen und sie gleichsam ihrer Exklusivität zu entkleiden. Dabei vergaß man. daß man wohl eine Gesellschaftsschichte beseitigen kann, so oder so, daß damit aber noch keine neue Gesellschaft begründet wird. Bis wiederum sich eine solche konstituiert, braucht es etliche Jahrzehnte. Aus dieser Erwägung heraus wird es verständlich, daß man in Österreich wesentlich radikaler war als in Deutschland, wo nach 1918 der Adelstitel einfach zum Namensbestandteil erklärt wurde. So verlor der Adel zwar seine früheren Privilegien, nicht aber seine gesellschaftliche Stellung. Daß man selbstverständlich vergessen hatte, welche Schäden die radikale Beseitigung dęs Adels in der französischen und nrssi- schen Revolution den betreffenden Völkern zugefügt hatte, bewei’st die These, daß aus der Geschichte me etwas gelernt wird.
Gegen die Tradition
Wie paradox dieses Gesetz war. zeigt, daß nach Verbot der Führung des Adels konsequenterweise auch das Tragen der alten kaiserlichen Orden hätte verboten werden müssen. Hiervon aber schreckte man zurück, weil eine zu große Verstimmung sich übel auf die benötigten Wählerstimmen ausgewirkt hätte. So blieb es beim Adelsverbot und der Erlaubnis, kaiserliche Orden zu tragen!
Dieses Gesetz richtet sich aber auch gegen jenes Moment, das in Österreich seit jeher besonders stark verankert war, gegen das Bewußtsein der Tradition. Ich kann nicht leugnen, daß gerade diese, mag man es drehen und wenden wie man will, untrennbar mit jenem Kaiserhaus verbunden war, das man zur Abdankung veranlaßt hatte. Deswegen aber dürften politische Programme doch nie so weit gehen, daß man sich veranlaßt sehen könnte, einem Volk seine Tradition zu nehmen. Keine menschliche Gemeinschaft, von der Familie angefangen, kann ohne Überlieferung aus- kommen. Nicht zuletzt waren diese Thesen später Schuld an dem mehr oder weniger sang- und klanglosen Untergang der ersten Republik im Jahre 1938. Der eigene Staat war uninteressant geworden, weil ihn im Grunde ja niemand mochte. Erst eine lange traurige Erfahrung mußte uns dazu bringen, daß Österreich doch lebenswert ist. Man kann nun welcher Ansicht immer sein, niemals, so denke ich, kann man an ihr Verrat begehen, wenn man stolz auf jene alten Familien ist, die heute in Österreich leben und deren Namen uns von einer ruhmvollen Geschichte berichten. Ihre Träger, durch keine Privilegien hervorgehoben, Menschen, wie wir alle, haben es im Leben nicht so leicht, wie es viele heute noch vermeinen. Auf ihren Schultern ruhen Traditionen, die erst seelisch irgendwie dem heutigen Leben angepaßt werden müssen. Sie sind im Beruf eher hinderlich. Wieviel leichter hat es da jeder schlichte Bürger, der durch keine Bindungen dieser Art viel freier seine Entscheidungen treffen kann.
Wo ist die neue Gesellschaft?
Eine Gesellschaft wieder aufzubauen, ist nicht nur langwieriger, sondern auch bedeutend schwerer, als sie zu zerstören. Während man anderswo nichts daran findet, wenn ein Sozialist nach seinem Abgang von der politischen Bühne in das House of Lords einzieht, während man auf Familien hinweist, die mit der Mayflower ins Land gekommen waren, während sich iogdr Frankreich, das klassische Land moderner Demokratie, eitrigst bemüht, sich seine Gesellschaft zu erhalten, muß man sich bei uns fast entschuldigen, einer Familie mit Tradition anzugehören. Gerade jene Kreise aber, die ihren Weg gerne von unten herauf machen möchten, wollen zu einer Gesellschaftsschichte stoßen, die über der ihrer Herkunft liegt. Gibt es eine solche aber noch bei uns? Haben nicht die beiden Katastrophen beider Weltkriege neben den begangenen politischen Fehlern fast alle Unterschiede beseitigt?
Aus diesen Motiven heraus werden wir die heutige Sucht nach Auszeichnungen jeder Art besser verstehen können. Sie ist nicht so lächerlich, wie sie zuerst scheinen mag. Sie drängt nach einer Gesellschaft, bei der nicht die finanzielle Potenz, nicht die öffentliche Stellung allein maßgebend ist, sondern jene Tugenden ausschlaggebend sind, die einstmals unser Beamtenkorps ausgezeichnet hat. Dort gab es keine Korruption, keine Protektion von Untüchtigen, höchstens daß hie und da eine Ausnahme die Regel bestätigte. Diese Ausnahmen wurden sofort aus dieser Gesellschaft ausgestoßen. Eine Maßnahme, die ärger als die höchste Strafe wirkte.
Man kann mir Vorhalten, daß jede Gesellschaftsklasse ihre Mängel habe. Das Nichtvorhandensein einer lauteren Gesellschaftsschichte aber, der anzugehören das Streben aller Menschen ist, dürfte ein weitaus größerer Mangel und — zuletzt keine geringe Gefahr füf den Bestand des Staates sein.
Indem ich den Kreis schließen möchte, kehre ich zu dem Sammeln von Auszeichnungen zurück. Die Tatsache, daß die zweite Republik ein Ehrenzeichen mit vielen Stufen geschaffen hat, verursachte viel Verwirrung. Hier Wandel zu schaffen, daß man verschiedene Auszeichnungen mit wenigen Graden stiftet, würde zumindest zur Beseitigung dieser Verwirrungen beitragen. Daneben könnte man in Österreich analog dem heutigen deutschen „Pour le merite” eine gleichartige Auszeichnung schaffen — wobei ich nicht unbedingt an eine Fortsetzung des so traditionsreichen Maria-Theresien-Ordens denke. Alle diese Möglichkeiten würden sicherlich neben anderen Bestrebungen zum Wiederaufbau einer Gesellschaft beitragen, die von sich aus heraus jene Mißstände bekämpft, die so oft und oft heute beklagt werden und die an den Grundfesten unseres Staates nagen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!