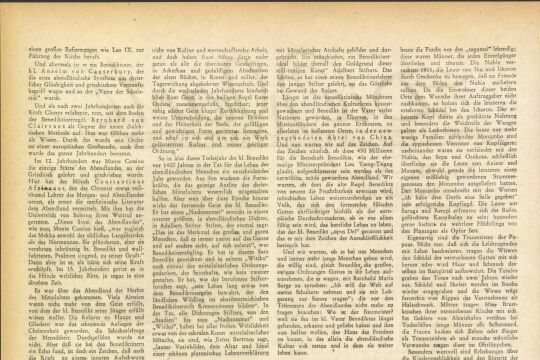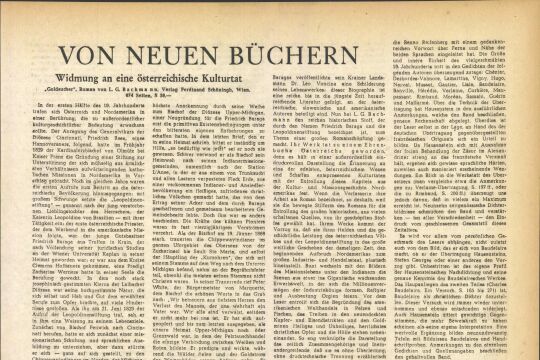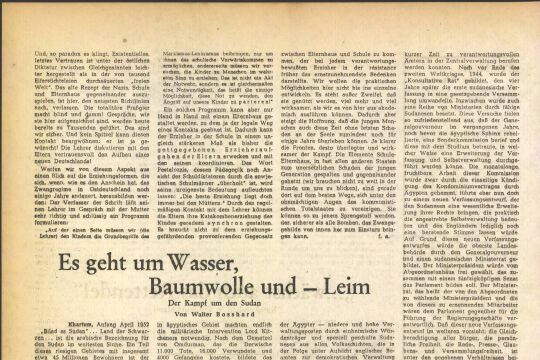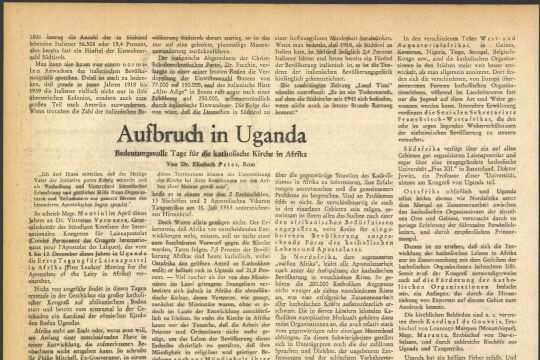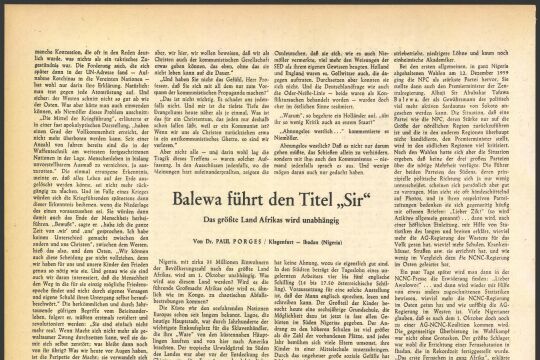Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das „Amata bu a ree...“ der Madi
ZERBROCHEN LIEGT DIE STEINERNE SÄULE am rechten Straßenrand. Sie wurde gewaltsam umgestürzt, und der Pfeil, der früher den Weg wies, zeigt nun himmelwärts. „Catholic Mission“ verkünden verwitterte Buchstaben. Der Pfad, der von der Straße Juba—Nimule abzweigt und zur Missionsstatdon Loa führte, ist noch gut zu erkennen. Aber das christliche Loa hat zu bestehen aufgehört. Es erlitt das gleiche Schicksal wie all die anderen Missionsstationen des Südsudans: Missionäre und Schwestern wurden vertrieben, die Missionsschulen hat man in Koranschulen umgewandelt.
Christenverfolgungen mögen im Zeitalter der weltweiten atomaren Vernichtungsdrohung anachronistisch erscheinen. Aber sie bestehen, sind in den Südprovinzen des Sudans blutige Realität.
In den vergangenen Jahren wurden nicht nur sämtliche Priester des Landes verwiesen, auch 250.000 christliche Sudanesen sind aus Furcht vor den Verfolgungen in andere afrikanische Staaten geflüchtet.
Der christliche Süden des Sudans droht zu versinken. Eine Entwicklung, die für uns um so schmerzhafter ist, als an der Missiomierung dieser Gebiete auch österreichische Missionäre großen Anteil hatten.
DIE SEIT 1956 UNABHÄNGIGE REPUBLIK SUDAN (Jamhuryat es-Sudan) umfaßt das ehemalige anglo-ägyptische Kondominium, wie es seit der Niederwerfung des Madi-Aufstandes im Jahre 1898 bestand. In den sechs Nordprovinzen des 2,5 Millionen Quadratkilometer großen Landes herrscht das arabische Element vor. Von den insgesamt zwölf Millionen Einwohnern sind etwa vier Millionen Neger, die in den drei Südprovinzen Upper Nile, Bahr el Ghazal und Equatoria leben.
Während der Nordsudan aus-sdhließlich von Mohammedanern bevölkert ist, sind die Neger Christen oder Heiden. Zum rassischen Gegensatz kommt also auch ein religiöser. Doch nicht genug damit: es gibt schwerwiegende Unterschiede in historischer, landschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht.
In der Geschichte des Sudans nimmt der Sklavenhandel breiten Raum ein, und als die erfolgreichsten Sklavenhändler scheinen Araber auf. Die Befürchtung der Neger, in ihren arabisch-sudanesischen Landsleuten könnte das Herrenmenschentum von einst wieder Macht gewinnen, entbehrt nicht gewisser realer Grundlagen. Viele arabische Sudanesen halten Negerdiener: daß schwarzes Hauspersonal weniger Geld kostet, ist vielleicht nicht immer der Hauptgrund.
Das Wort von der „Kolonie im eigenen Land“ charakterisiert den Süden als billige Quelle für Feldfrüchte, Obst, Vieh — und Menschen. Die wirtschaftliche Verschiedenheit ist landschaftlich bedingt. Der Nordsudan besteht fast nur aus Wüste, im Süden liegen die grünen Gebiete mit Tropenklima. Im Norden kostet ein Ei zwei Piaster und wird mit Frachtflugzeugen aus dem benachbarten Äthiopien importiert, im Süden werden für einen Piaster zehn Eier gegeben. Ein Huhn kostet kaum mehr als 3 Piaster (das sind etwa 2,20 österreichische Schilling), für eine kleine Ziege werden 20 Piaster, für eine Oka Rindfleisch 8 Piaster verlangt. Im Norden stellt sich ein Kilogramm Bananen auf 6 Piaster, im Süden kann man' für 3 Piaster einen ganzen Zweig kaufen.
NACH DER UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG der einheimischen Regierung wurde der Süden für Fremde gesperrt. Ein Ausländer, der Equatoria, Bahr el Ghazal oder Upper Nile bereisen will, benötigt eine Sondergenehmigung des Innenministeriums in Khartoum, ein „Permit to enter closed district“, das natürlich auch verweigert werden kann, und zwar ohne Angabe von Gründen.
In den Provinzialverwaltungen des Südens sitzen heute nicht nur Araber, sondern auch Neger. Auch im Parlament und im Senat haben schwarze Sudanesen Sitz und Stimme. Doch der Gegensatz zwischen Braun und Schwarz erscheint zu groß, als daß er auf parlamentarischem Wege bereinigt werden könnte.
Den Negerpolitikern schwebt für die nächste Zukunft eine Föderation der drei Südprovinzen mit dem arabischen Norden vor, später soll die völlige Loslösung erfolgen. Für dieses Ziel ging Ezbonni Mondri, führender Kopf der Federal Party, ins Gefängnis. Ein nicht weniger leidenschaftlicher Vertreter der Separatisten, der Dinka-Häuptling William. Deng, mußte 1961 ins Exil flüchten. Im Kongo gründete er die Sudan African National Union (SANU). Für den unabhängigen Negerstaat im Herzen Afrikas war ursprünglich die Bezeichnung Equatoria vorgesehen, seit einiger Zeit wird ein neuer Name genannt: Azania.
Der Schlag, den der frühere sudanesische Ministerpräsident Marschall Abboud vor sechs Jahren gegen die katholischen Missionen führte, sollte nicht zuletzt die schwarzen Politiker treffen. Damals erhielten die Stationen schwere Beschränkungen auferlegt, Missionäre und geistliche Schwestern wurden des Landes verwiesen.
In den Provinzen Upper Nile, Bahr el Ghazal und Equatoria leben nun hunderttausende schwarze Christen ohne geistliche Betreuung. Sie gehören mehreren Stämmen an. Am volkreichsten sind die Dinka, deren Zahl auf mehr als 850.000 Seelen geschätzt wird. Ihr Stammeszeichen sind vier waagreohte Schnittnarben über Stirn und Kopf. Die Nuer tragen fünf Schnittlinien und zählen etwa 350.000 Menschen, dann folgen die Schilluk (über 200.000), die Bari (etwa 100.000) und eine beträchtliche Anzahl kleinerer Stämme.
CHRISTEN LEBTEN SCHON vor 1600 Jahren im Gebiet des heutigen Sudans. Die Missionierung ist jedoch nur etwas älter als 110 Jahre. Das bedeutet keinen Widerspruch: der Sudan war ebenso wie Äthiopien ein frühchristliches Land.
Im fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung gab es bereits sieben Diözesen allein im Gebiet von Don-gola, einem Ort in der heutigen Nordprovinz. Das staatliche Museum in Khartoum enthält Bildrekonstruktionen aus den einstigen Kirchen am oberen Nil, die nun Ruinen sind. Es war ein Christentum armenischer Prägung, das damals blühte, sich aber dem Ansturm des Islams nicht gewachsen zeigte und unterging.
Bei Sayala in Oberägypten dem österreichischen Grabungsgebiet in Nubden, wurde vor zwei Jahren eine koptische Wehrsiedlung aus dem siebenten Jahrhundert aufgefunden. (Dieser Landstrich wird nach Fertigstellung des neuen ägyptischen Hochdammes bei Assuan unter dem Rückstau des Nils verschwunden sein.) Die Siedlung lag auf einem Plateau hoch über dem Fluß. Von den Archäologen konnten Schlammziegelbauten bis zu einer Mauerhöhe von 4,5 Meter freigelegt werden. Dem Wüstensand, der die Ruinen der Festung im Laufe der Zeit zugeweht hatte, konnten auch zwei Kirchen entrissen werden.
Beide Gotteshäuser waren zwei-schiffig und zeigten Merkmale byzantinischen Stils. Den Fresken-schmuck hatten die einstigen Eroberer dieser Wehrsiedlung von den Wänden abgeschlagen, vermutlich aus religiösem Fanatismus; es gelang jedoch, Büder bis zu Tischplattengröße an Hand der aufgefundenen Bruchstücke zu rekonstruieren.
Die römisch-katholischen Missio-nierungs versuche begannen 1846. Zwei Jahre später wurden in Khartoum eine Kirche und eine Schule gegründet — vermutlich die erste öffentliche Schule dieses afrikanischen Landes überhaupt.
VIER JAHRE SPÄTER konnten Missionare den Weißen NU aufwärts bis Rejaf reisen; ihr Superdor hieß Knoblecher und war Österreicher. In Gondokoro entstand eine Station für die Bekehrung der Bari-Neger, in Kenisa für die Dinka und in Kaka für die Schilluk.
Der arabische Derwischaufstand und die darauf folgenden Jahre des Kalifats zerstörten alles Christliche. Doch unter den ersten Europäern, die nach 1898 in den Sudan zurückkehrten, befanden sich wieder katholische Missionare. Auch zwei österreichische Priester setzten die gewaltsam unterbrochene Arbeit im tropischen Süden des Landes fort: Pater Ohrwalder und Pater Bonholser. Nach Loa zu den Madi-Negern,einem Stamm von etwa 20.000 Seelen, kamen 1920 mehrere italienische Missionare. An einer Stelle mitten im Busch, wo sie Wasser fanden, stellten sie zwei Hütten auf: Eine größere, in der sie unterrichteten, und eine kleinere, in der sie schliefen. Aus Selbstgebrannten Ziegeln wurden im Laufe der Jahre eine Elementarschule mit vier Knaben-und vier Mädchenklassen, ein kleines Spdtal und eine Kirche gebaut. Italienische Schwestern betreuten die Mädchenschule, das Spital und die Küche der einsamen Mdssions-station.
DIE MADI GLAUBTEN AN GEISTER. Auch einen primitiven Totenkult fanden die Missionäre vor. Unter den Vorratsbehältern für Feldfrüchte — kleinen, auf Pfosten errichteten Rundhütten — wurden Kidord errichtet: zwei aufrecht stehende Steine, darüber ein dritter. An diesen Opferstätten brachten die Eingeborenen nach Sonnenuntergang bestimmte Nahrungsmittel und Speisen ihren Ahnen dar.
Bis 1961 konnten etwa 10.000 Madl zum Christentum bekehrt werden. Erwachsene wurden nach einer Zeit der Vorbereitungen getauft, Kinder christlicher Eltern erhielten das Sakrament und einen christlichen Namen in den ersten Lebenstagen. Da auch der heidnische Name blieb, ergaben sich ungewöhnlich klingende Kombinationen, wie Bonaventura Aketri, Gabriele Androga, Maria Galamo, Paolo Bunu, Theresa Foni.
HEUTE LIEGT DAS EINST BLÜHENDE LOA verlassen in der Weite des Buschlandes. Im Schulgebäude wurde eine staatliche Koranschule untergebracht, das Wohnhaus der Patres, das Schwesternhaus und das Spital stehen leer. Die neue Kirche — sie sollte 3000 Gläubige fassen — konnte nicht fertiggebaut werden; sie wurde zur Ruine, ehe sie vollendet war, das hölzerne Glockengerüst ist zusammengebrochen.
Aber die bekehrten Madi glauben nicht mehr an Geister und opfern nicht mehr den Ahnen. Sie sind dem großen Rubanga treu geblieben, dem Gott der weißen Väter. In bestimmten Nächten — jedoch nie an Sonntagen, um die arabischen Sudanesen irrezuführen — wird es in der Umgebung von Loa lebendig. Aus allen Himmelsrichtungen eilen die christlichen Madi herbei, um ohne Priester, allein auf sich selbst gestellt, eine heimliche Andacht abzuhalten.
Und sie haben nicht verlernt zu beten. „Amata bu a ree, nja rou kolo le...“ klingt es verhalten durch die nächtliche Stille des afrikanischen Busohes: das Vaterunser in der Sprache der Madi.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!