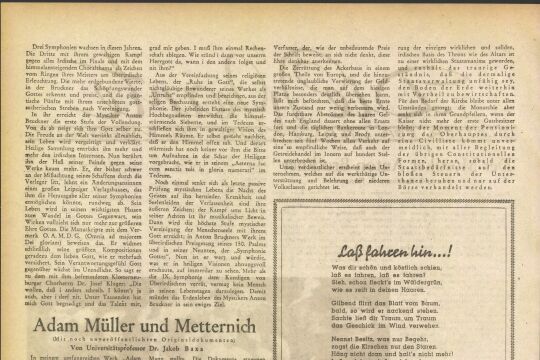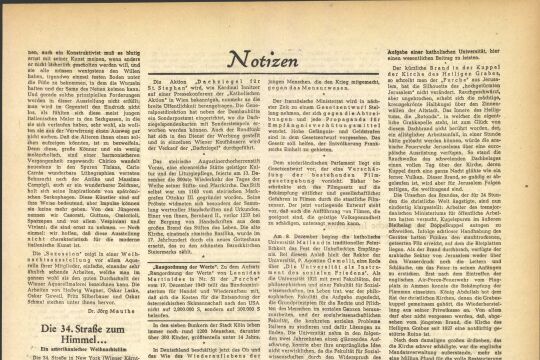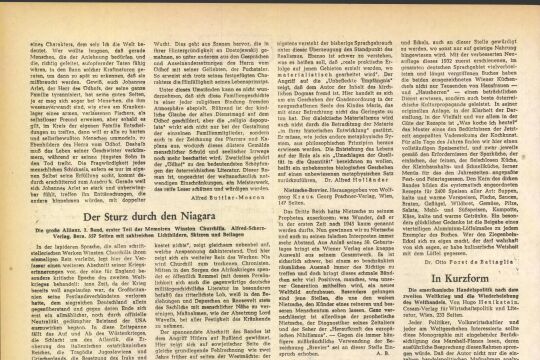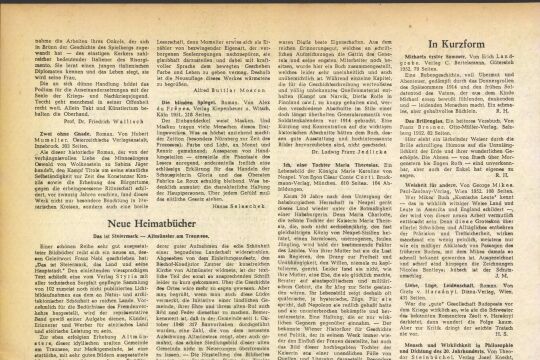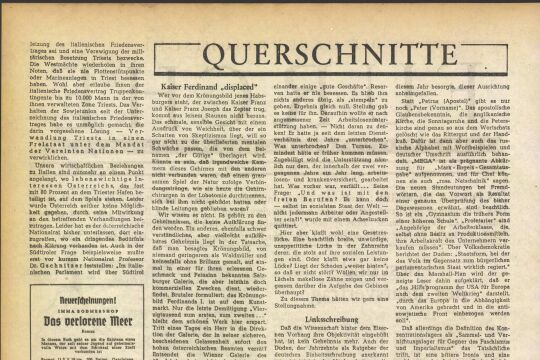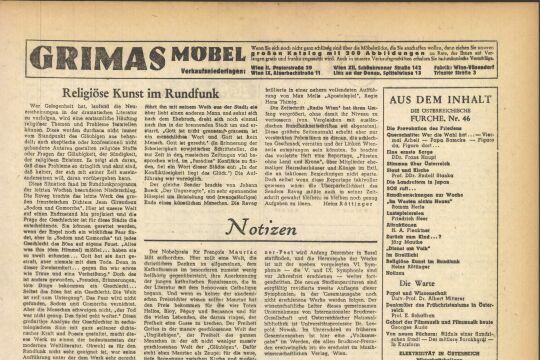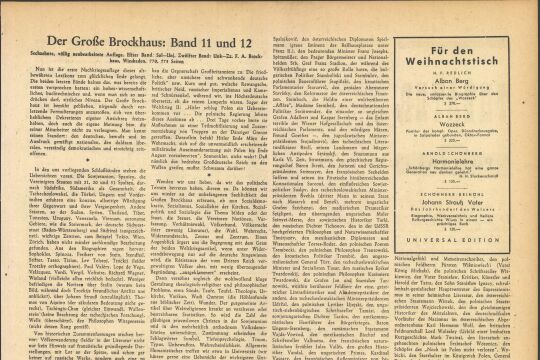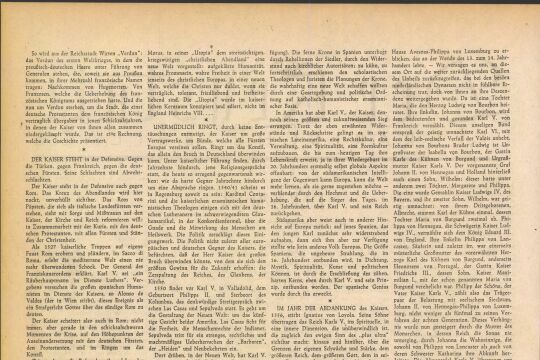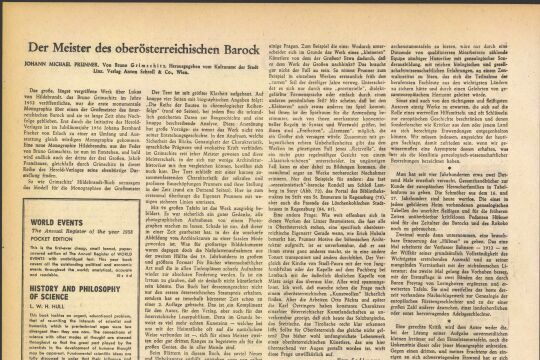Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das habsburgische Eigentum
Es ist daher nicht zu verwundern, wenn auch die sehr wichtige Frage nach dem Eigentumsrecht der Habsburger auf den Schmuck kurzweg energisch bestritten, aber nicht sachlich unterbaut wird. Es wäre wohl nicht zuviel verlangt, daß sich der Herausgeber über den Charakter der auch von ihm genannten Generalinventur des Jahres 1875 hätte informieren sollen. Ein Blick in die Geschichte der Sammlungen des Kunsthistorischen Museums von Alphons Lhotsky hätte dazu genügt: Festschrift des Kunsthistorischen Museums zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes. Zweiter Teil: Die Geschichte der Sammlungen, zweite Hälfte, Wien 1941 bis 1945, Seite 562 ff., besonders Seite 563, wo die Eingabe des kaiserlichen Schatzmeisters Quirin von Lettner an den Oberstkämmerer vom 27. März 1871 folgendermaßen zitiert wird: „Es erscheint im Interesse des kaiserlichen Eigentums, die Frage, und zwar, je eher, desto besser, festzustellen, um irrigen Ansichten und den daraus hervorgehenden Ansprüchen vorzubeugen, da sonst der Glaube genährt wird, daß der in der Schatzkammer aufbewahrte kaiserliche Schmuck, wie dies in den meisten europäischen Staaten der Fall ist, nicht frei verfügbares Eigentum des regierenden Hauses,
sondern Krongut sei.“ Es ist also hier haargenau das Gegenteil dessen gesagt, was der Herausgeber als Tatsache hinstellt. Auch die Formulierung Lhotskys auf Seite 564: „Als Ergebnis jahrelanger Untersuchungen wurde dem Kaiser endlich am 24. Jänner 1875 ein großer Vortrag erstattet, worin zunächst ausgeführt wird, daß der Habs- burg-Lothringische Hausschatz völlig unbestrittenes Privateigentum sei..hätte ihn immerhin zur Vorsicht mahnen müssen. Aus der Kenntnis dieser Generalinventur heraus wäre manches klarer darzustellen gewesen. Der Herausgeber hätte aber auch für die so wichtige Behauptung, daß die Sperrung des habsburgischen Privatvermögens in Österreich nur erfolgte, bis „der Familienschmuck aus der Schatzkammer, der bekanntlich im Aufträge des Exkaisers in die Schweiz gebracht wurde, zurückgestellt“ werde (Seite 10), stichhältigere Quellen auftreiberi müssen als das „Neue Wiener Journal“ vom 28. April 1920, von de,m er selbst zugibt, daß es „ein richtiges Tratschblatt gewesen sein mag“.
Die Frage aber, ob der Schmuck Privatvermögen war oder nicht, zu klären, müßte man wohl Juristen überlassen, die ihr Urteil auf exakten Unterlagen, wohl vor allem auf der Generalinventur von 1875 aufbauen würden. Immerhin geht aus dem vorliegenden Buch allein schon deutlich hervor, daß zum Beispiel die Ohrringe mit den Brillanttropfen von der Kaiserin Maria Theresia als ein Familiengedächtnis in der Schatzkammer hinterlegt wurden, daß ein mit Brillanten und Hyazinthen besetztes Zeichen des Ordens vom Goldenen Vliese von Kaiser Maximilian von Mexiko für den Kardinal-Erzbischof von Olmütz angeschafft wurde (Seite 92), der Rubinschmuck den Aufzeichnungen Sondheimers zufolge ein Hochzeitsgeschenk der kaiserlichen Familie für Marie Antoinette gewesen war (Seite 96) und das Rosenkollier ein Hochzeitsgeschenk der Herzogin von Lothringen an ihre Schwiegertochter Maria Theresia war (Seite 97). Das sind Beispiele, für die wohl kaum der Charakter eines Privatschmuckes angezweifelt werden kann.
Wofür wurde der Erlös verwendet?
Die Behauptung, der Florentiner sei toskanisches Staatseigentum gewesen, das „wie soundso vieler anderer Schmuck, eine hier von uns nicht näher zu untersuchende Transmutation in ein habsburgisch es Privatschmuckstück“ erfuhr (Seite 27), ist ebenso leichtfertig wie die Anmerkung auf Seite 64, daß neben Österreich auch die anderen Sukzessionsstaaten Regreßansprüche erheben könnten.
Man fragt sich wohl aiuch, wofür der sehr ansehnliche Erlös aus dem Verkauf der Juwelen verwendet wurde. Immerhin hätte er auf lange Zeit die kaiserliche Familie im Exil der finanziellen Sorgen entheben können. Dagegen wurde die todbringende Krankheit Kaiser Karls vor allem dadurch verursacht, daß man in Madeira nicht das Geld hatte, um im Hotel Zimmer zu mieten, die für den Winter ausreichenden Schutz geboten hätten. Ein Teil des Geldes wurde offenbar tatsächlich für die Restitutionsversuche in Ungarn verbraucht, in die sich Kaiser Karl in völliger Verkennung der Realität treiben ließ. Zum anderen Teil wurden damit Milchtransporte für die hungernde Bevölkerung Österreichs bezahlt — ob sie freilich tatsächlich an diese kamen?
Sondheimers „Unterlagen"
Schließlich müßte eine solche Edition auch die Frage nach der Originalität und nach dem Quellenwert der Memoiren stellen. Die Aufzeichnungen sind mit dem 1. März 1938 datiert, das heißt, sie sind von der Handlung selbst 17 Jahre entfernt. Exakte Unterlagen standen offenbar nicht zur Verfügung, da Sondheimer überhaupt keine genauen Zeitangaben machen kann, sondern nur solche über die ausgehandelten Preise. Daher sind die Aufzeichnungen, abgesehen davon, daß sich Sondheimer offensichtlich weniger eine objektive Schilderung als eine möglichst gute Darstellung seiner Tätigkeit in dieser sehr trüben Aktion zum Ziel setzte, in ihrer Bedeutung für eine Klarheit der letzten Phase der habsburgischen Juwelen nur mit vorsichtiger Zurückhaltung aufzunehmen. So kann zum Beispiel die Behauptung Sondheimers, daß alle ihm gezeigten Juwelen rote Lederfutterale hatten, nicht stimmen, da von einem Teil dieser Juwelen die Futterale in der Schatzkammer zurückgeblieben sind und heute noch dort verwahrt werden; nicht alle sind übrigens aus rotem Leder, sondern manche auch aus anderem und andersfarbigem Material. Es dürfte daher doch die Geschichte von der „Flucht“ des Schatzes in einer Reisetasche stimmen, gegenüber der Behauptung des Herausgebers, es müßten doch mehrere Koffer gewesen sein (Seite 16). Diese Nachricht von der Verbringung des Schmuckes in einer einzelnen einfachen Reisetasche wurde dem Verfasser dieses Aufsatzes übrigens auch vom Sohn eines hohen Beamten bestätigt, der in Wien Augenzeuge der Flucht war und später seinem Sohn davon erzählte.
Merkwürdig wirken aber auch die außerordentlich ungenauen, ja bisweilen primitiven Angaben über die Juwelen. Von einem Juwelenhändlei großen Stiles wäre doch zu erwarten, daß er den Ausdruck „Brillant“ nicht wahllos für Brillanten, Rauter und Diamanten verwendet. Auch die Schilderung des „kleinen Goldschmiedes“, den er für das Ausbrechen der Steine aus den Fassungen heranzog, und seiner Werkzeuge mutet recht dilettantisch an. Warer vielleicht die Erinnerungen Sondheimers gar nicht in deutscher Sprache abgefaßt? Man würde von einem Mann, der sich Alphonse de Sondheimer nennt, der vor allem in Den Haag und in London lebte, eigentlich nicht unbedingt den Gebrauch der deutschen Sprache für die erste Niederschrift seiner Memoiren erwarten. Übrigens fragt man sich bei dieser Gelegenheit, warum sich der Herausgeber bemüßigt fühlt, auf Seite 91 in einer Fußnote zu erläutern, daß der Wappenkönig des Ordens vom Goldenen Vliese le Toison d’or genannt wird, der Orden selbst aber la Toison d’or heißt. Der deutsche Text allerdings gibt dazu jedooh nur geringen Anlaß.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!