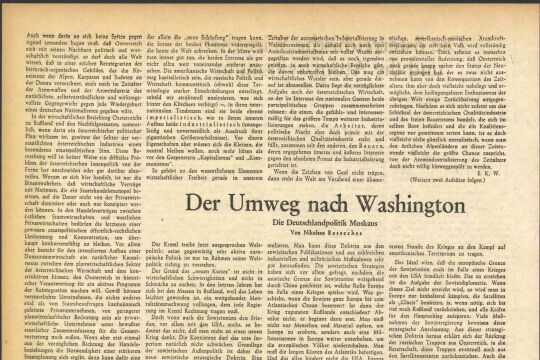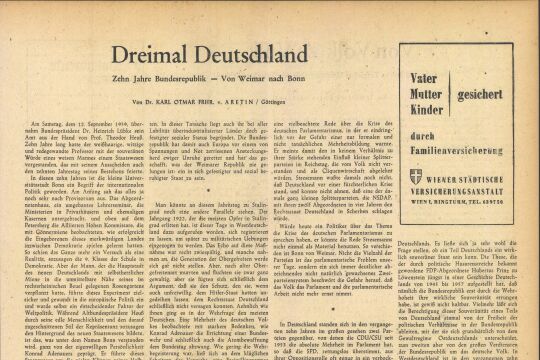Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der 17. Juni und „die Plebejer
Ein nationaler Gedenktag, dessen geschichtliche Tragik immer wieder die Menschen im Innersten aufwühlt, ist der 17. Juni nicht geworden. Gewiß ist 'die Erinnerung an den ostdeutschen Aufstand vom Jahre 1953 überall intensiv lebendig. Aber schon seit Jahren ist hier und da die
Frage aufgetaucht, ob es angebracht sei, an diesem Tag zu „feiern“. Vielfach wurde nämlich der 17. Juni als ein „freier“ Tag genommen, der zum Ausspannen benutzt wurde. Das Gedenken an den Aufstand der Deutschen in der Zone und sein tragisches Ende kam dabei fraglos manchmal zükurz.
Demgegenüber hat das Kuratorium „Unteilbares Deutschland“ versucht, dem Tag einen tiefgehenden Sinngehalt und dynamische Kraft zu verleihen.
Aber der Tag erhielt trotz allem nicht die Wucht einer natioanlen Demonstration. Doch hat dies auch seine positive Seite. Wäre dieser deutsche Gedenktag jedes Jahr zu einer machtvollen, aufbäumenden Kundgebung gegen die Spaltung und für die Wiedervereinigung geworden, das Echo im Ausland wäre vermutlich wenig günstig gewesen. Man hätte jenseits der deutschen Grenzen sicher daraus abgeleitet, daß in der Tat der Furor teutonicus und der deutsche „Revanchismus“, von dem die kommunistische Propaganda so viel redet, ungebrochen am Werke seien.
Wandel der Gefühle
Hier verrät sich die Zwiespältigkeit, die dem Gedenktag des 17. Juni innewohnt. Damit bildet er zugleich in vielfacher Hinsicht ein Abbild der Stimmung in der westdeutschen Bevölkerung. Man urteilt falsch, wenn man sich, wie dies namentlich im Ausland oft geschieht, die Meinung zulegt, die Deutschen seien an der Wiedervereinigung wenig, wenn überhaupt noch interessiert. Diese Ansicht findet man in westlichen Ländern nicht allein beim
Mann auf der Straße, sondern auch in den Ämtern der Regierungen. Sie beruht jedoch auf oberflächlicher Beurteilung. Die Wiedervereinigung ist für die breite Öffentlichkeit Westdeutschlands noch immer das Thema, das zu jeder Zeit auf der Tagesordnung steht. Man verfährt zwar nicht
nach dem Grundsatz: Nicht davon reden, immer daran denken — wohl aber bietet die deutsche Öffentlichkeit praktisch dieses Bild.
Das Thema Wiedervereinigung wird jedoch nicht mehr mit der vorwärts- stürmenden Leidenschaft der beginnenden fünfziger Jahre erörtert. Und das hat einen einfachen Grund. Man kennt inzwischen in Deutschland die sowjetische Deutschlandpolitik etwas genauer, obwohl sie schon seit dem Ausgang der vierziger Jahre offen zu Tag gelegen ist. Man hat nicht mehr die Illusionen von einst. Statt dessen hat sich eine gewisse Resignation ausgebreitet. Diese Resignation bedeutet nicht endgültigen Verzicht. Sie ist jedoch Ausfluß der Einsicht, daß es bis zur Wiedervereinigung noch ein langer Weg und daß für heute und morgen überhaupt kein Punkt zu erkennen ist, an dem die deutsche Politik in Moskau ansetzen könnte.
Vor einem Dutzend Jahren hat die Einschätzung der sowjetischen Deutschlandpolitik noch erheblich geschwankt. Es sei daran erinnert, daß die SPD noch vor nicht allzuvielen Jahren einen Plan für eine Deutschlandpolitik aufbrachte, von dem sie inzwischen ohne Rücksicht auf Verluste entschieden abgerückt ist. Dieser Plan wurde vorgelegt zu einem Zeitpunkt, da noch manche Kreise bis ins Regierungslager hinein der Meinung waren, der Wiedervereinigung käme man bestimmt näher, wenn es nur erst gelänge, ein Gespräch mit dem Kreml einzufädeln — und daß dies nicht geschah, wurde der Einfallslosigkeit, der mangelnden Initiative und Durchschlagskraft, ja sogar bösem Willen der Bundesregierung zugeschrieben.
Wiedervereinigung in weiter Ferne
Heute gibt man sich dergleichen Illusionen nirgends mehr hin. Es hat sich eine andere Betrachtung der deutschen Frage durchgesetzt, die natürlich sehr differenziert ist, jedoch sich in einigen Hauptpunkten zusammenfassen läßt. Was die große Politik angeht, so ist sich die deutsche Öffentlichkeit wohl darin einig, daß das Zustandekommen der Wiedervereinigung in erster Linie, um nicht zu sagen ausschließlich vom Ja oder Nein Moskaus abhängt, daß Moskau jedoch nur ja sagt, wenn Ulbricht und seine Kommunisten als gleichberechtigte Partner in das Geschäft aufgenommen werden. Deshalb verfolgt man in der deutschen Öffentlichkeit wohl mit Interesse die Diskussionen über die Schaffung
111VJ1. 11CU11 G1C11 ZuUllc, VII VV Ulli
lächteverantwortung, die Be- lühungen um ein Gespräch Erhards lit Kossygin, die Erklärungen in lonn und Moskau, man wünsche ute Beziehungen zueinander — her kaum jemand in Westdeutschmd verspricht sich davon, daß die Wiedervereinigung in absehbarer leit in ernst zu nehmender Weise läherrückt.
licht mehr dieselbe Sprache
Anderseits sieht man die innerdeutsche Entwicklung mit Sorge. Es st gewiß kein Symptom, daß diesmal nicht alle Westberliner, die Pas- ierscheine beantragt hatten, davon Jebrauch machten. Doch unabhän- liig davon stellt sich vielfach das
quälende Gefühl ein, daß in West- und Ostdeutschland nicht mehr ganz die gleiche Sprache gesprochen werde. Dies gilt nicht allein in bezug auf die sowjetzonalen Funktionäre aller Parteien, sondern ganz allgemein. Offensichtlich bildet sich eine Art „Zonenbewußtsein“ heraus, das nicht mit dem üblichen Staatsbewußtsein identisch, wohl aber Ausdruck der Genugtuung ist, trotz aller Widrigkeiten und trotz des kommunistischen Regimes es doch , auch zu etwas gebracht zu haben. Hinzu kommt, daß die Kirchen zwar weiterhin dem Regime grundsatzfest gegenüberstehen, doch sind die Verhältnisse anders gelagert als etwa in Polen.
So gibt es offensichtlich in der Zone kein offenes oder heimliches Zentrum, um das sich die Meinungsund Willensbildung der Bevölkerung scharen könnte. Im übrigen besagen alle Nachrichten aus Ostdeutschland, daß sich die Bevölkerung von den Gesprächen zwischen SPD und SED nicht viel erwartet.
Sie ist gewiß — vor allem in den ersten Tagen — durch das sich anbahnende Gespräch tief erregt gewesen. Aber inzwischen hat sich, wenn nicht alles täuscht, mehr und mehr die Meinung herausgebildet: „Es hat ja doch keinen Zweck“ — also auch hier Resignation gegenüber der Unbeugsamkeit und Unnachgiebigkeit des Regimes, wenn auch keine Preisgabe des Anliegens der Wiedervereinigung.
Kleine Brücken und Stege
Unter diesen Umständen bleibt das Bemühen um die menschlichen Kontakte der Punkt, auf den sich viele Hoffnungen konzentrieren. Die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik wird immer wieder aufgerufen, noch mehr Pakete in die Zone zu schik- ken, noch mehr Reisen in die Zone zu beantragen. Die Bundesregierung hat sich zum Zeitungsaustausch bereiterklärt, auch auf die Gefahr hin, daß die westdeutschen Zeitungen die Zonenbevölkerung nicht erreichen. Der Austausch von Theateraufführungen sowie Konzertreisen, nehmen immer größeren Umfang an. Es pendelt sich alles ein, so gut es eben geht. Aber im Grunde ist jedermann jederzeit gegenwärtig, daß auch die Existenz dieser kleinen
Brückchen und Stege, die über di Demarkationslinie hinweg geschlagen werden, allein von dem jeweiligen politischen Kalkül Pankows abhängt, das sie heute voller Gnade gewähren und morgen unerbittlich verbieten kann.
Das Schicksal des Gedenktages und der deutschen Frage ist gleichsam in einem Szenenbild zusammengerafft, wenn man das Echo auf Grass’ „Die Plebejer proben den Aufstand“ überblickt. Das Stück war für die deutsche Öffentlichkeit kein Alarmsignal, an dem sich Emotionen gegen das nationale und soziale Schicksal entzündet hätten. Kein Freiheitsdrama und kein sozialer Aufschrei. Es wirkte weder wie „Figaros Hochzeit“ noch wie die „Hermannsschlacht“ oder „Nabucco“. In der Diskussion über das Stück spielte Brecht eher die Hauptrolle als die Arbeiter, die zum Aufstand entflammt waren. Die literarische Bedeutung des Stücks — das war beinahe das Hauptthema der Diskussion. Der 17. Juni wird daher weiterhin ein leidvolles Datum für die Deutschen bleiben, aber in absehbarer Zeit kaum das Symbol eines Tages, an dem „die Plebejer“ erneut antreten, um in einem Aufstand ihr Schicksal zu wenden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!