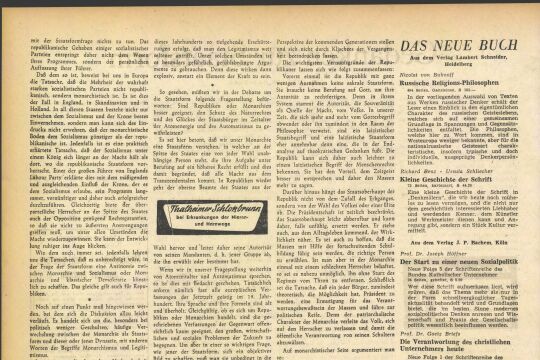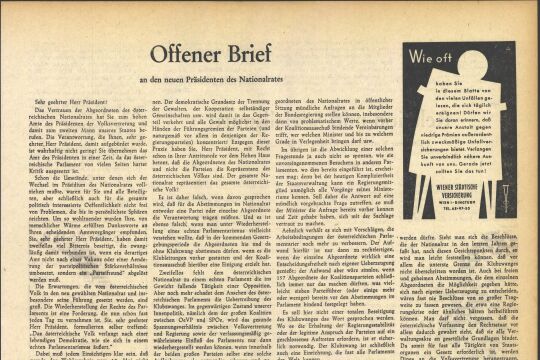Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der erste Mann in der Republik
Nur noch kurze Zeit trennt uns von einer wichtigen Wahlentscheidung: Sonntag abend wird Österreich wissen, wie das nächste Staatsoberhaupt der Republik heißt, wenn auch der gewählte Kandidat verfas-sungsgemäß sein Amt erst nach der Angelobung durch die Bundesversammlung antritt. Mit dem Wahltag geht auch die mehrwöchige Wahlwerbung zu Ende, deren Verlauf — sagen wir es ehrlich — in mancher Beziehung denkenden Staatsbürgern geradezu Greuel bereitete: Da müssen sich zwei achtbare Politiker durch Österreich durchredeo, mit Erstkommunikanten oder ältesten Dorfbewohnern photo-graphieren lassen, Hände schütteln und allenfalls sogar Busserln verteilen; das Schlimmste müßte es aber wohl für jeden von ihnen sein, am nächsten Tag die hymnischen Schilderungen der eigenen Partei-presse zu lesen, sofern ein Kandidat überhaupt dazu Zeit findet und außerdem sich noch einen Funken Selbstkritik bswahrt hat!
Daß eine Volkswahl des Staatsoberhauptes :n der modernen Demokratie solche Erscheinungen geradezu zwangsläufig mit sich bringt, kann man freilich nicht nur am Beispiel Österreichs studieren. Die Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vollzieht sich unter durchaus gleichartigen Begleitumständen und auf keinesfalls höherem Niveau. Warum wir Österreicher unser Staatsoberhaupt durch direkte Volkswahl bestellen, läßt sich nur aus der Verfassungsgeschichte unserer Republik erklären.
Als 1918 nach dem totalen Zusammenbruch die Republik Österreich erstand, mußte die innere Ordnung dieses neuen Staates von Grund aus konzipiert werden. Aber in den Jahren drückender Not und Unsicherheit wurden keine bahnbrechenden staatsrechtlichen Ideen geboren: Die Bundesverfassung vom Oktober 1920 setzte praktisch an die Stelle des Herrschers die Volksvertretung; wie früher der Monarch war nun der Nationalrat unabsetzbar, das heißt unauflöslich; und ebenso wie früher der Monarch die Regierung einsetzte, so wunde sie nun vom Nationalrat gewählt. Die Republik Österreich war also der extreme Typus einer parlamentarischen Demokratie, in welcher der Bundespräsident als Staatsoberhaupt praktisch nur Repräsentationsfunk-tionen auszuüben hatte.
Erst durch die zweite Bundesverfassungsnovelle vom Dezember 1929 wurde die Stellung des Bundespräsidenten derart ausgestaltet, daß — wie der Bericht des Verfassungsausschusses ausdrücklich vermerkt — Österreich damit zu einer parlamen-
tarischen Präsidentschaf tsrepublik wurde. Der Bundespräsident erhielt durch diese Verfassungsreform neue und bedeutende Vollmachten, darunter vor allem die Befugnis, die Regierung zu ernennen und zu entlassen, den Nationalrat aufzulösen, ihn zu Tagungen einzuberufen und die Tagungen auf Grund eines Beschlusses des Nationalrates als beendet zu erklären. Gleichzeitig mit dieser entscheidenden Stärkung der Stellung des Bundespräsidenten wurde seine Wahl unmittelbar durch das Volk in der Verfassung verankert. Offensichtlich wollte man dadurch zum Ausdruck bringen, daß ein Staatsoberhaupt mit derartigen Vollmachten in einer Demokratie eine gleich starke Legitimation aufweisen müsse wie die Volksvertretung: nämlich die direkte Wahl durch das Bundesvplk.
So plausibel nun auch diese geschichtliche Erklärung ist, kann man doch nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, daß die gegenwärtige Art der Bestellung des Staatsoberhauptes unserer Republik große Nachteile in sich birgt; und zwar nicht nur die eingangs erwähnten, sicherlich für viele Staatsbür-ber abstoßenden Begleiterscheinungen des Werbeos um die Gunst der Wähler. Als beispielsweise knapp nach Bekanntgabe der Kandidatur des Altbundeskanzlers Dr. Gorbach ein hoher Funktionär der österreichischen Volkspartei gefragt wurde, ob nicht die seinerzeitige, eher unsanfte Ablösung Dr. Gorbachs vom Amt des Parteiobmannes sowie später des Bundeskanzlers ein Nachteil sei und warum die ÖVP nicht einen über die eigenen Parteigrenzen hinaus angesehenen, sehr klugen Spitzenpolitiker aus ihren Reihen nominiert habe — sein Name tut hier nichts zur Sache —, antwortete der Befragte: Das wäre ein typischer Kandidat für eine Wahl in der Bundesversammlung gewesen, nicht aber für eine Volkswahl!
Dieser Ausspruch ist treffend und stimmt zugleich nachdenklich. Abgesehen davon, daß also offenbar die Eigenschaften einer plebiszitär erwählten Politikerpersönlichkeit grundverschieden sind von denen eines Politikers, auf dessen Betrauung mit dem Amt des Staatsoberhauptes sich die maßgeblichen Parteien einigen könnten, drängt sich folgende Überlegung auf: Gelingt es in der Bundesversammlung, einen Kandidaten zu finden, für den alle oder wenigstens eine große Mehrheit der Mitglieder die Stimme abgeben, so bekommt Österreich ein Staatsoberhaupt nach dem Willen mehrerer Parteien und damit voraussichtlich auch nach dem Willen der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung. Hingegen kann aus der Volkswahl immer nur ein Kandidat als Sieger hervorgehen, gegen den eine große Anzahl von Staatsbürgern votiert hat. Dies ist bei der bevorstehenden Wahl sogar mehr denn je zu erwarten, da alle Auguren ein sehr knappes Wahlresultat voraussagen. An die Stelle der Möglichkeit, durch die Bundesversammlung ein Staatsoberhaupt des „sowohl als auch“ zu erwählen — nämlich einen Politiker, der sowohl dieser als auch jener Partei für das hohe Amt geeignet erscheint —, tritt durch die Volkswahl die Kandidatur des „entweder — oder“. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die Anhänger kleinerer Parteien — wie zum
Beispiel der Kommunistischen Partei Österreichs oder der Freiheitlichen Partei Österreichs — meistens den einen oder anderen Kandidaten unterstützen. Denn die Entscheidung des „entweder — oder“ liegt naturgemäß in jeder Demokratie zwischen großen Parteien, die knapp an die Mehrheit heranreichen und denen gegenüber politische Splittergruppen eben nur die eine oder andere Hilfestellung einnehmen können.
Nun soll man freilich in der modernen Demokratie mit Parteizugehörigkeit und Überparteilichkeit nicht Demagogie betreiben. Peinlichst war dies leider bei der letzten Bundespräsidentenwahl im April 1963 der Fall, als krampfhaft „anscheinend parteiunabhängige“ Komitees die Wahl Dr. Schärfs beziehungsweise Ing. Raabs empfahlen. Das bedeutete sowohl aus dem Grund eine Zumutung, weil kaum ein interessierter Staatsbürger vergessen hatte, daß jeder der beiden Kandidaten durch lange Jahre Obmann seiner Partei gewesen ist, als auch aus dem Grund, weil es für politisch mündige Staatsbürger ziemlich irrelevant ist, ob zum Beispiel ein angesehener Fachmann für Haut- und Geschlechtskrankheiten oder ein bekannter Kinderpädagoge diesen oder jenen Kandidaten für besser qualifiziert hält, die Funktionen des Staatsoberhauptes auszuüben. Wer erinnert sich hier nicht an die Ausführungen Ortega y Gassets im „Aufstand der Massen“. „ ... Früher konnte man die Menschen einfach in Wissende und Un-
wissende, In mehr oder weniger Wissende und mehr oder weniger Unwissende einteilen. Aber der Spezialist läßt sich in keiner der beiden Kategorien unterbringen. Er ist nicht gebildet, denn er kümmert sich um nichts, was nicht in sein Fach schlägt; aber er ist auch nicht ungebildet, denn er ist ein Mann der Wissenschaft und weiß in seinem Weltausschnitt glänzend Bescheid. Wir werden ihn einen gelehrten Ignoranten nennen müssen, und das ist eine überaus ernste Angelegenheit; denn es besagt, daß er sich in allen Fragen, von denen er nichts versteht, mit der ganzen Anmaßung eines Mannes aufführen wird, der in seinem Spezialgebiet eine Autorität ist. Tatsächlich ist hiermit das Gebaren des Fachgelehrten gekennzeichnet. In den anderen Wissenschaften, in Politik, Kunst, sozialen Angelegenheiten, hat er die Ansichten eines Wilden, eines hoffnungslosen Stümpers, aber er verteidigt sie mit Nachdruck und Selbstvertrauen, ohne Rücksicht — und das ist das Widersinnige — auf die dort zuständigen Fachleute.“
Getarnte Parteipolitik und verlogene Uberparteilichkeit sind die größten Gefahren gerade für einen Staat, der erst darangehen muß, eine demokratische Tradition zu entwik-keln. Niemand geringerer als der bekannte Rechtsgelehrte Gustav Radbruch warnte bereits 1930: „Die Überparteilichkeilt der Regierung war geradezu die Legende, die Lebenslüge des Obrigkeitsstaates.“ Weder Politiker noch Beamte sind „im
Dienst“ andere Menschen als „privat“. Sie haben ihre persönlichen Fähigkeiten, ihren spezifischen Charakter, Interessen, Neigungen usw.; aber was sie „im Dienst“ tun, darf eben nicht (nur) durch ihre persönlichen Eigenschaften bestimmt werden, sondern vor allem von den Pflichten zu Staatstreue, Gesetzesgehorsam, zu strenger Sachlichkeit und Unbestechlichkeit sowie zum Absehen vom Wohl seiner selbst und seiner Freunde zugunsten des öffentlichen Wohles!
Aus dieser Sicht und nur in diesem Sinn kann ein „Standpunkt über den Parteien“ in der modernen Demokratie glaubhaft sein. Der Staat als Gemeinschaft seiner Bürger ist nicht faktisch höher als die in den politischen Parteien gruppierten Staatsbürger, er ist nicht besser, wahrer oder dergleichen, sondern er ist in erster Linie die höhere Aufgabe! Wer sich aber gar zur Kandidatur um das Amt des Staatsoberhauptes entschließt, der bewirbt sich um die höchste Aufgabe in unserer staatlichen Gemeinschaft. Er kann kaum vor seiner Wahl, aber er wird nach seiner Wahl den „Standpunkt über den Parteien“ glaubhaft zu machen haben. Den bisher aus den Volkswahlen hervorgegangenen Bundespräsidenten unserer Republik ist dies nach allgemeiner Auffassung bisher bestens gelungen. Möge es auch jenem Kandidaten gelingen, der nun schon in kurzer Zeit wissen wird, daß ihn das österreichische Volk zum höchsten Amt im Staats berufen hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!