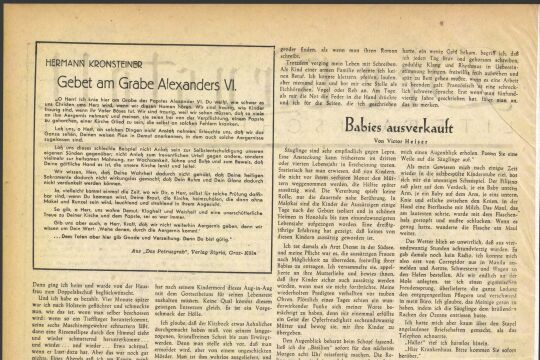WIE EINE GEHÄSSIGE SATIRE KLINGT diese Geschichte aus dem Wohlfahrtsstaat Schweden: dort mußte ein neu errichtetes Krankenhaus, das dringendst gebraucht wurde, wiedergeschlossen werden, weil dazu die nötigen Krankenschwestern fehlten.
Aber auch in Österreich hat sich, wie jetzt erst bekannt wurde, vor kurzem derartiges ereignet. In Dorn-' birn mußte ein Infektionsspital geschlossen werden, weil das nötige Pflegepersonal fehlte.
WORAN LIEGT ES? Mehr Lohn, weniger Arbeitszeit sind heute politische Programme. Auf das Stichwort „Krankenschwester“ aber reagiert man noch immer mit „Ideal“ und „Berufung“. Der Gedanke, daß es angebracht wäre, statt Pathos und schmerzlicher Enttäuschung Taten zu setzen und auch den sozialsten Frauenberuf an unserer gepriesenen Über-sozialisierung teilhaben zu lassen — der Gedanke kam den Verantwortlichen nicht. Bisher zumindest nicht.
Im April des vorigen Jahres wurde zwar vom Nationalrat das neue Krankenpflegegesetz — das sich hauptsächlich mit der Ausbildung beschäftigt — beschlossen, und einen Monat später wurden sogar die Gehälter der Krankenschwestern erhöht. Beides haben die Pflegerinnen seit langem gefordert. Aber reichen die relativ geringfügigen Reformen wirklich aus, um den größten Mangelberuf wieder attraktiv und konkurrenzfähig zu machen?
HARTE ARBEIT UND SCHLECHTE BEZAHLUNG: dies wissen alle Mädchen, bevor sie in die Krankenpflegerinnenschule gehen, und dennoch lassen sie sich nicht davon abschrecken. Was sie aber nicht aushalten oder ausgehalten haben ist der Betrieb im Spital und in der Schwesternschule gewesen, der halb kasernenharte Status, der viele Krankenpflegerinnen seelisch und körperlich mehr angriff als der eigentliche Dienst. Um es hart zu sagen: der Krankenpflegeberuf in der heutigen Form ist ein Anachronismus.
Schon die Ausbildungszeit ist hart, und fast 50 Prozent der Schülerinnen werfen schon vor ihrer Diplomierung die Flinte ins Korn. Drei Jahre kaserniert zu leben — wie Rekruten —, ist heute nicht mehr durchführbar. Bis auf eine einzige Ausnahme aber sind noch alle Schwesternschulen als Internatsbetrieb geführt, in denen Freizeit,Ausgang und Urlaub karg bemessen und von übergeordneten Stellen geregelt werden.
Das Studiumpensum ist beachtlich: 18 Gegenstände, darunter Anatomie. Pathologie, Hygiene, Krankenpflege, administrativer Spitalsdienst und Gesetzeskunde werden vorgetragen und geprüft, dazu kommt schon ab dem dritten Ausbildungsmonat aktiver Spitalsdienst, auch nachts. Und am nächsten Morgen geht der Unterricht weiter, ungeachtet, ob der übermüdeten Schülerin nun die schlaftrunkenen Augen zufallen.
Nach dem zweiten Schuljahr steht die erste Staatsprüfung, nach dem dritten die zweite und das ersehnte Diplom auf dem Schulprogramm. Ein Anfangsgehalt (Grundgehalt) von 1460 Schilling brutto bekommt die frisch diplomierte Schwester, fast ge-genauso viel erhält auch eine Bedienerin, die pünktlich bei Dienstschluß ihren Besen in die Ecke stellt.
SCHWESTER ODER ÄRZTIN? Das ist oft die große Frage. Es sind 24 Stunden, in denen Injektionen zu geben, frisch Operierte zu versorgen, Betten zu machen, Mahlzeiten zu reichen sind, 24 Stunden, in denen die Schwestern im wahrsten Sinne des Wortes „auf den Beinen“ sind. Und keinen Augenblick lang müde sein oder an etwas anderes als an die Krankenpflege denken dürfen. Die große Hast, der Personalmangel, der in den Spitälern herrscht, bringt es auch mit sich, daß die Schwestern selbst die Ampullen aufziehen und die Spritzen geben müssen, eine Arbeit, die „eigentlich“ dem Arzt vorbehalten ist. Freilich gibt es kaum in einem Wiener Spital einen Arzt, der selbst die Zeit dazu findet. Teils haben die Ärzte Vertrauen, teils geschieht es auch der Not gehorchend, daß dies alles die Schwester machen muß. obwohl sie bei ihrem Eintritt in den Pflegedienst ein Formular unterschreiben muß, in dem sie sich verpflichtet, keine Ampullen aufzuziehen oder Spritzen zu geben. Und dennoch muß sie es tun. Die Verantwortung, die sie damit übernimmt, ist beträchtlich, denn auf jeder Station werden unzählige verschiedenartige Präparate verwendet.
Wenn aber eine Schwester versagt, so kommt es zu einer Katastrophe, die ein oder mehrere Menschenleben kosten kann. Und der Staatsanwalt, der sich auf den Paragraphen 335 beruft, kümmert sich nicht um Übermüdung oder Sorgen der Schuldigen. Er kann es auch gar nicht mehr, nachher.
Vorher müßte etwas geschehen. Ehe es so weit kommt, daß Krankenschwestern zusammenbrechen und grenzenloses Unglück damit stiften. Aber die dafür verantwortlichen Stellen haben bisher nichts oder nur wenig unternommen, um den schwersten Frauenberuf zum gepriesenen „schönsten“ zu machen. Für viele sind Krankenschwestern blau-weiß gestreifte Aschenbrödel, die kaum einer Betreuung bedürfen, kaum einer „Investition“. Und die trotzdem unentwegt auf „Hochtouren laufen“. Die sich ein Menschenleben lang für andere aufopfern und nicht den kleinsten bescheidenen Wunsch für ihr eigenes „Ich“ haben dürfen.
AUCH DAS PRIVATLEBEN DER SCHWESTER, das Leben außer Haus wird beobachtet, und es ist keine Seltenheit, daß eine Schwester wegen allzu häufiger Ausgänge oder modisch eleganter Kleidung eine Rüge einstecken muß. Nicht jede erwachsene Frau, der in ihrem Beruf Menschenleben anvertraut werden, liebt es, in ihrer Freizeit überwacht zu werden wie ein kleines Mädchen. Noch strenger ist die Disziplin in den internen Krankenpflegerinnenschulen. So geschah es, daß eine verheiratete Schülerin sich von ihrem Sohn eine Bestätigung schreiben lassen mußte, daß sie ihren Ausgang tatsächlich in seiner Gesellschaft verbracht hatte.
Sogar in der Art ihres Weiterkommens sind die Schwestern sehr oft behindert. Sie können sich beispielsweise nicht selbst die Station, ja nicht einmal das Spital aussuchen, in dem sie arbeiten wollen, sondern sie werden ungefragt dorthin versetzt, wo sie gerade gebraucht werden. Eine Pflegerin, die etwa auf einer chirurgischen Station arbeitet und gern einmal Operationsschwester werden möchte, kann sich nach ihrem Urlaub unvermutet auf einer Lungenstation wiederfinden.
Die Posten einer Operations-, Narkose- oder Lehrschwester werden nicht etwa ausgeschrieben und die Bewerberinnen in Kursen dafür geschult und anschließend geprüft, sondern geeignete Schwestern werden für solche Spezialsteilungen von ihren Vorgesetzten ausgesucht und angelernt. Die Möglichkeit, einer jeden Schwester höhere Fachausbildung zugänglich zu machen, „unabhängig vom Dienstalter oder der Protektion“, ist denn auch eine Hauptforderung, die viele S:hwestern-vereinigungen — bisher freilich vergebens — gestellt haben.
Bei der Urlaubseinteilung — die Termine können in vielen Fällen tatsächlich erst im letzten Monat bekannt gegeben werden, so daß es oft sehr schwer ist, noch irgendwelche Dispositionen zu treffen — wird nicht die geringste Rücksicht darauf genommen, ob eine Schwester verheiratet ist und vielleicht ein paar freie Wochen im Jahr mit ihrem Mann gemeinsam verbringen will.
Ledige Schwestern, die im Spital wohnen können, kommen in Zweioder Dreibettzimmer, in denen der „Raditurnus“ ständige Unruhe garantiert. Auch wenn etliche Räume leerstehen, gilt dieser Plan, drei Mädchen pro Zimmer.
„MODETORHEITEN“ WERDEN GRUNDSÄTZLICH ABGELEHNT. Wagt ein junges Mädchen den Wunsch
zu äußern, den fast knöchellangen klinikeigenen Kittel zu kürzen, heißt es entrüstet: „Aber, Schwester, das ist doch eine Tracht!“ Es mag vielleicht lächerlich klingen, da, wo es um Krankheit und Tod geht, um Aufopferung und ständigen Einsatz, auch von Lappalien zu reden. Aber gerade diese Kleinigkeiten machen den Schwestern das Leben erfreulicher. Kleinigkeiten, auf die die Krankenschwestern verzichten müssen, wenn sie das unkleidsame, steif gestärkte Häubchen aufsetzen: Sie dürfen weder gepudert noch mit gefärbten Lippen zum Dienst kommen, sie dürfen nicht einmal die Nägel mit farblosem Lack lackieren,keinen Schmuck tragen. Nichts! Außer der Silberbrosche, die sie bei ihrer Diplomierung erhalten. Auf der Brosche, die die Schwestern im Wiener Allgemeinen Krankenhaus bekommen, steht: „Saluti et Solatio Aegrorum“ — „Zum Wohl und Heil der Kranken“. Dieser Spruch steht aber nicht nur auf der ovalen Silberbrosche. Er steht tatsächlich auch über dem Leben der Frauen und Mädchen, die sich vom Augenblick des Eintritts in den Spitalsdienst nicht mehr selbst gehören.
60 BIS 70 STUNDEN WOCHENDIENST sind für die Schwestern keine Seltenheit, eine 48-Stunden-Woche kennen sie nur vom Hörensagen. Und Schwestern, die im sogenannten „Fünferradi“ Dienst tun können werden in der Branche als richtige Glückspilze bezeichnet.
Das „Fünferradi“ bedeutet: Erster Tag: Dienst von 6 bis 19 Uhr (Beidienst). Zweiter Tag: Dienst von 7 bis 19 Uhr (Hauptdienst). Dritter Tag: Dienst von 19 bis 7 Uhr (Nachtdienst). Vierter Tag: Schlaftag. Fünfter Tag: Frei.
Aber meistens wird aus dem freien Tag nichts, da fast alle Stationen mit zu wenig Personal besetzt sind, da heißt es dann am fünften Tag — wieder Beidienst machen. Im Hauptdienst muß die Schwester Spritzen geben und an Arztvisiten teilnehmen. Im Beidienst werden die verordneten Therapien verabreicht. Es müssen für die Patienten Umschläge, Einlaufe, Thermophore und Verbände gemacht werden. In der Zwischenzeit hilft dann der Hauptdienst dem Beidienst beim Herrichten der Medikamente, die im Tag dreimal ausgeteilt werden sollen. Aber neben der rein pflegerischen Arbeit müssen auch die Ampullen ausgekocht und die Bettwäsche gereinigt werden. Die Leibschüsseln müssen gewechselt sowie gespült werden. Und ist dies alles getan, dann ist noch die administrative Arbeit da, die die Schwester zu erledigen hat.
SCHULD AN DEM ÜBERMÄSSIGEN MANGEL an Krankenschwestern ist gewiß keiner dieser einzelnen Nachteile — aber alle zusammen sind mindestens ebenso schuld daran wie die schlechte Bezahlung und die viele Arbeit.
Viele der einstigen Patienten senden den Schwestern nach ihrer Entlassung Grußkarten und danken ihnen für die liebevolle Pflece die ihnen die Schwestern haben angedeihen lassen, denn unsere Pflegerinnen haben sich trotz der schweren und verhältnismäßig vielen Arbeit ein mitfühlendes Herz bewahrt.
GIBT ES ETWAS SCHÖNERES als Frauen, die sich trotz ihrer harten Arbeit das mitfühlende Herz bewahrt haben? Wäre es nicht an der Zeit, unseren Schwestern, die wie kleine Heinzelmännchen ungesehen und unbemerkt von der Öffentlichkeit wirken und unermüdlich hilflose Menschen betreuen, mehr Anerkennung zu zollen?