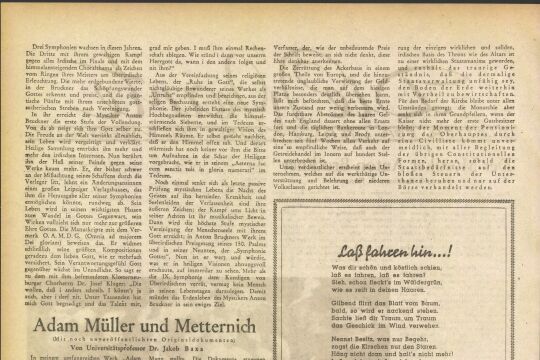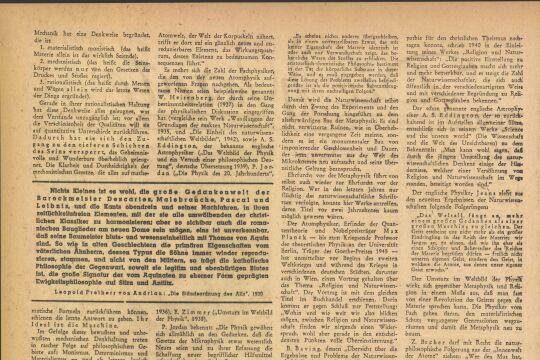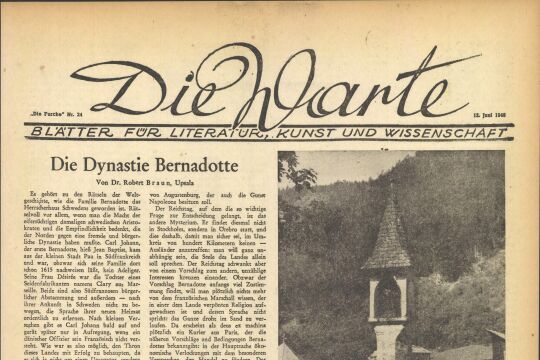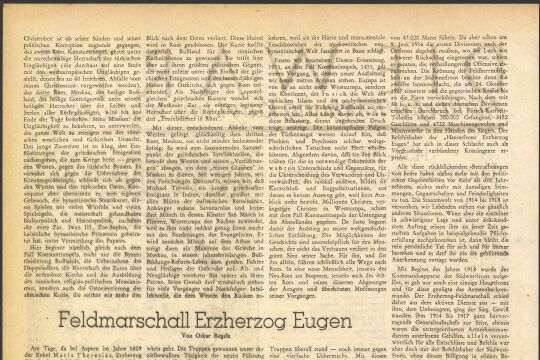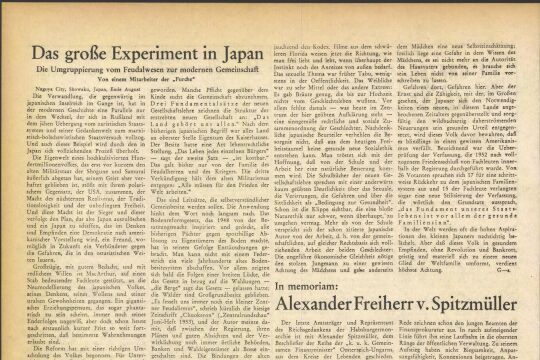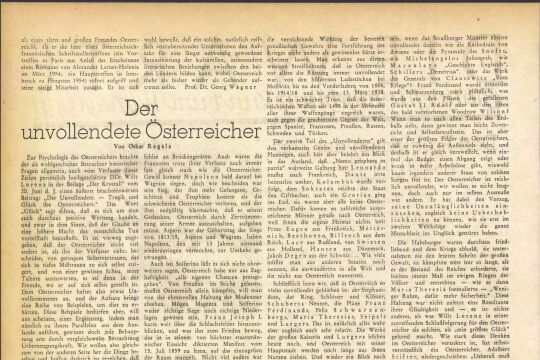Es gibt eine tiefe Tragik des österreichischen Menschen. Sie besteht darin, daß er keinen Mut zu sich selbst hat, kein Vertrauen zu seinen Fähigkeiten und deshalb die Talente, die ihm verliehen wurden, nur mangelhaft und in geringem Maße auswertet. Eine Behauptung, die durch viele Beispiele bewiesen werden könnte. Einige mögen genügen:
18. Juni 1757. Schlacht bei Kolin.
Der Krieg, den die Geschichtsschreiber den Siebenjährigen nennen werden, hat vor kurzem begonnen. Friedrich II. von Preußen ist den Angriffsplänen der „Großen Koalition“ durch den eigenen Angriff zuvorgekommen. Binnen kurzem hat er Sachsen in seiner Hand. Rückt in Böhmen ein. Erobert Prag, marschiert weiter. Bis Kolin. Hier steht Daun mit anderthalbfacher Ueber-macht. Friedrich spielt va banque. Er hat siebenmal schon gesiegt, er muß noch einmal siegen. Wie immer greift er den Feind auf einem Flügel an, um dann die Front aufzurollen. Wie immer gelingt der Angriff. Der Sieg scheint sicher.
Feldmarschall Daun, dieser hervorragende Stratege, dieser Meister der Märsche, gibt die Schlacht für verloren. Befiehlt- den Rückzug. Ohne zu ahnen, daß er eigentlich die Schlacht gewonnen hat: denn der andere Flügel Friedrichs hatte nicht gewartet, bis er den Befehl zum Angriff bekam, sondern sich sofort in die Schlacht gestürzt. Mit dem Erfolg, daß Friedrich, als der Sieg ihm schon sicher schien, keine Reserven mehr besitzt. Die Schlacht ist auf des Messers Schneide: zieht sich Daun zurück, dann hat Friedrich trotzdem gewonnen. Daun wollte zurück. Doch ist da ein sächsischer Oberstleutnant, Benckendorff mit Namen, der spielt ebenfalls va banque und reitet mit zwei Schwadronen gegen den Feind, die ganze Kavallerie folgt ihm, binnen kurzem ist, zum Erstaunen Dauns, die Schlacht gewonnen. Seine überglückliche Herrscherin verleiht ihm den Maria-Theresien-Orden.
12. August 2759. Schlacht bei Kunersdorf.
Friedrich II. greift mit 49.000 Mann die Oesterreicher unter Laudon und die Russen unter Soltikow in ihren starken Stellungen an. Wie immer richtet sich sein Angriff gegen einen Flügel des Feindes, dann rollt er die Front auf bis zur Mitte. Als er zum zweiten Flügel kommt, bleibt sein Angriff stecken. Plötzlich ist die Reiterei Laudons, des Balten, da und zersprengt die ganze preußische Armee. Es ist die fürchterlichste Niederlage, die der Preußenkönig je erlebt. Von 48.000 Mann bleiben ihm 3000. Friedrich selbst gibt alles für verloren, äußert Selbstmordabsichten. Der Weg nach Berlin ist offen.
Was geschieht? Nichts.
Maria Theresia, diese tapfere Frau, fleht Daun an, ja unter allen Umständen eine Schlacht zu vermeiden. Gegen einen König, der selbst alles für verloren hält und nur noch 3000 Mann besitzt.
20. und 21. Mai 1809. Schlacht bei Aspern.
Bei dem Versuch Napoleons, über die Donau zu gehen und Erzherzog Karl von Böhmen abzuschneiden, wo die letzten Reserven der Monarchie liegen, kommt es zur Schlacht. Zu einer mörderischen Schlacht. Die Gegner verbeißen sich ineinander. Um jeden Baum, jedes Haus, jedes Dorf wird mit voller Erbitterung gerungen. Aspern wird von den Oesterreichern erobert, verloren, wiedergewonnen. Am zweiten Tag weicht das vierte österreichische Korps dem Angriff des Feindes. Als Erzherzog Karl, dieser Vollblutösterreicher, aus den Bewegungen des Feindes zu erkennen glaubt, daß er auch auf dem rechten Flügel eine Offensive starten wolle, hält er die Schlacht für verloren. Gibt Befehl zum Rückzug. Fürst Liechtenstein, der General, sagt dem Erzherzog, daß doch die Schlacht gewonnen sei, Aspern ja im Besitz der Oesterreicher. Der Generalissimus glaubt es nicht. Bis auch er am nächsten Morgen nicht mehr leugnen kann, daß er eine Schlacht gewonnen hat, gegen Napoleon, den Unbesiegbaren dazu! Der Korse hatte um 7 Uhr abends seinerseits den Befehl zum Rückzug gegeben, zum erstenmal in seinem Leben, und die Truppen auf die Lobau gezogen.
Was geschieht? Wie nützt der Erzherzog seinen Sieg, ja die einmalige Chance, daß die Lobau eine Mausefalle ist, in der die Truppen des Korsen, schwer angeschlagen, ohne Wasser, ohne Fleisch, ohne Salz, ohne Brücken zum anderen Ufer der Donau, sitzen?
Was geschieht? Nichts! Erzherzog Karl bleibt untätig am anderen Ufer der Donau stehen. Ein paar Wochen später hat Napoleon alle Fehler gutgemacht und kann die Schlacht von Wagram gewinnen.
24. Juni 1859. Schlacht bei Solferino.
Nach der blutigen, aber unentschiedenen Schlacht bei Magenta hatten sich die Oester-reicher hinter dem Mincio zurückgezogen. Am 23. Juni überschritten sie ihn wieder und griffen am nächsten Tag die französisch-piemontesische Armee an. Benedek gelang ein völliger Sieg über die Piemontesen. Die Franzosen hatten einige Vorteile im Zentrum und am rechten Flügel. Franz Joseph hatte aber noch alle Reserven, mit denen er, nach Aussage Napoleons III., leicht die Schlüsselstellung hätte erobern können. Aber Franz Joseph, dieser Vollblutösterreicher, gab plötzlich den Befehl zum Rückzug. Die Armee ging hinter den Mincio zurück. Einen Tag nach der Schlacht stand sie dort, wo sie einen Tag vorher gestanden war.
Und Napoleon III., der ein Jahr später zum Herzog von Koburg sagte, daß seine Armee in viel schlechterem Zustand als die österreichische gewesen sei, konnte einen großen Sieg ausposaunen lassen, den er in Wirklichkeit als einen reinen Zufall ansah. Trotzdem war die Lage der Oesterreicher nicht ungünstig: Noch waren nur zwei Schlachten verloren, noch konnte der Krieg gewonnen werden. Denn die öffentliche Meinung in Deutschland begann jetzt zu kochen. Die Habsburgermonarchie war das führende Mitglied des Deutschen Bundes und seine Bedrohung eine Bedrohung Deutschlands. Der „Deutsche Bund“ beschloß die Mobilisierung von sechs Armeekorps, die am Rhein aufmarschieren sollten und Frankreich gefährlich bedrohten. Die Oesterreicher dagegen konnten sich in das Festungsviereck zurückziehen, wo sie unangreifbar waren. Franz Joseph hatte alle Chancen in seiner Hand, Napoleon fast keine.
Was geschah? Der österreichische Kaiser bot Napoleon einen „billigen“ Frieden an. Napoleon griff mit beiden Händen darnach, denn e r begriff seine Chance!
3. Juli 1866. Schlacht bei Königgrätz.
Die beste Armee, die Oesterreich vielleicht je besessen, verlor um 2 Uhr dieses Tages die Schlacht bei Sadowa. Benedek hatte sich nicht gegen die Armee des preußischen Kronprinzen gedeckt, und deren Erscheinen zwang ihn zum Rückzug. Dennoch gelang ihm in diesem Chaos noch ein kleines Meisterwerk: seine Armee vom Feinde zu lösen, in Mähren zu sammeln und intakt über die Donau zu bringen.
Eine Schlacht war verloren. Aber die Chancen, das erzählen die Memoiren Bismarcks, waren für Oesterreich nicht ungünstig: Italien, der Bundesgenosse Preußens, besiegt. Die Südarmee der Oesterreicher im Anmarsch. Die Oesterreicher in der Lage, nach Ungarn auszuweichen. Die preußische Armee durch Cholera dezimiert. Die Intervention Napoleons vor der Tür.
Wieder hatte Franz Joseph viele Chancen in der Hand, Bismarck nur noch wenige. Eigentlich nur noch eine einzige: Einen sofortigen „billigen“ Friedensschluß. Er bot ihn Oesterreich an. Das griff mit beiden Händen darnach. Und gab alle eigenen Chancen preis!
Genug der Beispiele aus der militärischen Geschichte Oesterreichs, um die eingangs aufgestellte These zu beweisen. Einige aus dem „zivilen Sektor“ mögen nur kurz noch folgen, um diese These zu erhärten.
Da ist Josef Ressel.
Gebürtig aus Böhmen, jenem Land, das die meisten spekulativen Köpfe der alten Monarchie hervorbrachte. Vor allem ein Oesterreicher. Das heißt, er hat zwei Berufe: einen, von dem er lebt, das ist die Försterei in Laibach, dann in Triest, und einen, für den er lebt, das ist die Bastlerci. Das Resultat aus allen diesen Komponenten ist die Erfindung der Schiffsschraube. Aber niemand will ihm Geld geben, um seine Erfindung in die Wirklichkeit umzusetzen. Schließlich findet er ein paar Briten, die ihm ein Schiff bauen. Am 1. Juli 1829 hat es seine Jungfernfahrt. Sechs Knoten in der Stünde, für damals unerhört viel, macht das Schiff. Während der Fahrt gibt es eine kleine Kesselexplosion.Grund genug für die Polizei, alle weiteren Versuchsfahrten zu verbieten. Der Traum des kleinen Försters ist aus.
Vier Jahre später verkauft er seine Erfindung um einen Bettel in Paris. Die erhaltene Summe reicht gerade zur Heimfahrt. Ein Jahrzehnt darnach fahren schon zahlreiche Schiffe Englands und Amerikas mit der Schiffsschraube. Und Ressel bleibt weiter der kleine k. k. Förster, der in seiner Freizeit bastelt.
Da ist Peter Mitterhofer.
Seines Zeichens Tischler im Vintschgau. Auch er hat, als Oesterreicher, zwei Berufe. Am Tage schreinert er für seine Kunden und am Abend bastelt er für sich. Eines Tages hat er dank letzterer Tätigkeit so etwas wie eine hölzerne Schreibmaschine gebaut. Fährt damit nach Wien und zeigt seine Maschine einer technischen Kommission. Die Herren finden das Ding interessant, aber unbrauchbar.
Der Tiroler ist zäh. Er gibt nicht nach. Ein paar Jahre später hat er eine bessere Form seiner Schreibmaschine zusammengebastelt. Wieder fährt er damit nach Wien, geht wieder zur technischen Kommission. Wieder finden die Herren die Idee interessant, die Wirklichkeit aber unbrauchbar.
Allen Fehlschlägen zum Trotz baut der Vintschgauer ein drittes Modell und geht damit direkt zu Kaiser Franz Joseph. Der kauft ihm die Maschine ab, für 150 Gulden, und schenkt sie dem Technischen Museum. Wo sie heute noch zu sehen ist.
Zur gleichen Zeit erfindet der Amerikaner Charles Glidden auch eine Schreibmaschine. Sie gleicht der Erfindung Mitterhofers wie ein Ei dem anderen, nur ist sie aus Eisen. Wie das möglich ist, ist bis heute nicht geklärt. Viele behaupten, der Amerikaner habe die Maschine Mitterhofers gesehen und einige „Anleihen“ bei ihm gemacht. Alles das ist fraglich. Sicher ist nur, daß der Amerikaner Millionen mit seiner Erfindung verdiente und der arme Mitterhofer ein kleiner Tischler geblieben ist.
Da ist Josef Madersperger.
Seine Geschichte ist kurz: er erfand die Nähmaschine, erhielt 1815 dafür ein Patent, konnte es mangels Geld nicht einlösen, so daß es erlosch, erhielt eine bronzene Medaille als Anerkennung von irgendeinem Gewerbeverein und starb in der „Versorgung“. Nur, weil niemand den Mut hatte, seine Erfindung zu finanzieren.
Da sind Josef Mohr und Franz Gruber.
Am 24. Dezember 1818 kommt der Hilfs-priester Mohr zum Schulmeister und Organisten Gruber von Oberndorf bei Salzburg, gibt ihm ein selbstverfaßtes Gedicht und sagt Gruber, er müsse bis Abend eine Melodie dazuschreiben für zwei Stimmen und Gitarrebegleitung. Die Orgel in der Kirche ist kaputt und irgend etwas muß in der Mette gesungen werden. Der brave Lehrer setzt sich wirklich hin und bis abends hat er die Melodie geschrieben. In der Mitternachtsmette singen die beiden das Lied zu den Lauten der Gitarre. Die Oberndorfer hören brav zu, freuen sich. Dann gehen sie nach Hause.
Niemand ahnt, daß in dieser Stunde das unsterbliche Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ geboren wurde, das die Welt erobern sollte.
Im Frühjahr kommt ein Orgelmacher aus dem Zillertal, hört das Lied und bringt es in seine Heimat. Von dort tragen es ein paar wandernde Kauflaute in die Ferne. Einmal kommen sie nach Leipzig und singen es vor der katholischen Gemeinde. Und von hier beginnt sein Siegeszug. Niemand aber weiß mehr, wer Verfasser und Komponist sind. Als „Tiroler Volkslied“ geht es durch die Welt. 1854 versucht ein Mitglied der Berliner Hofkapelle auf die Spur nach den Verfassern zu kommen. Was findet er schließlich? Einen armen Lehrer und Organisten namens Gruber in Hallein, der ihm endlich Aufklärung geben kann, wie das Lied eitstand, und der ihm von dem kleinen Grab in Wagrain erzählt, das die sterblichen Reste des Vikars Mohr barg, der es nicht einmal bis zum Pfarrer gebracht hatte, während sein Lied schon in allen Kirchen gesungen wurde.
Noch ein Beispiel, das zeigt, wie wenig oft Oesterreicher aus den Talenten, die ihnen anvertraut wurden, nichts zu machen verstehen:
Wien liegt in einer der schönsten landschaftlichen Gegenden, die eine Stadt überhaupt besitzen kann. Aber großteils ist diese Landschaft verbaut mit häßlichen kleinen Häusern, mit häßlichen großen Häusern, mit häßlichen Vororten, die ein Alpdrücken verursachen. Und das alles in einer Stadt, die wegen ihres Geschmackes bekannt ist.
Es gibt eine tiefe Tragik des Oesterreichers. Sie besteht darin, daß
er keinen Mut zu sich selbst hat,
kein Vertrauen zu seinen Fähigkeiten,
und deshalb die Talente, die ihm verliehen
wurden, nur mangelhaft und in geringem
Maße auswertet.
Oft müßte der Oesterreicher nur noch einen letzten, einen allerletzten kleinen Schritt tun, um sein Werk zu vollenden. Aber fast nie geht er diesen einen, letzten Schritt. Auf den es fast immer ankommt. Und so bleibt er der vollendete Unvollendete. *
Unvollendet sind viele Werke des österreichischen Menschen: Der Stephansdom, Schloß Schönbrunn, die Ringstraße in Wien, die Neue Hofburg, die Klöster Göttweih, Klosterneuburg, Wilhering, Seckau, Lilienfeld. Die Neunte Symphonie Schuberts und die Bücher Musils. Die Pläne eines Franz Ferdinand, eines Fürsten Felix Schwarzenberg, einer Maria Theresia, eines Lueger, eines Seipel.
Woher dieses Phänomen kommt, ist unerklärlich. Vielleicht durch das viele slawische und magyarische Blut, das in den Adern der Oesterreicher rollt. Aber neben aller Melancholie, die diesen östlichen Völkern eigen ist, besitzen sie eine erstaunliche Fähigkeit der Organisation und die Kraft, sich zum letzten Schritt zu entscheiden. Dieses Phänomen ist ureigenster österreichischer Besitz. Aber worauf zurückzuführen?
Vielleicht auf die im Transzendenten wurzelnde Scheu des Oesterreichers, in den Gang der Welt einzugreifen, weil er irgendeinen Plan, der besser ist als seiner, stören könnte? Gerne entschuldigt er sich, daß er überhaupt auf der Welt ist. Und wenn er in einen Raum tritt, wo andere Menschen versammelt sind, fragt er immer: „Stör' ich nicht?“
Daneben gibt es zwei andere Phänomene.
Erstens: Wenn der Oesterreicher in die Fremde kommt, hat er plötzlidi Mut zu sich und nützt seine Talente aus. Das beste Beispiel dafür sind die vielen Nobelpreisträger, die Oesterreich besitzt, die aber alle nicht in ihrer Heimat leben.
Zweitens: Wenn irgendein Großer aus der Fremde zu ihm kommt, ihn bei der Hand nimmt und mit ihm gemeinsam den letzten Schritt geht, den der Oesterreicher sicher sonst zu gehen scheut, dann hat der Oesterreicher plötzlich Mut zu sich selbst. Die Beispiele sind zahlreich. Es genügt auf das Wirken der alemannischen Habsburger im 13. und der spanischen Habsburger im 16. Jahrhundert, auf Prinz Eugen, den Savoyer, auf Metternich, den Rheinländer, hinzuweisen.
Jedes Volk hat seine Versuchung: Bei dem einen ist es ein überspitzter Nationalismus, bei einem zweiten ein Militarismus, bei einem dritten der Glaube, zu einer messianischen Aufgabe berufen zu sein. Die Versuchung des Oesterreichers ist es, kein Vertrauen zu sich selbst zu haben. Eine Versuchung, der er immer wieder erliegt und die ihn den vollendet Unvollendeten werden läßt.
Dennoch enthält diese tragische Situation auch ein Moment des Glückes. Der Oesterreicher, der von tiefem Mißtrauen gegen sein eigenes Tun erfüllt ist, jederzeit bereit, „kein gutes Haar an sich zu lassen“, ist in der glücklichen Lage des Zöllners, der gerechtfertigt aus dem Tempel ging, zum Unterschied von dem über sich entzückten Pharisäer, und dadurch gefeit gegenüber der Versuchung, sich für einen Gott zu halten, neben oder über dem es keinen mehr gibt, und ein brutaler Renaissancemensch zu werden, der seine Talente dazu verwendet, Mensdien unglücklich zu machen und Welten in Trümmer zu legen.
Das tiefe Mißtrauen des Oesterreichers gegen sich selbst erfließt ja nur aus der Erkenntnis, daß es auf dieser Welt nie etwas schlechthin Vollendetes geben kann. Und die Scheu, seine Talente auszuwerten, nur aus der , Furcht, in den Gang der Welt, wie sie eine höhere Macht plant, störend einzugreifen. Diese Erkenntnis und Anerkennung einer höheren Macht, die die Welt erhält und regiert, die dem Oesterreicher sozusagen „im Blute sitzt“, ist vielleicht sein größtes Glück. Und hier liegt auch der Punkt, wo er seine Versuchung überwinden kann. Denn wenn es eine höhere Macht gibt, so hat s i e ihm alle Talente verliehen, damit er sie im Dienst für sie und dadurch auch für die Mitmenschen verwende. Und daher muß er versuchen, alles so ganz wie möglich zu tun.
Unvollendet wird sein Tun auch dann noch sein, aber er wird vom vollendeten Unvollendeten einen Schritt weiter gelangt sein zum unvollendeten Vollendeten.