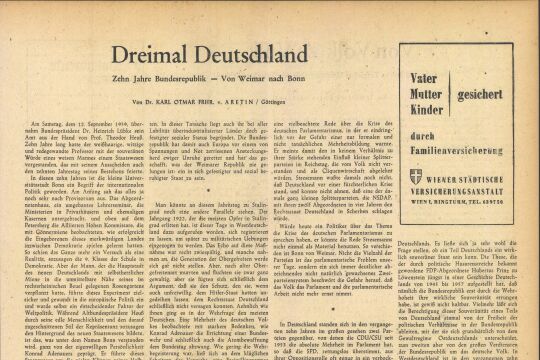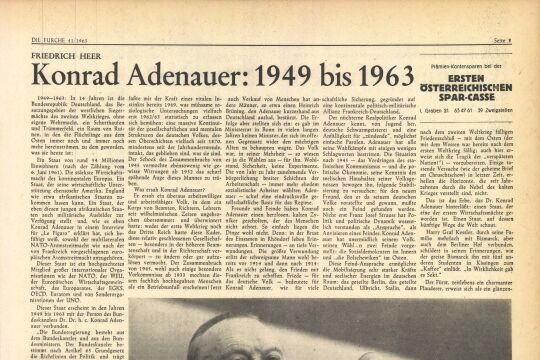Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die „Bonner Ära zu Ende?
Zwölf Jahre währte die Erste Republik der Deutschen, im Gegensatz zu Hohenzollern-Potsdam im Goetheschen Weimar begründet. Ebensolange währte die innerpolitische Balance der klassischen demokratischen Kräfte, zu denen durchaus legitim auch ein humanistischer Nationalliberalismus gehörte. Die europäisch orientierten Liberalen Rathenau und Stresemann hatten die außenpolitische Linie dieses Deutschlands von 1918 entwickelt: es war die einer ausgewogenen Mittelstellung mit eindeutiger Verankerung im Westen. Als zwölf Jahre nach 1918 das Kabinett des Sozialdemokraten Müller stürzte und die heraufziehende Weltkrise das europäische System in den Grundfesten erschütterte, ahnten die wenigsten, daß nun auch die freiheitliche Stabilität in Deutschland zu wanken begann.
Zwölf Jahre dauert nun das 1949 geschaffene System von Bonn. (Der einzige internationale Gratulant, der am . Vortag der deutschen Wahl dieser Jahreswiederkehr gedachte, war der österreichische Kanzler.) Im Gegensatz zu den Traditionen des Hitler- Reiches, dessen Wurzeln weniger in Berlin als in München gelegen waren, gründete man deutsche Staatlichkeit diesmal im Raum des „Dritten Deutschland“ von einst, das in den Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts, aus denen Bismarcks nationalstaatliche „Reichs“kopie hervorgegangen war, Unter die Räder kam. Keinen rheinischen Separatstaat hatten die Väter von 1949 im Auge, wohl aber einen deutschen Schwerpunkt im Dreiecks-
Verhältnis zum westlich-rationalen Pärii und zum universal-christlichen Rom. Andere Geister der deutschen Geschichte sollten beschworen werden als die des wilhelminischen Neupreußen, des Goetheschen Weimar, des unruhig-aktivistischen Neu-Mün- chen der „Feldherrnhalle“. Dieser deutsche Staat sollte nach dem Konzept seiner heute kaum erwähnten geistigen Gründer eine doppelte Aufgabe erfüllen: er sollte die Grundstruktur für ein kommendes föderalistisches Gesamtdeutschland schaffen, dessen östliche Teile zum erstenmal in der Geschichte keine Kampf-, sondern eine Nachbarschaftsstellung zum Slawentum einnehmen sollten. Zugleich aber war ihm die Aufgabe gestellt, das Gesicht des „anderen Deutschland“ einer in Schreck und Haß erstarrten Umwelt gegenüber zu repräsentieren: nicht als das pharisäisch „bessere“, aber als das von der Wurzel her heilbare Deutschland. Konrad Adenauer, der Kanzler seit 1949, wußte, daß er für eine solche Konzeption nicht einmal in der eigenen bürgerlichen Sammelpartei eine echte gesinnungsmäßige Mehrheit hinter sich und seinen Mitstreitern der ersten Stunde hatte. Da aber nach Lage der Dinge für eine politische Neugestaltung in Deutschland nur ein System parlamentarischer Parteiendemokratie in Frage kam, mußte er sich eine Mehrheit schaffen: eine Kanzlermehrheit. Er hatte sie bereits 1949, als seine eigene Partei nur 31,8 Prozent der Stimmen errang. Denn ihm stand die damalige Deutsche Partei als eine echt konservative, in der föderalistischen Weifentradition Niedersachsens beheimatete Gruppe in allen staatspolitischen Fragen treu zur Seite. Die geistige Führung des humanistischen deutschen Liberalismus lag trotz dessen überparteilicher Stellung in den Händen eines Theodor Heuss, der das gesunde schwäbische Demo- kratentum repräsentierte. Diese nicht immer ganz leicht aufeinander abzustimmende Bonner Mehrheit von 1949 sicherte Adenauers großen staatspolitischen Europakurs. Als sie durch die Sezession der National-Liberalen auseinanderbrach, mußte die Partei des Kanzlers den Alleingang im Kampf um die problematische Massengunst suchen. Dieser Weg führte zur Mehrheit von 1953, die noch der Absicherung durch die kleine DP bedurfte, und zur großen Majorität von 1957, die Adenauer die Alleinbestimmung ermöglichte. So war es praktisch bis zum 17. September 1961.
Mit dieser Nacht ist — wie immer die Dinge jetzt weitergehen werden — die Bonner Mehrheit verlorengegangen. Es gibt keine föderalistischen Kräfte kleinerer Ordnung mehr, die als Bundesgenossen helfen könnten. (Man hat vielleicht auch in glücklicheren Jahren zuwenig getan, um ihnen Hilfe und Partnerschaft anzubieten. Da waren sie: in Baden und auch im Norden und am Rhein.) Die heute führenden Sozialdemokraten, ebenso wie die zwar untereinander im Widerstreit liegenden, im stillen Haß gegen den „Geist von Bonn“ aber einigen Führer der FDP, sie haben, um mit einem Wort Luthers an die Schweizer Reformierten zu sprechen, „einen anderen Geist“. Die auch durch parteiamtliche Beschönigungen und Zahlenspielereien nicht wegzudisputierenden Realitäten aber sind hart. Sie verlangen entweder die Koalition der CDU/CSU mit der FDP oder zumindest ein Agreement auf Duldung eines Minderheitenkabinetts, als dessen Chef Adenauer vor jeder Abstimmung doch um die Gunst der FDP betteln und buhlen müßte. Freilich gäbe es noch andere Möglichkeiten: die einer Koalition mit der SPD zum Beispiel, die aber zu einer nicht unproblematischen Isolierung der dann zum Oppositionszentrum werdenden Rechten führen müßte. Das österreichische Beispiel ist nicht schematisch übertragbar. Eine splendide Opposition der CDU/CSU gegen eine sozialistisch-liberale Koalitionsregierung würde eine Roßkur bedeuten, die diese innerlich nicht überaus homogene Partei kaum ohne Schaden überstehen könnte. Der Idee einer Allparteienregierung haftet so viel von apolitischer deutscher Schicksalsromantik aus den Sterbetagen der Weimarer Republik mit ihren „Konzentrationen“ und „Taten“ und „Eisernen Fronten“ an, daß sie kaum praktikabel erscheint, solange man das Spiel der parlamentarischen Demokratie eben einmal weiterspielen will. Wie immer man es dreht und wendet — und es ist nicht unsere Aufgabe, in der nun begonnenen deutschen innerpolitischen Auseinandersetzung
Ratschläge zu erteilen, weil wir solche auch in unseren eigenen Koalitionssorgen von keiner Grenze her wünschen —, wie immer jetzt zwischen den drei einzig verbliebenen Parteien in Bonn taktiert werden wird: Adenauers Konzept wird verwässert werden. Die zwölf Jahre seiner Alleinbestimmung haben es psychologisch zwangsläufig mit sich gebracht, daß heute jeder, der Nicht-Adenauer ist, Anti-Adenauer sein muß. Gewiß: heute ist es noch leicht, von der unerschütterlichen Gemeinsamkeit der deutschen Politik zu sprechen, die unveränderte Linie der Außenpolitik Adenauers zu betonen. Die eigentlichen Bewährungsproben, die harten Tage, haben ja noch nicht begonnen. Die deutsche Frage ist erst in diesen Tagen zu einem Diskussionsthema zwischen Ost und West geworden.
Österreich, und mit ihm die anderen Nachbarstaaten Deutschlands: sie haben in diesen Tagen nüchtern und ohne unzulässige Parteinahme zu prüfen, welche Möglichkeiten eine deutsche Politik, die nicht mehr von Adenauer allein bestimmt sein wird, zur Stunde hat. Das vorweggenommene Ergebnis dieser Prüfung ist düster genug. Sehen wir von den radikalen Möglichkeiten zur Linken und zur Rechten ab. Es gehört ja zu den wenigen Erfreulichkeiten dieser Wahl, daß sowohl das kommunistische Mitläufertum der „Deutschen Friedens-Union" als auch der Rechtsradikalismus mit seinen Splittergruppen eine Abfuhr erlitten haben, um die Deutschland mancher andere demokratische Staat des Westens beneiden kann. Aber weder der Kommunismus noch der Nationalsozialismus sind bei einer normalen Entwicklung der Dinge eine deutsche Gegenwartsgefahr. (Die gleichzeitige Ulbrichts- Wahl der 99,9 Prozent kann nur als makabres Kuriosum am Rande notiert werden.) Die inneren Gefahren für die Bundesrepublik liegen in einer Abkehr der breiten Wählermassen vom Rationalen einer europäisch-verantwortungsbewußten Führung, und in einer Hinwendung zu jenen irrationalen, religionsähnlichen Sekten des Politisie- rens, in einer Hingabe an die rein gefühlsmäßigen Stimmungen nationaler Romantik, die zu einem Moment der Unruhe in ganz Europa werden können. Daß dieses Schwärmertum aller nur denkbaren Richtungen von der Reichsmystik bis zur handfesten Rapallo-Spekulation, vom affektgeladenen Antiklerikalismus bis zur apolitischen Gesundbeterei im unhomogenen Lager der Wählerschaft der FPD zu Hause ist, hat uns in vertrautem Gespräch schon vor Jahr und Tag mancher führende Mann dieser nur dem Namen nach dem großen Erbe des deutschen Liberalismus verpflichteten Sammelpartei bestätigt. Aber auch die SPD hat viel von den schon früher kaum ausgeprägten rationalen Konturen des Marxismus preisgegeben, ohne dafür etwas anderes als einen opportunistischen Nationalismus, zusammen mit einem recht flachen Humanismus des „Seid nett zueinander“, einzuhandeln. Mehr noch: nicht ohne Grund hofft man im Lager der beiden Parteien auf Bundesgenossenschaft in der Festung Adenauers selbst, in der Fraktion der CDU/CSU, aber auch in den nicht ganz durchschaubaren Berechnungen des einen oder anderen Großen der Umgebung Adenauers.
Österreich kann und will in diese Auseinandersetzung nicht eingreifen. Niemand aber kann uns die Feststellung übelnehmen, daß wir in der nun zu Ende gehenden Bonner Ära trotz gelegentlicher Ungeschicklichkeiten auf beiden Seiten das Verhältnis zwischen Wien und Bonn in einer Konzeption fundiert sahen, die uns gesünder und für beide Seiten zuträglicher schien als alles andere, was seit 1866 jenseits des Inn entwickelt worden ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!