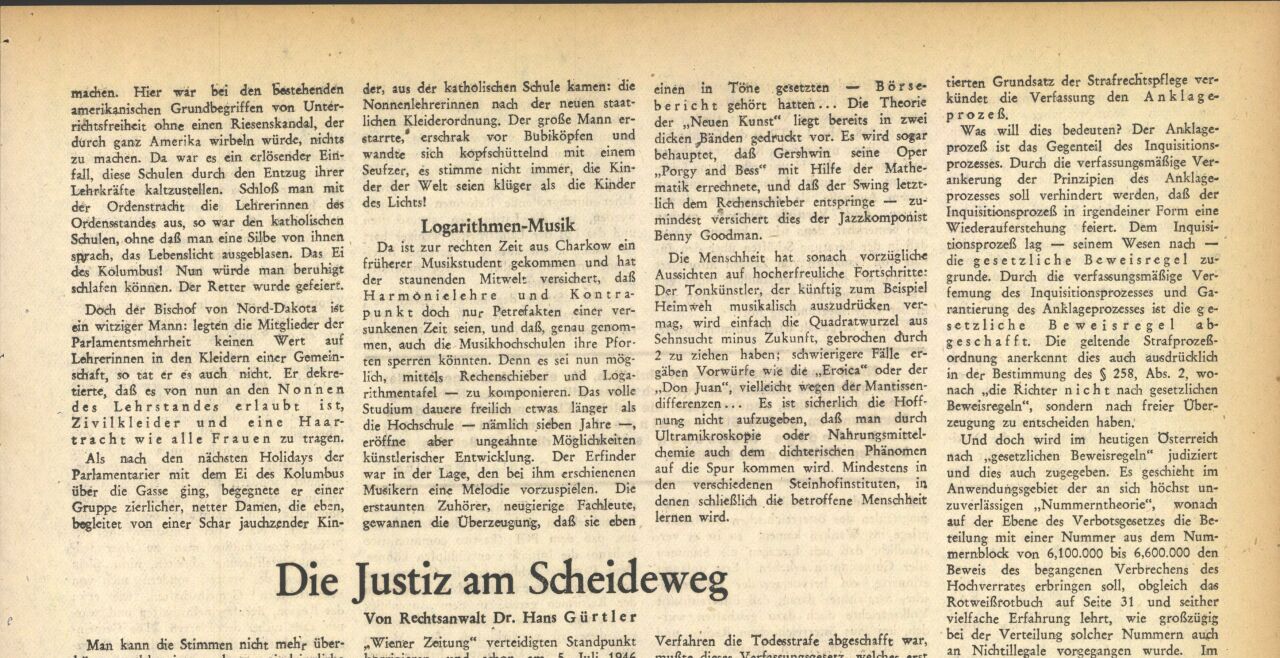
Man kann die Stimmen nicht mehr überhören, welche immer lauter eindringliche Kritik an der Rechtspflege üben. Es gibt zu denken, .wenn ein Vorsitzender eines Wiener Volksgerichtssenats glaubt, erst das Verlangen stellen zu müssen, die Tätigkeit der österreichischen politischen Strafgerichte darauf abzustellen, den Glauben an Recht und Gerechtigkeit in unserem Volke zu erhalten. Worte, die der gleichen Sorge entspringen, aus welcher ein Richter der Steiermark, Oberlandesgerichtsrat Doktor S i e n e r, in einem in der Wiener Juristischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag „Geistige Besinnung“ verlangte, um „aus einer Sackgasse, an deren Ende wir angelangt seien“, herauszufinden.
Gelten diese Sorgen dem gesamten Gebiet der Rechtspflege, so will ich mich bewußt auf das Gebiet der Strafrechtspflege beschränken und versuchen, aufzuzeigen, wieso wir auch hierin in eine „Sackgasse“ gekommen sind. Wir werden der Erforschung der Gründe näherkommen, wenn wir von unabdingbaren Bestimmungen der geltenden Verfassung ausgehen. Diese Verfassung setzt auch der Strafrechtspflege in Gesetzgebung und Rechtsprechung unübersteigbare Schranken. Jede Mißachtung derselben führt die Justiz auf einen Scheideweg. Die wenigen verfassungsmäßig geschützten Grundsätze, deren Verletzung jedem verfassungstreuen Österreicher eine Sünde wider den Geist bedeutet, lauten:
Erstens: Die Todesstrafe im ordentlichen Verfahren ist abgeschafft (Artikel 85 B. — VG.).
zweitens; im Strafverfahren gilt der Anklageprozeß (Absatz 2, Artikel 90) und drittens: die Verhandlungen in Strafrechtssachen sind vor dem erkennenden Gerichte mündlich und öffentlich (Absatz 1, Artikel 90).
Schon bezüglich der ersten verfassungsmäßigen Garantie der Strafrechtspflege übersah die zweite Republik, daß die österreichische Bundesverfassung in allen ihren Bestimmungen spätestens mit 19. Juni 1946 wieder in Wirksamkeit trat, zumindest von diesem Zeitpunkte ab daher die Todesstrafe im ordentlichen Verfahren verboten war. Man mag über die Zulässigkeit der Todesstrafe denken, wie man will, das eine ist sicher: ein verfassungsmäßiges Verbot derselben 1st von der Justiz bedingungslos zu befolgen, die dazu da ist, andere zu bestrafen, welche sich gegen das Gebot „Du spllst nicht töten“ vergehen. Und doch war die österreichische Justiz Ende Juni 1946 daran, im ordentlichen Verfahren verfassungswidrig zu henken.
Als in öffentlicher Schwurgerichtsver- Handlung die Bedenken hiegegen aufgezeigt wurden, veröffentlichte die Justizverwaltung in der amtlichen „Wiener Zeitung“ vom 22. Juni 1946 Ausführungen, die es begründen sollten, daß auch weiter „keine Bedenken gegen die Anwendung der Todesstrafe im ordentlichen Verfahren gehegt“ werden. Es war damals das Zentralorgan der Sozialistischen Partei, welches in einem bemerkenswerten Aufsatz meiner These beistimmte, daß die Todesstrafe zumindest mit 19. Juni 1946 auf alle Fälle aufgehoben sei. Innerhalb weniger Tage mußte die Justizverwaltung ihren in der
„Wiener Zeitung“ verteidigten Standpunkt korrigieren, und schon am 5. Juli 1946 legte sie dem Nationalrat die Regierungsvorlage des Bundes Verfassungsgesetzes über die Anwendung der Todesstrafe (145 der Beilagen) vor. Die erläuternden Bemerkungen dieser Regierungsvorlage gaben zu, daß die Sonderbestimmung des Verfassungsüberleitungsgesetzes, welche noch die Verhängung der Todesstrafe ermöglichte, „am 19. Juni 1946 außer Kraft getreten" sei.
In der Sitzung des Nationalrates vom 24. Juli verwies der Berichterstatter darauf, daß die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Todesstrafe in einem Schwurgerichtsprozeß angeschnitten wurde und meinte (Seite 631 der stenographischen Protokolle):
Eine große Tageszeitung ganz anderer Richtung, als die es ist, der der Verteidiger angehört, hat sich dieser Frage angeschlossen, und so ist die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Todesstrafe in Österreich aufs Tapet gekommen.
Und es wurde den verfassungsmäßigen Bedenken Rechnung getragen und es bedurfte des Verfassungsgesetzes vom 24. Juli, um im ordentlichen Verfahren die Todesstrafe zulässig zu erklären. Da man es aber übersehen hatte, daß zumindest ab 19. Juni 1946 im ordentlichen
Verfahren die Todesstrafe abgeschafft war, mußte dieses Verfassungsgesetz, welches erst am 10. September im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde und daher erst am 11. September in Kraft trat, gemäß § 3 auf den 19. Juni 1946 rückwirkend erklärt werden, womit ein weiterer Grund der Berechtigung der Kritik an der Strafrechtspflege bloßgelegt wird — die rückwirkende Kraft von Strafgesetzen und Strafdrohungen.
Galt es früher als unabdingbarer Grundsatz: kein Gesetzgeber dürfe ex post Handlungen unter Strafe stellen oder' Strafdrohungen verschärfen, so lehrt uns die Erfahrung siebenjähriger Tyrannei, wohin es führen kann, wenn dieser im Sittengesetz und in der Natur des Strafgesetzes wurzelnde Grundsatz über Bord geworfen wird.
Der Grundsatz der Nichtrückwirkung strafrechtlicher Bestimmungen erscheint mir so selbstverständlicher fundamentaler Art zu sein, daß man es öffenbar deshalb nidit für nötig fand, ihn erst verfassungsmäßig zu verankern; es müssen daher verfassungsrechtliche Bedenken schweigen und man kann e? im Interesse des Ansehens unserer Rechtsprechung nur bedauern, wenn die österreichisdie Strafgesetzgebung auch hiegegen sündigt.
Als zweiten verfassungsmäßig garantierten Grundsatz der Strafrechtspflege verkündet die Verfassung den Anklageprozeß.
Was will dies bedeuten? Der Anklageprozeß ist das Gegenteil des Inquisitionsprozesses. Durch die verfassungsmäßige Verankerung der Prinzipien des Anklageprozesses soll verhindert werden, daß der Inquisitionsprozeß in irgendeiner Form eine Wiederauferstehung feiert. Dem Inquisitionsprozeß lag — seinem Wesen nach — die gesetzliche Bcweisregel zugrunde. Durch die verfassungsmäßige Verfemung des Inquisitionsprozesses und Garantierung des Anklageprozesses ist die g e- setzliche Beweisregel abgeschafft. Die geltende Strafprozeßordnung anerkennt dies auch ausdrücklich in der Bestimmung des § 258, Abs. 2, wonach „die Richter nicht nach gesetzlichen Beweisregeln“, sondern nach freier Überzeugung zu entscheiden haben.
Und doch wird im heutigen Österreich nach „gesetzlichen Beweisregeln“ judiziert und dies auch zugegeben. Es geschieht im Anwendungsgebiet der an sich höchst unzuverlässigen „Nummerntheorie“, wonach auf der Ebene des Verbotsgesetzes die Be- teilung mit einer Nummer aus dem Nummernblock von 6,100.000 bis 6,600.000 den Beweis des begangenen Verbrechens des Hochverrates erbringen soll, obgleich das Rotweißrotbuch auf Seite 31 und seither vielfache Erfahrung lehrt, wie großzügig bei der Verteilung solcher Nummern auch an Nichtillegale vorgegangen wurde. Im Anwendungsgebiet der „Nummerntheorie" erklärt jedoch der Ob -ste Gerichtshof die gesetzliche Beweisregel zulässig, indem er (Erkenntnis vom 22. Mai 1947, 5 Os 43) wörtlich ausspricht:
Es ist allerdings richtig, daß sowohl dem österreichischen materiellen Strafrecht als auch dem österreichischen Strafverfahrensrecht gesetzliche Vermutungen und Beweisregeln i m allgemeinen fremd sind. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß im konkreten Fall (§ 10 VG) vom Gesetzgeber eben eine solche Beweisregel geschaffen wurde, welche die Gerichte zu beachten haben, möge sie auch mit den allgemeinen Grundsätzen des Strafrechtes nicht im Einklang stehen.
Eine — wie ich vermeine — gefährliche und bedenkliche Argumentation, da § 10, Abs. 1 c, mit keinem Wort davon spricht, daß durch Verleihung einer bestimmten Nummer („Nummerntheorie“) jemand als „Altparteigenosse" anerkannt wurde. Und doch rauschen die Mühlen der Gerechtigkeit in täglichen Urteilen und Schuldsprüchen nach dieser „Nummerntheorie“, einer „gesetzlichen Beweisregel"!
Die Rechtsprechung der Volksgerichte wird schließlich dadurch verflacht und automatisiert, daß auf Grund gesętzlicher Regelung an Stelle der Einzelschuld von dem Begriff der Kollektivschuld ausgegangen wird, die ein österreichischer aktiver Minister nicht zu Unrecht als eine „Erfindung das Teufels“ bezeichnete. Die Rechtsprechung in den zum täglichen Brot der Volksgerichte gewordenen Prozessen nach §§ 10 und 11 VG ist daher nicht befriedigend — sie ist ungerecht und dies darf zumindest seit dem 21. April 1948 auch ausgesprochen werden. An diesem Tage sah nämlich die österreichische gesetzgebende Körperschaft dieses Unrecht selbst ein, indem der Nationalrat mit den Stimmen aller Abgeordneten eine Entschließung faßte, in welcher die Bundesregierung aufgefordert wurde,
eine Novellierung des VG 1947 in jenen Paragraphen vorzubereiten, die besondere Härten enthalten und sich in der Praxis als abänderungsbedürftig erwiesen haben. Dabei wird besonders auf die §§ 10 und 11 VG 1947 verwiesen.
Der Nationalrat sanktionierte hiemit Bedenken, welche die Vertreter der Rechtswissenschaft unablässig vortragen und anerkannte in solenner Weise die Reformbedürftigkeit dieser Paragraphen, welche den österreichischer Rechtsauffassung fremden Begriff der Kollektivschuld in unser Strafsystem trugen. Man hörte leider erst spät auf die Worte, mit denen der Vater der Christenheit schon am 20. Februar 1946 die These der Kollektivschuld als eine Irrlehre brandmarkte und vor ihr warnte. Man überhörte, was der Hauptankläger im Nürnberger Prozeß in seinem Bericht an den amerikanischen Präsidenten erklärte, indem er die Kollektivschuld mit der Erwägung ablehnte, das Gewissen Amerikas würde sich hiemit nicht abfinden und „künftige Generationen würden nur mit Beschämung daran zurückdenken". Es bedurfte erst aufrüttelnder Worte hervorragender Vertreter der Rechtswissenschaft und der Erfahrung einer fast dreijährigen Rechtsprechung, um auch unsere Volksvertreter erkennen zu lassen, daß gesetzliche Strafbestimmungen, insofern diesen nicht Individualschuld, sondern Kollektivschuld zugrunde liegen, ein Unding seien.
Es verlohnt sich, die stenographischen Protokolle der Sitzung des Nationalrates vom 21, April 1948 nachzulesen, in welcher der Initiativantrag der Abgeordneten Weinberger und Dr. Tschadek auf Abänderung der reformbedürftig anerkannten §§ 10 und 11 VG (Seite 2250). einstimmig angenommen wurde. Der Vertreter der KPÖ, Abgeordneter Koplenig, wollte hiebei das Verdienst in Anspruch nehmen, zuerst diese Ungerechktigkeit erkannt zu haben. Die Vertreter der anderen Parteien warfen Herrn Koplenig hiezu allerdings Demagogie vor und erklärten ihrerseits ihren „Abscheu, au« der Nazifrage irgendein politisches Geschäft zu machen“. (Dr. Koref, Seite 2245.) Der Sprecher der Sozialistischen Partei verwies darauf, daß die Sozialisten schon auf der ersten Länderkonferenz, die im September des Jahres 1945 stattgefunden hit, die Kollektivschuld grundsätzlich abgelehnt haben. Noch ein zweitesmal wurde von seiten meiner Partei in aller Form und in aller Einmütigkeit die Kollektivschuld wieder abgelehnt. Es wir dies auf dem Parteitag im Oktober vorigen Jahres“ (Seite 2243).
Dr. Gorbach, als Vertreter der ÖVP, erkannte gleichartig in der Kollektivschuld den Krebsschaden und die Ursache der Unzufriedenheit. So kam es zu jenem einstimmigen Beschluß auf Abänderung einer Gesetzesstelle. Bestehen aber bleibt die Tatsache, daß bis zur verlangten Änderung der §§ 10 und 11 die Richter gezwungen sind, in täglichen Urteilen „Im Namen der Republik“ ein „Schuldig“ auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zu sprechen, welche der Gesetzgeber — insofern ihnen Kollektivschuld zugrunde liegt — als Unrecht erkennt und bezeichnet.
Der dritte verfassungsmäßig aner-
kannte Grundsatz der Strafrechtspflege ist der der Mündlichkeit des Verfahrens, aus dem die prozessuale Vorschrift fließt, wonach (§ 258, Abs. 1, STPO) das Gericht bei Urteilsfällung nur auf das Rücksicht nehmen darf, was in der Hauptverhandlung vorkommt und auch Aktenstücke nur in diesem Ausmaße als Beweismittel dienen dürfen. Auch Verstöße hiegegen machen sich bemerkbar, denn schon kommt es vor, daß in der Beratung Schöffen über den Inhalt von Gauakten von Zeugen informiert werden, die in der Verhandlung nicht zur Verlesung kommen, wovon man dann erst in der Urteilsbegründung hört.
Venn es dergestalt dazu kommen konnte,
daß zumindest zeitweilig alle drei Verfassungssäulen der österreichischen Strafrechtspflege ins Wanken kamen, so ist es verständlich, daß sich hiegegen die Stimmen aller Gutgesinnten erheben. Erst unlängst erinnerte ein hervorragender österreichischer Strafrichter daran, daß österreichische Volksgerichte doch dazu geschaffen wurden, um „aus österreichischem Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden heraus die Untaten des Nationalsozialismus zu sühnen und einer gerechten Bestrafung zuzuführen“. Zur Vermeidung gröblicher Unbilden verlangt er, daß „das persönliche Verschulden des einzelnen“ festgestellt werde.
Solche Mahnungen aus berufenem Munde — ich denke auch an die Ausführungen des Staatsanwalts Dr. Laßmann in der Juristischen Gesellschaft — künden von berechtigter Sorge. Mir handelte es sich darum, nur eine xler Ursachen dieser Sorge um die Strafrechtspflege aufzuzeigen und ich erblicke diese in der Mißachtung verfassungsmäßiger Grundsätze, die immer und auch heute gefährlich ist.




































































































