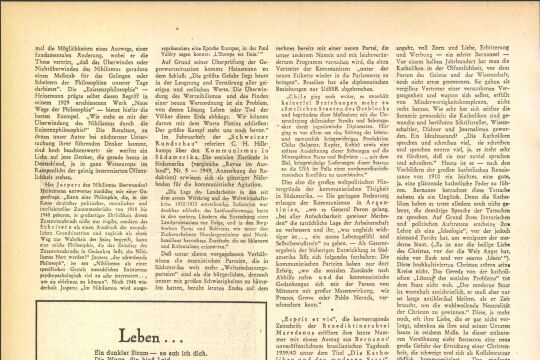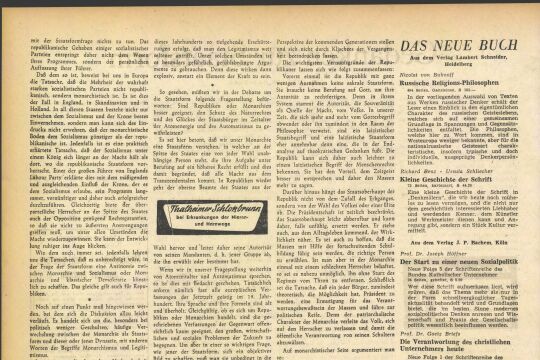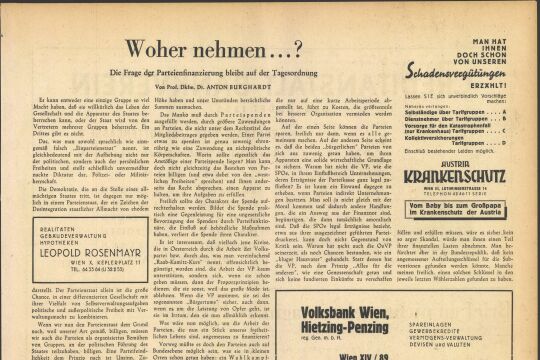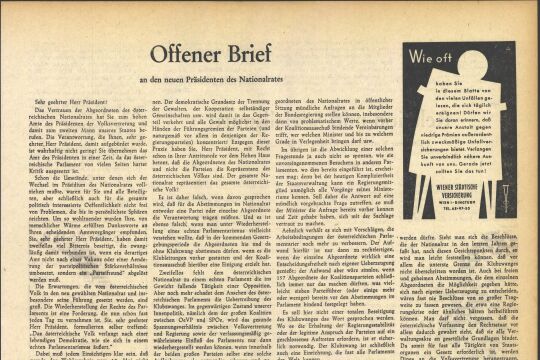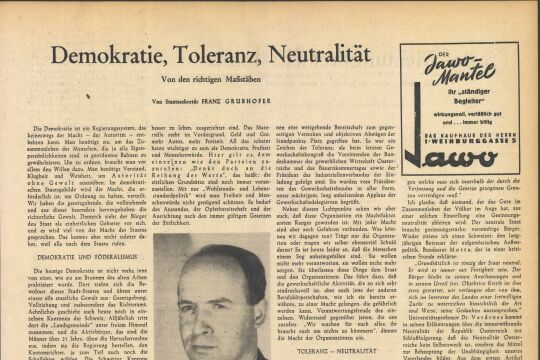Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Wunde unserer Demokratie
E war in einem ersten Aufsatz* die Rede vom Auseinanderklaffen zwischen dem Buchstaben und dem Geist unserer Verfassung, zwischen der „juristischen“ und der „soziologischen“ Verfassung, wie es sich besonders im gut eingespielten Mechanismus der großen Parteien spiegelt. Gibt es nun Mittel und Wege zur Eindämmung der unerwünschten Entwicklung?
Eine Möglichkeit hiezu könnte die Ä n d e-rung unseres Wahlsystems sein, das in seiner jetzigen Form den Parteien eine praktisch unbeschränkte Kontrolle und Herrschaft sichert. Unser Wahlsystem spiegelt auch einen anderen Prozeß wider, der mit dem Erstarken der Parteiapparate Hand in Hand ging: die Substituierbarkeit der als Mandatare tätigen Personen, das Verschwinden beispielgebender und vertrauenerweckender Persönlichkeiten. Ein ausgezeichnetes Mittel, um einer Vielzahl von Übeln, die im Laufe der Nachkriegsentwicklung aufgetreten sind, zu begegnen, könnte die E i n-führung des Mehrheitswahlrechtes an Stelle des geltenden Verhältniswahlsystems sein. Das Mehrheitswahlsystem läßt es zwar an der mathematischen und formellen Gerechtigkeit fehlen, die dem Verhältniswahlrecht eigen ist, aber es ist dafür vom Standpunkt der demokratischen Gesamtentwicklung aus ein ungleich wirksameres und zweckmäßigeres System. Es würde dem Einfluß der Parteien Grenzen setzen und gleichzeitig in der Gestalt des ad per-sonam vom Volk berufenen, wenn auch parteilich gebundenen Wahlkreisvertreters ein entscheidendes Gegengewicht gegen die Parteiapparate schaffen. Demokratie ist mehr als eine normierte Ordnung, der in der praktischen Durchführung entsprochen werden muß, sie lebt nach unseren einleitenden Überlegungen von der im Bewußtsein der Staatsbürger wachen Überzeugung, bei seinen Repräsentanten tatsächlich Organe seines Willens am Werke zu sehen. Dieses Bewußtsein ist beim Mehrheitswahlsystem ungleich stärker als bei dem in Österreich praktizierten. Der österreichische Wähler hat im allgemeinen sicher nicht das Gefühl, daß der Abgeordnete sein Diener und Vertreter ist, ja er kennt in den meisten Fällen den Namen seines Abgeordneten gar nicht. Dies ist nicht primär Ausdruck einer politischen Lethargie der Österreicher, sondern einfach die realistische Einschätzung der unter unserem System herrschenden Machtverhältnisse, die den einzelnen Abgeordneten von geringer Bedeutung erscheinen lassen. Der durch das Mehrheitswahlsystem berufene Abgeordnete eines Wahlkreises hätte wirklich um die Gunst seiner Wähler zu ringen und sich nicht bloß nach der Verankerung im Parteiapparat umzusehen. Er müßte dann allerdings auch mehr tun. um sich das Vertrauen seiner Wähler zu erringen und zu erhalten. Er würde die Nichterledigung eines an ihn herangebrachten Wähleranliegens nicht riskieren, weil ihn bei der nächsten Wahl unter Umständen ein Versäumnis dieser Art aus seiner Position verdrängen könnte. Dem Parteiapparat gegenüber hätte der Abgeordnete eine ungleich freiere Stellung als bei uns, er könnte, wie es zum Beispiel in England an der Tagesordnung ist, in seinen Ansichten und öffentlichen Erklärungen nach links oder nach rechts von seiner Partei abweichen, ohne seine Wiederwahl in Frage zu stellen. Das Mehrheitswahlsystem könnte auch die graue Uniformität unseres politischen Personals mildern und innerhalb der Parteien wirklichen Persönlichkeiten Durchbruch verschaffen.
Es ließe sich allenfalls auch ein Weg finden, nach deutschem Muster eine Kombination der Vorteile des Verhältnis- und Mehrheitswahlsystems in Form eines gemischten Wahlrechtes herbeizuführen. Oder es sollte doch wenigstens an die Stelle der gebundenen die freie Liste treten, denn die gegenwärtige Handhabung bietet den Parteien eine totale Kontrolle der Kandidaten, die willkürlich hin- und hergereiht werden und nicht selten auch noch nach erfolgter Wahl der Mißgunst der Parteizensur zum Opfer fallen. Die Änderung des Wahlsystems wäre die erste Voraussetzung zur Aktualisierung des in der Verfassung verankerten Prinzips des freien Mandats, das in unserer politischen Praxis zu einem durch den Parteiwillen gebundenen geworden ist. Mit der Verantwortlichmachung der Volksvertreter gegenüber ihren Wählern würde das Parlament
* Siehe „Die Furche“ Nr. 9. tatsächlich zu jenem Organ des Volkswillens, das es heute ganz offenkundig nicht ist.
Doch die Änderung unseres Wahlsystems allein würde nicht ausreichen, um dem rollenden Rad der Machtkonzentration in den Händen weniger in die Speichen zu greifen. Dazu wäre auch ein Ernstmachen mit den verfassungsmäßig vorgesehenen Einrichtungen der Volksabstimmung und des Volksbegehrens notwendig. In dieser Richtung haben beide Parteien bisher wenig Initiative entwickelt, im Gegenteil, es wird bei jeder Gelegenheit, wo auch nur die Möglichkeit einer solchen unmittelbaren Einwirkung des Volkes sichtbar wird, auf die Kostspieligkeit und Überflüssigkeit solcher zusätzlicher Abstimmungen hingewiesen. In Wahrheit sind alle vorgebrachten Argumente Scheinargumente. Und das Beispiel des durch eine Volksabstimmung zu Fall gebrachten Betriebsaktionengesetzes in Vorarlberg beweist zur Genüge, daß der Wille der Wähler in gar manchen Fragen von dem seiner Beauftragten abweichen würde.
Wenn der demokratische Grundgedanke der Delegierung der Macht von unten nach oben konsequent verfolgt werden soll, so muß der föderalistische Charakter unseres staatlichen Lebens gewährleistet und den Ländern eine weitergehende Befugnis eingeräumt werden, als es die gegenwärtige Verfassung vorsieht. Österreich ist klein genug, um das Beispiel der Schweiz weitgehend nachahmen und die Demokratie in der kleinen geographischen Einheit auf lokaler Ebene verwirklichen zu können. Die Reaktivierung der verfassungsmäßig vorgesehenen Formen unmittelbarer Demokratie könnte im Zusammenhang mit einer Erweiterung der Kompetenzen der Länder entscheidende Voraussetzungen Zu einem Dürch-bruch des Volkswillens schaffen, von dessen Gelingen über kurz oder lang der Bestand unserer Demokratie abhängen kann.
Denn man täusche sich über eines nicht hinweg: das gegenwärtige System funktioniert nur deshalb glatt, weil es mit der Prosperität und gesicherten Verhältnissen Hand in Hand geht.
Es ist aber weit daven entfernt, im Bewußtsein unserer Bevölkerung als ein an sich bejahens-werter Wert verankert zu sein. Im Gegenteil, es erfreut sich mitsamt seinen Trägern und Repräsentanten bei weiten Teilen der Bevölkerung ausgesprochener Unbeliebtheit.
Freilich: der Aushöhlungsprozeß ist noch lange nicht total und auch die erhalten gebliebenen Bestände wirklicher Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind noch immer imponierend, aber wer kann morgen ein Weitergreifen des Übels aufhalten, wenn er heute nicht seine Stimme gegen den in vollem Gang befindlichen Prozeß erhebt? Nehmen wir als Beispiel nur unsere Grundrechte, bei deren Verletzung der Verfassungsgerichtshof angerufen weiden kann und deren Vorhandensein mit Recht als die Krone des liberalen Rechtsstaates angesehen wird. Ist nicht der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz, der der Meinungsfreiheit oder der der Zugänglichkeit aller Ämter für alle Staatsbürger praktisch sehr durchlöchert, ganz einfach durch die Macht der widerstandslos in die angegebene Richtung treibenden soziologischen Entwicklung, ohne feststellbare Verletzung im einzelnen? Können wir blind dafür bleiben, daß auch die Justiz, in einem Rechtsstaat der Inbegriff und Hort aller Unantastbarkeit, nicht mehr ganz außerhalb des politischen Spieles steht, wie es etwa der Fall Sanitzer bewiesen hat? Wird sich nicht in zunehmendem Maße der politische Interventionismus auch zwischen Begehung, Kenntnis und Verfolgung einer strafbaren Handlung schieben?
Der totalen Auslieferung des Staatsbürgers an das Politische und an die Parteien müßte entschlossen und an allen besonders fühlbaren Druckpunkten entgegengetreten werden. Das von kundiger Seite als Ergebnis einer kritischen Studie vorgeschlagene „Proporzverbot“ müßte im Räume der staatlichen Verwaltung Anwendung finden. Ein nach modernen Erkenntnissen eingerichtetes Auslese- und Prüfungssystem sollte die Erstellung geeigneter Kandidaten für die verschiedenen Verwaltungsposten sicherstellen und damit dem Zwang zu einer vorzeitigen und vom Bewußtsein nicht mitvollzogenen politischen Festlegung entgegenwirken. Der Staatsbürger sollte seine Beamten als geschulte und bewährte Exekutionsorgane der von ihm geschaffenen Gesetze und nicht als Befehlsempfänger und Günstlinge der Parteien betrachten lernen.
Ohne eine grundsätzliche, hier nur in einigen groben Zügen skizzierte Umorientierung unseres vom demokratischen Grundgedanken 'unserer Verfassung bedenklich weit abgeirrten staatlichen Lebens laufen wir Gefahr, die bestehende Kluft zwischen soziologischer und politischer Verfassung zu vertiefen und damit unserer jungen Demokratie eine Wunde zuzufügen, die sie, wenn schon nicht zum Tode, so doch zu einer durch Wohlstand gemilderten Krankheit und Anfälligkeit verurteilt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!