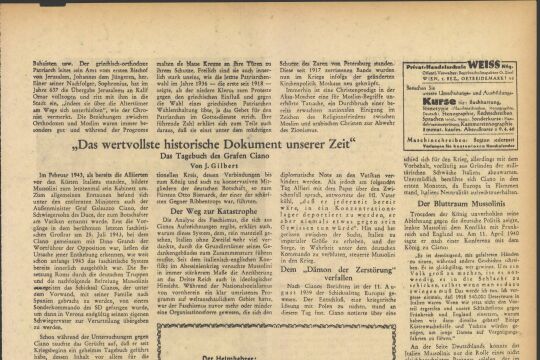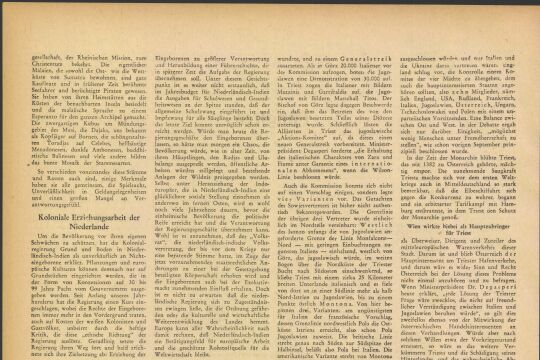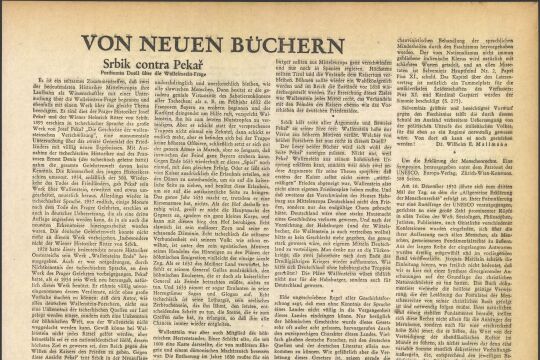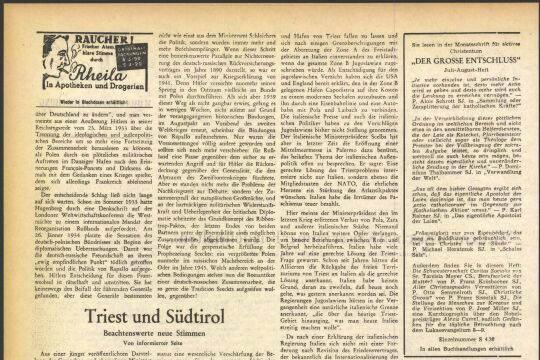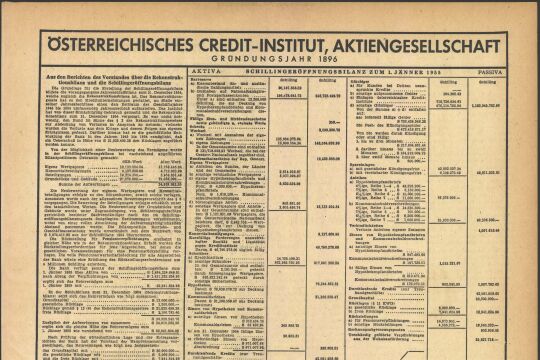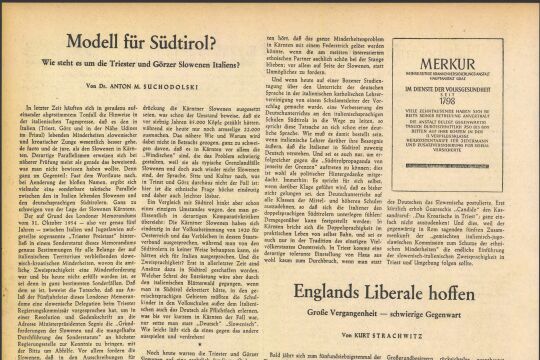Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Feind zeugt für Österreich
Roberto Farinacci war einer der ältesten und einflußreichsten Anhänger Benito Mussolinis. Seit den frühesten Tagen der faschistischen Bewegung gehörte er zum engeren Mitarbeiterkreis des Duce, an dessen Seite er den Aufstieg, die Macht und schließlich den Untergang der Partei erlebte. Ende April 1945 wurde er zusammen mit Mussolini, bei dem Versuch, vor den Alliierten in die Schweiz zu fliehen, von italienischen Partisanen gefangengenommen und hingerichtet. Farinacci, der durch seine Stellung eine genaue Kenntnis von der Frühgeschichte des Faschismus besaß, ist auch der offizielle Geschichtschreiber der faschistischen Revolution. Seine dreibändige „Istoria della revoluzione fascistica“ ist das große Standardwerk der Partei über die Geburt des Faschismus und seinen Weg zur Macht.
Dieses Buch hat für Österreich eine besondere Bedeutung — zumal heute, da es wie eine Stimme aus dem Grabe in den Streit um Triest und die glücklichste und gerechteste Bestimmung seiner Zugehörigkeit tönt. Denn Farinacci, ein Hasser der Habsburgermonarchie, der in ihr das große Hindernis für Italiens nationale Einheit erblickte, wird in dem Werke — welch eine merkwürdige Vertretung! — ein glänzender Zeuge für Österreich.
Gleich am Eingang des Werkes widerlegt er die in Italien so beliebte Fabel, daß Österreich 1914/15 Italien bedroht and zum Kriege gezwungen habe. Im Gegenteil, dieser Krieg — sagt er — „war keineswegs in formeller oder feierlicher Weise vom Ausland (das ist Österreich) provoziert worden, sondern von u n s in einer Art heroischer Wut gewollt“. „Der Krieg“, heißt es weiter, „bedeutete für Italien nicht etwa die wohlüberlegte Entscheidung eines politisch geschulten Volkes, sondern wurde als Ergebnis einer leidenschaftlichen antiparlamentarischen Revolution dem Lande von wenigen aufgezwunge n.“
Von besonderem Interesse sind die Sätze, die Farinacci der österreichischen Verwaltung widmet, auf die er im Zusammenhang mit der Einverleibung Triests in das Königreich zu sprechen kommt. Mit besonderem Kummer erwähnt er, daß zur Zeit der Zugehörigkeit Triests zu Österreich „die herrschenden Kräfte der schwerreichen (italienischen) Bürgerschaft in ihrer politischen Einstellung mit verschwindenden Ausnahmen* österreichfreundlich eingestellt waren“. Ein Großteil der übrigen Bevölkerung dachte „überwiegend sozialistisch“ und wollte nur eine Autonomie innerhalb Österreichs, womit Farinacci sagt, daß auch diese Schichten nicht zu Italien wollten Daneben gab es noch „eine gefährlich zahlreiche, ständig wachsende slawische Minorität“, die natürlich erst recht nichts von einer Einverleibung Triests in Italien wissen wollte. „Diese Slawen“, sagt Farinacci, „wurden zwar von der internationalen Plutokratie Triests verachtet, doch von der wohlerzogenen, maßvollen Beamtenschaft der österreichischen Regierung als Waffe gegen den Widerstand Italiens benützt!“ Proitalieniseh, das heißt für einen „Anschluß“ an das Königreich war nach Farinacci „nur die kleine Schicht des mittleren und niedrigen Bürgerstandes, dessen Feindschaft dem Kaiserreich und seinen Organen galt. In diesen Kreisen wußte man nur zu gut, daß die Hauptstärke Österreichs darin bestand, durch seine einzig dastehende Verwaltung die Leidenschaften einzuschläfern und alle durch einen sicheren Erwerb' so einzulullen, daß für geistige und politische Probleme keinerlei Spielraum mehr übrigblieb.“ — Die Probleme waren die der Irredenta.
Diese kleine Schicht Triests, die den „Anschluß“ an das Königreich wollte, hatte eine große Blüte Triests erhofft und war dann schwer enttäuscht, als das Gegenteil eintrat. Insbesondere war sie von der neuen, schlechten Verwaltung bitter betroffen.
Der ständige Zustrom von Verwaltungs-beamten aus dem ,Regno', die wirklich nicht in sämtlicher Beziehung vortrefflich waren und dfthrer in den Augen des Vollmes im Vergleich zu der früheren Verwaltung fast minderwertig erschien, war Wasser auf die Mühlen des neuaufgeflammten Lokalpatriotismus. Nörgeleien über Bedrückungen und Invasion waren an der Tagesordnung. Auf vielen Mauern prangten die Aufschriften: ,Franz Joseph', kehre zurück, alles verziehen!' “
Farinacci tadelt die a n t i i t a 1 i e n i-s c h e Einstellung der Bevölkerung des „angeschlossenen“ Triest. Unabhängigkeit und bessere Verwaltung müssen doch nicht Hand in Hand gehn, meint er. Hauptsache ist — und darin ist er echter Italiener — die Freiheit.
„Wenn man unter italienischer Unabhängigkeit nur ein besseres Regierungssystem verstand“, schreibt er, „dann mußte man sich die Frage vorlegen, ob denn eine bessere Regierung denkbar gewesen wäre als die österreichische, die eine der gerechtesten war, die Italien je gekannt hat!“ Die Triestiner waren — durch die jahrhundertelange österreichische Verwaltung erzogen — anderer Meinung. Sie sehnten sich nach der alten Beamtenschaft zurück unter der sie als Italiener besser gelebt hatten, als in Italien. Kurze Zeit nach dem „Anschluß“ Triests an Italien kursierte unter der Bevölkerung ein Witz: Die habs-burgische Herrschaft habe es in fünf Jahrhunderten nicht zuwege gebracht, Triest österreichisch zu machen, die italienische Verwaltung habe dies in drei Monaten bewerkstelligt.
Cesare Battisti, Sozialist und Trentiner Irredentist, saigte einmal, das Trentino werde bei seiner Einverleibung in das Königreich dessen gebildetste Provinz sein, da es allein keine Analphabeten besitze.
Der Ausspruch Battistis und die kleine Anekdote aus dem Triest der Nachkriegszeit vervollständigen die Aussagen Farinaccis über die Art, wie Österreich seine italienische Minorität behandelte. Überflüssig darauf hinzuweisen, wie ganz anders Italien mit den Deutsch-Südtirolern verfuhr. Gäbe es heute eine wirkliche freie Volksabstimmung in Triest und auch Italienisch-Südtirol: ob zu Italien oder zu Österreich, so wäre der Entscheid nicht zweifelhaft.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!