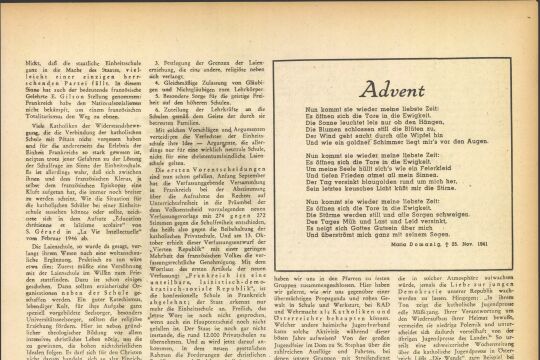Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Requiem in Rot-weiß-rot?
Wir sind vom Grabe Julius Raabs zurückgekehrt. Wenn Verwandte vom Begräbnis eines teuren Menschen heimkehren, gönnen sie sich eine stille Stunde der Besinnung. Nun ist auch die Zeit gekommen, das Testament zu öffnen und in Ruhe seine Vollstreckung zu bereden. Julius Raab apostrophierte in seinem Letzten Willen ausdrücklich alle Österreicher als „meine Anverwandten“. Um so mehr geziemt es uns, bevor wir weiterschreiten, innezuhalten und uns zu fragen: Welchen Ratschlag würde der Mann, von dem Österreich mit so großer Anteilnahme Abschied nahm, seinen Landsleuten für den weiteren, ungewissen Weg in die Zukunft geben?
Julius Raab hat dieses Wort gesprochen. Keine lange Rede, sondern eine schlichte, aber darum eindrucksvollere Bitte: „Aber alle bitte ich inständig, die rotweißrote Fahne hochzuhalten und unser schönes Österreich als einen Hort der Freiheit zu bewahren.“
Die rotweißrote Fahne hochhalten! Schon lange haben wir einen solchen Appell nicht mehr gehört. Jetzt, da er von einem Mann kommt, der ihn bereits im Angesicht der Ewigkeit aussprach, trifft er doppelt. Die rotweißrote Fahne hochhalten! Eine solche Forderung zu erheben galt doch — Hand aufs Herz — in den letzten Jahren beinahe schon als „unzeitgemäß“. Das war eine Angelegenheit für — wie man es mitunter liebevoll nannte — Superpatrioten. Wer solche Sorgen hatte, mochte zu den Leuten in der Strozzigasse gehen. In der „Furche“ würde er an der richtigen Stelle sein. Es gab doch genügend andere Fahnen, die es zu hissen galt. Voran die Fahnen der Parteieninteressen. Dann vielleicht die grüne Europafahne. Für viele, allzu viele, gab es überhaupt keine Fahne — außer die des persönlichen Nutzens und Wohlergehens.
Und nun kommt ein alter Mann, den man stets als nüchternen Realpolitiker kannte, und gibt in seiner letzten Botschaft nicht darüber Auskunft, wie die Stimmen der nächsten Wahl erhöht, die Rentabilität unserer Betriebe gesteigert oder unser Bankkonto „aufgestockt“ werden kann. Nein, als letzten Ratschlag sagt er einfach: Haltet die rotweißrote Fahne hoch! Er ergänzt diese Bitte freilich mit einem zweiten Satz: „Und bewahrt unser schönes Österreich als einen Hort der Freiheit.“
Die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst kommt die Treue zu den rot-weißroten Farben und dann — nur dadurch — die Bewahrung dieses Landes als eines Hortes der Freiheit. Wann immer man glaubte, sich Abstriche von dem vaterländischen Bekenntnis leisten zu können, war es bald mit der Freiheit auch nicht mehr weit her. Dies seinen Österreichern wieder in Erinnerung gerufen, ins Gewissen gesagt zu haben, dafür gebührt Julius Raab von Herzen Dank.
Es könnte freilich jemand kommen und fragen: Schwören nicht heute alle politischen Kräfte dieses Landes auf die rotweißroten Farben? Und wirklich: Sehr zum Unterschied von der Ersten Republik gibt es heute in Österreich kaum Menschen, die die rotweißrote Fahne zurückweisen. Von weit rechts bis ganz links wird sie aufgezogen. „Völkische“ Turner treten ebenso unter ihr an wie kommunistische Friedenskämpfer. Das könnte Befriedigung auslösen, kämen nicht manchmal die Worte eines südamerikanischen Generals in Erinnerung, daß man eine Bewegung am besten bekämpft, indem man ihre Fahne stiehlt. Das mag auch für ein Land, das zugleich für eine Idee steht, seine Gültigkeit haben. Die rotweißroten Farben sind, anders als in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts, heute nicht davon bedroht, attackiert und herabgeholt zu werden — eher sind sie der Gefahr ausgesetzt, mitunter als „Tarnanstrich“ für ganz anderes mißbraucht zu werden.
Es gibt viele rotweißrote Fahnen!
Wir maßen uns nicht an, als Schiedsrichter darüber zu befinden, welche die richtige ist — jene, die Raab gemeint hat, oder eine andere.
Er sagt es uns selbst
Der große Schweiger hat jeweils in knappen Sätzen den Kurs für eine österreichische Staatspolitik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für ein, wie General de Gaulle sagen würde, „österreichisches Österreich“ angegeben. Erinnern wir uns: Da steht.am Anfang der so manche Mißverständnisse, geboren aus Reaktion auf das Tausendjährige Reich, hinwegwischende Satz: „Deutsch ist ■ unsere Muttersprache; unser Vaterland heißt Österreich.“ Daß Julius Raab damit nicht in die Sackgasse vom „zweiten deutschen Staat“ eingebogen war oder gar den neuen Deutschnationalismus ermuntern wollte, wurde klar, als er der FPÖ-Parole von der „unsichtbaren Grenze“ den Satz gegenüberstellte, daß Österreich sehr sichtbare Grenzen habe, ob es sich nun um die Karawanken oder das Karwendelgebirge handle. Und erst die Politik, die zu Staatsvertrag und Neutralität führte! Diese Neutralität ist nicht nur die Krönung von Raabs Wirken gewesen, sie in seinem Geiste zu bewahren ist auch das kostbarste und zugleich heikelste Gut aus der großen Verlassenschaft. Gewiß: Die Neutralität hat ebenso wie die rotweißroten Farben keine offenen Feinde im Lande. Allein, sie kann so und so interpretiert werden. Von Zeit zu Zeit entzündet sich gerade darüber heftiger Streit. Zwischen offenem Neutralismus bis zu einem gerade nicht abgeschlossenen militärischen Bündnis mit dem Westen schwankt die Magnetnadel. Sollte sie je wieder in Unruhe kommen, so wird es sich dringend empfehlen, bei Raab um Auskunft zu bitten. Wer sollte zuständiger sein?
Und wenn manche der Neutralität nach wie vor nur den Charakter eines Kaufpreises zubilligen, so antwortet Raab klar und eindeutig:
„Unsere österreichische Neutralitätsvariante besteht darin, die uralte geschichtlich gewordene und traditionell verpflichtende Brücken-, und Mittler auf gäbe unseres Vaterlandes zwischen den Kräften des Westens und jenen des Ostens neu zu beleben. Unser kleines Land soll ein Stabilisierungsfaktor in Europa sein, und wir sind auch bereit, den Staatsmännern . der Welt unsere guten Dienste und unsere alten Erfahrungen vermittelnd zur Verfügung zu stellen, falls sie gebraucht werden. Dabei will Österreich hinweisen, daß in einer Zeit, in der sich Ost und West nicht mehr zu verstehen scheinen, am geschichtlichen Boden des Donautales Menschen wohnen; die im, der. Lage sind, dank ihrer geschichtlich, erworbenen Fähigkeiten Parlamentäre des Friedens zu sein. Die politische Mission Österreichs getreu seiner Idee muß es bleiben, am internationalen Wegkreuz in Europa die Hand nach beiden Seiten hin auszustrecken und über die Abgründe hinweg zu verbinden, ohne selbst in den Auseinandersetzungen Partei zu ergreifen. Der Verlust des staatlichen Großraumes, die Engen unserer Grenzen wirkten und wirken sich wohl in der Politik und in der Wirtschaft aus, führten aber nicht zu einer Verengung des geistigen Horizontes. Österreich bleibt in seiner Staatsphilosophie wie in seinem wissenschaftlichen Leben weltoffen, trotz Absperrungen nach verschiedenen Seiten.“ („Tag der Fahne“ 1961)
Hier können wir haltmachen. Wir sehen den Weg klar vor uns. Um ihn gehen zu können, um zu einem glücklichen Ziel zu gelangen, erscheint es allerdings notwendig, die Reihen zu schließen und wieder stärker auf die Eintracht im Lande zu sehen. Hier steht es — wir verraten damit kein Staatsgeheimnis — nicht zum besten. Seit über einem Jahr ist die Zusammenarbeit der beiden großen Parteien eine Zusammenarbeit auf Abruf. Mit allen Folgeerscheinungen. Unsicherheit hat sich ausgebreitet, Mißtrauen wuchert, manche Auflösungserscheinung wird trotz anhaltender, ja sogar wieder steigender wirtschaftlicher Konjunktur sichtbar. Das merkt man nicht nur oben; das bekommt man immer häufiger auch in dieser oder jener Variation von kleinen Leuten zu hören. Und das ist schlimm. Mitunter, glaubt man sich — mutatis mutandis — sogar in die „Welt von gestern“, in das Österreich unserer Großväter zurückversetzt. So und nicht viel anders könnte es gewesen sein um die Jahrhundertwende, als dem suchenden Blick keine neuen Horizonte sich auftaten. Der Zufall will es, daß im theoretischen Organ des österreichischen Sozialismus gerade in dieser Woche der Aufsatz eines Wiener Publizisten, der am 1. Jänner 1900 eine österreichische Gewissenserforschung anstellte, wiedergegeben wird. Hier können wir lesen: ,
„Als Kaiser Franz die Wagramer Schlacht vom Bisaniberge aus mit ansah, da sagte er die Niederlage des linken Flügels kalt lächelnd voraus: ■ ,Da commandirt ja der Fürst Eosenberg -r der wird immer gesehlagen.' Das war ein echt österreichisches Wort. Wir sehen die Niederlagen und Katastrophen als etwas Unvermeidliches an und wir ergehen uns darein mit einer ironischen Wendung. Es hilft nichts mehr! Kein zweites Land in der Welt gibt es, in welchem der Patriotismus so gänzlich zu einer Kedensart des Schulbuches und zu einem Requisit des offiziellen Amtsgebrauches herabgesunken ist wie in Österreich. Doch wahrlich nicht ohne Grund. Unser großer Volksdichter Anzehgruber läßt im .Vierten Gebot' den armen Sünder Martin zu seinem geistlichen Tröster sprechen: .Wenn du in der Schul' den Kindern lernst: ehret Vater und Mutter, so sag's auch von der Kanzel den Eltern, daß s' danach sein sollen.' Das Gebot der Vaterlandsliebe braucht den nämlichen Zusatz wie das der Elternliebe: auch das Vaterland ,soll danach sein'.“
Könnte diese Überlegung nicht auch in unseren Tagen angestellt worden sein? Das Vaterland „soll danach sein“.
Im Dom zu St. Stephan stand ein Sarg, bedeckt mit der rotweißroten Fahne. Requiem! Requiem in Rotweiß-rot? Nicht nur berufsmäßigen Pessimisten könnte sich eine solche Frage aufgedrängt haben. Der Sarg wurde in die Heimaterde gesenkt. Erde zu Erde, Staub zu Staub ... Uns aber ist nichts anderes aufgetragen, als alles einzusetzen, daß Österreich nie mehr ein Requiem gesungen werde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!