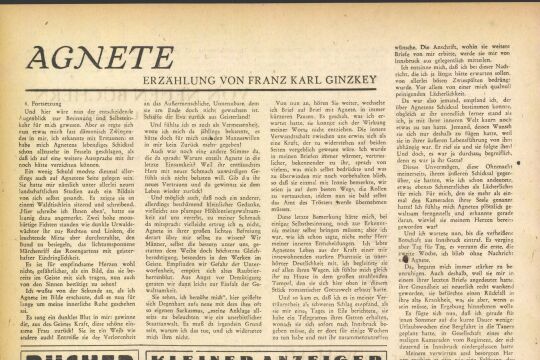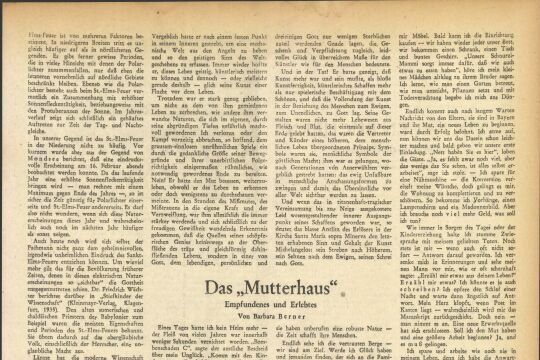Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Es war doch so schön
Ich wurde in Rußland, im Ural, geboren und wuchs in einer Familie auf, für die das Glück der Kinder und ihre Erziehung alles galt. Jedes Jahr machten wir große Reisen, nach Petersburg, Moskau, in den Kaukasus und in die Krim, oder mit dem Schiff die Kama und Wolga entlang, bis nach Zaritzyn (heute Stalingrad). Es gab da eine ungeheure Fülle von Eindrücken; ein Erlebnis blieb mir besonders im Gedächtnis haften: auf dem Schwarzen Meer wurde unser Schiff schwer beschädigt, und wir schwebten in höchster Lebensgefahr; da rettete uns das Torpedoboot, das den Zaren auf seiner Reise nach Jalta begleitete.
Schon als Kind hatte ich einen besonderen Eifer zum Lernen. Im Gymnasium studierte ich mit großer Begeisterung, und ein durch Krankheit verursachter Untenichtsausfall bedeutete für mich geradezu eine Qual. Nach Absolvie-rting des Gymnasiums inskribierte ich mich an der philosophischen Fakultät; auch dort war mir das Studium ein herrliches Erleben, um so mehr, als einige meiner Professoren Gelehrte allerersten Ranges waren. Jeden Abend bedauerte ich, daß der Tag schon vorbei war.
Dann kam die bolschewistische Revolution. Sie beraubte meine in Wohlstand lebende Familie nicht nur aller Mittel, sondern der nun fsezenei..jgrausame Terror zwang uns:,auch zur Flucht nach Sibirien, wo ich an der Universität Irkutsk mein Studium fortsetzte. In Sibirien lernte ich nun den damaligen österreichischen Kriegsgefangenen Dr. Arnulf von Höyer kennen (in meinen Tagebüchern nannte ich ihn Otmar Wagner), den ich bald darauf heiratete. In meine Heimatstadt zurückgekehrt, schloß ich mein Universitätsstudium — in den Fächern Psychologie und russische Literatur — ab, wenige Tage vor der Geburt unseres Sohnes Jurka. Ich wollte mich der Hochschullaufbahn widmen und begann damit als Assistentin meines Psychologieprofessors. 1925 wurde ich aber, zusammen mit meinem Manne, der damals Sprachwissenschaft lehrte, aus Sowjetrußland ausgewiesen. Wir mußten dort alles zurücklassen, und mit zwei Köfferchen kamen wir nach Oesterreich, in die Heimat meines Mannes. Da dort damals, besonders in den intellektuellen Berufen, eine katastrophale Arbeitslosigkeit herrschte, brachten wir uns in der ersten Zeit durch die Führung eines kleinen Milchgeschäftes in.einer Wiener Vorstadt durch. Statt Vorlesungen zu halten und mich mit Wissenschaft zu beschäftigen, verkaufte ich nun Milch, Butter und Eier. Ueber diese dunklen Tage half mir mein Prinzip hinweg, daß man das Leben immer genau so nehmen müsse, wie es gerade ist, und daß im Grunde genommen jede Arbeit der anderen gleichwertig ist, wenn man sie nur nach bestem Gewissen ausführt.
Nach zwei Jahren erhielt mein Mann endlich eine Anstellung als Pädagoge in seiner Heimatstadt, im wunderschönen Salzburg. Bei dem kleinen Anfangsgehalt war das Leben immer noch sehr schwer, aber mit dem Beginn der Herausgabe meiner Tagebücher (1931) — ich führe seit meinem sechsten Lebensjahre Tagebuchaufzeichnungen — gelangten wir zu Wohlstand und ich konnte mich nun ganz der schriftstellerischen Arbeit widmen. Meine Bücher hatten bald großen Erfolg, auch im Ausland (es liegen Ueber-setzungen in 21 Sprachen vor), und 1936 erhielt ich in Paris in einem internationalen Ausschreiben den ersten Preis für den besten antibolschewistischen Roman. Vortragsreisen führten mich durch Oesterreich, Deutschland, die Schweiz und Ungarn. Diese schöne und dabei sehr produktive Zeit nahm mit der Besetzung Oesterreichs durch die Nationalsozialisten ein jähes Ende. Meine Bücher wurden wegen ihrer christlichen Grundhaltung verboten, es wurde mir jede schriftstellerische Arbeit untersagt, und sö, wie einst in Sowjetrußland, wußten wir wiederum nicht, was uns der nächste Tag bringen könnte. Doch dann kam das Schrecklichste: unser einziger Sohn Jurka, ein lebensfroher, begabte?, Student der Medizfn,!öl am Ostersonntag 1945, am ersten April, vor Wien, im Alter von 23 Jahren, nachdem er vier Jahre lang alle Mühsale des Krieges als Soldat in der deutschen Armee mitgemacht hatte. Bei Kriegsende, gefährdet durch die herannahenden Sowjetrussen, gingen wir als Flüchtlinge in die schöne freundliche Schweiz, wo wir wiederum, schon zum vierten Male in meinem Leben, sozusagen von vorne anfangen mußten. Meine schriftstellerische Betätigung war mir auch jetzt noch außerordentlich erschwert, da nämlich in Oesterreich und in Deutschland auch die Alliierten meine Bücher verbaten (auf Verlangen der Sowjetrussen). Jedermann kann es sich leicht vorstellen, was es für einen Schriftsteller bedeutet, elf Jahre lang verboten zu sein! Nachdem wir uns vier Jahre in Winterthur aufgehalten hatten, leben wir nun schon das neunte Jahr still und zurückgezogen in unserem Häuschen im malerischen Dörfchen Ettenhausen, wo alle lieb und gut zu uns sind und wo wir endlich wiederum die Möglichkeit haben, uns in Ruhe unserer Arbeit zu widmen.
Trotz des Schrecklichen, das mir das Schicksal zugedacht hatte (fünf Kriege, Verfolgungen, Kummer und Not, und als das Schwerste, den Tod des einzigen Kindes), ist mir meine bejahende Einstellung zum Leben und meine glühende Liebe zu den Menschen dieselbe geblieben, wie sie es schon in den Tagen meiner Kindheit war. Lind was mir geholfen hat, alles Unglück zu ertragen, das war mein tiefer Glaube an Gott, sowie meine glückliche Ehe.
Seit meinem sechsten Lebensjahre führe ich Tagebuchaufzeichnungen, über alles, was ich Sehe, erlebe, was mein Fühlen und Denken bewegt, und dies ist mir immer etwas geblieben, was wesentlich zu meinem Dasein gehört. Von den 15 Büchern, die ich bisher geschrieben habe, enthalten“ acht Teile aus meinen Tagebüchern. Die anderen sieben sind aus meiner wissenschaftlichen Arbeit erwachsen, die in erster Linie der russischen Literatur- und Geistesgeschichte, vor allem des 19. Jahrhunderts, gewidmet ist und die ich zusammen mit meinem Manne führe (er ist selbst Philologe und übersetzt alle meine Buchmanuskripte ins Deutsche). Immer wieder drängt es mich dabei, die Großen der russischen Geisteswelt einem breiteren Leserkreise näherzubringen. Da dies natürlich nicht durch Fachpublikationen geschehen kann, wählte ich dazu die literarische Form, und ich bemühe mich, die Menschen und Geschehnisse so zu schildern, daß sie dem Leser in Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit lebendig werden. Meine Arbeit aber, aus der diese Bücher ja entspringen, sowie meine Einstellung zu.der Frage, was überhaupt die Aufgabe eines Biographen sei, verpflichten mich, mich nicht nur in den großen Linien an die Wahrheit zu halten, sondern auch in den Details — z. B. Milieu, Kostüme, Dialoge, Stimmungen usw. — dem tatsächlich Gewesenen gerecht zu bleiben, soweit es nur irgend möglich ist. Dazu ist natürlich das Heranziehen eines ganzen Meeres von Tagebüchern, Briefen, Memoiren usw. erforderlich, und zwar nicht nur der Person, über die ich schreibe, sondern auch der Nebenpersonen, sowie von Zeitgenossen, die das Milieu der
Epoche charakterisieren können. Diese ganze Literatur arbeite ich nun solange durch, bis Mir die Menschen, ihr Leben, Denken und Fühlen ganz lebendig werden und bis mir auch ihre Beziehungen untereinander völlig vertraut geworden sind. Dies braucht natürlich viel Zeit, und trotzdem ich im russischen Geistesleben des 19. Jahrhunderts schon Jahrzehnte lang gut zu Hause bin, muß ich auf das Studium des Helden, den ich mir gerade erwählt habe, immer noch im. Speziellen Jahre verwenden. Ueberhaupt muß ich sagen, daß es viel schwerer ist, eine Biographie in literarischer Form zu schreiben, als in rein wissenschaftlicher, denn in ihr soll man von dem geschilderten Menschen nicht nur alles Mögliche erfahren, sondern er soll auch noch leben, man soll ihn sehen und fühlen können. Anton Tschechow, der große Dichter, Verfasser ganz meisterhafter Novellen, behauptete einmal, daß bei der literarischen Arbeit nicht das Schreiben die Hauptsache sei, sondern der Mut zum Streichen. Nun, Mut gehört abefr auch wirklich dazu, ganze Seiten wegzulassen, wenn man oft schon wegen ein paar Zeilen ganze Bücher durchstudiert hat und wenn man denkt, alles, wag diese Großen des Geistes erlebt, gefühlt und erduldet haben, müßte doch für den Leser von Interesse sein. Trotzdem muß aber wiederum gestrichen werden, und überdies darf man oft nur wenige Worte verwenden, um das auszudrücken, was man ursprünglich in einem anschaulichen Bilde oder in einer lebendigen Szene darstellen wollte. Ist das Manuskript dann wirklich abgeschlossen, und liegt das gedruckte Buch vor mir, erkenne ich es selbst fast nicht mehr, so viel vermisse ich in ihm von dem, was mir im Laufe! der langen Arbeit lieb geworden war und ganz unentbehrlich zu sein geschienen hat. Langsam erst gewöhne ich mich an das Buch und beginne es zu lieben, wobei es aber in meinem Herzen immer noch in dem Umfange weiterlebt, in dem ich es gerne geschrieben hätte ...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!