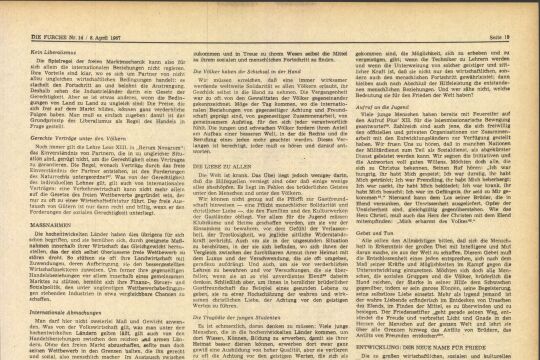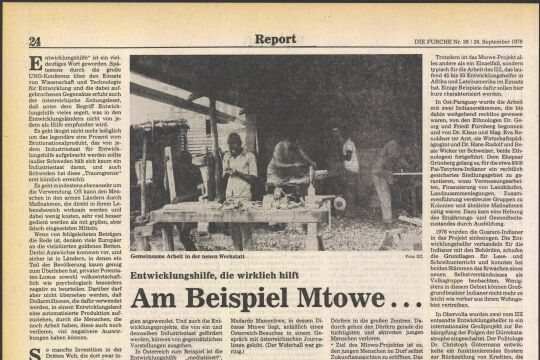Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Explosion der Hungerbombe?
In Beirut fand — vom 21. bis 27. April — die erste gemeinsame Konferenz der päpstlichen Kommission „Gerechtigkeit und Frieden” und des Arbeitsausschusses „Kirche und Gesellschaft” des Weltkirchenrates statt. Sie befaßte sich mit dem Problem der wirtschaftlichen Entwicklung. Ein Tagungshöhepunkt war das Referat des argentinischen Entwicklungsexperten Raoul Pre- bisch. Es gipfelte in der Feststellung, man brauche die Hilfe der Kirchen, um die Solidarität der Menschen zu verwirklichen und eine gerechte Verteilung der irdischen Güter herbeizuführen. Anders formulierte ein nichtchristlicher Konferenzbeobachter das gleiche Anliegen: „Wenn die Kirche Christi nicht kompromißlos eintritt für die Unterentwickelten, die Schwachen, die Armen und die Entrechteten, ist sie nicht wert, daß es sie noch gibt!”
Nach der Beiruter Tagung wird niemand mehr behaupten können, die Kirchen würden sich darum drücken, diesen Auftrag zu erfüllen. Bei den Konferenzteilnehmern handelte es sich nicht um Revolutionäre; um so aufsehenerregender war ihre Haltung zur Entwicklungshilfe als dem wichtigsten Jahrhundertproblem. Sie begnügten sich nicht mit hilflosen Gewissensappellen, sondern wurden sich hinsichtlich der künftigen überkonfessionellen kirchlichen Hilfsaktionen, einig über ein zweigleisiges sozial-politisches Engagement.
Dazu bedürfe es, wie wiederholt betont wurde, vor allem zweier Voraussetzungen: Erstens müsse verhindert werden, daß Hilfsbereitschaft und Hilfeleistungen in den zuständigen Ausschüssen der einzelnen Gliedkirchen versickern. Sie müßten dadurch wachgehalten werden, daß der Weg „vom Klingelbeutel bis zum Elendsviertel” möglichst kurz und überschaubar bleibe und möglichst rasche und sichtbare Erfolge erzielt würden. Letzteres solle vor allem gewährleistet werden durch die Bildung von Selbsthälfe- gruppen, in denen die kirchlichen Entwicklungshelfer unter anderem Hausfrauen die bessere Planung der verfügbaren Gelder und die rationellere Verwendung der Lebensmittel, Säuglingspflege und Kindererziehung, Kleinbauern die maximale Bodennutzung und marktgerechtere Produktionsmethoden zu lehren hätten.
Zweitens, und das war zweifellos das aufsehenerregendste Konferenzergebnis bejahe die katholische wie die protestantische Moraltheologie als letzten Ausweg auch revolutionäre Aktionen. Noch blieben es einzelne, die sogar vom „Recht auf Revolution” sprachen. Doch sie mahnten unüberhörbar.
Die Konferenz war darüber einig, die Kirchen müßten das Gewissen sein, welches die Regierungen und internationalen Institutionen, vor allem die Vereinten Nationen, dahingehend zu beeinflussen habe, wesentlich mehr als bisher für die unterentwickelten Völker zu tun. Die Kirchen müßten darauf dringen, daß Entwicklungshilfe ausschließlich von wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Gesichtspunkten beeinflußt werde, nicht von kurzsichtigem politischem Prestigedenken oder außenpolitischen Zweckmäßigkeitserwägungen. Es gehe nicht an, daß Entwicklungshilfeprojekte nur verwirklicht würden, um den jeweiligen Regierungen des Geber- und des Nehmerlandes Prestigegewinne zu ermöglichen oder sich wirtschafts- und handelspolitische Vorteile zu erschließen oder neue Märkte zu sichern. Die meisten Entwicklungsländer brauchten keine aufwendigen Stahlwerke oder riesenhaften Staudämme, sondern zwar weniger sichtbare und spürbare, aber langfristigere und erfolgversprechendere Programme gegen den Hunger und für die Erziehung der rückständiger Bauern, gegen Krankheiten und für kostenlose öffentliche Gesundheitsfürsorge, gegen Analphabetismus und für Lehrerbildung, Schulgeldfreiheit und sinnvolle Berufsausbildung.
Kritisiert wurde auch die Praxis, Studenten aus dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Lateinamerika mit kostspieligen Staatsstipendien an den Universitäten und Hochschulen der Industriestaaten ausbilden zu lassen. Häufig bleiben sie dann in den Gastländern hängen oder kommen mit zwar mangelhaftem Fachwissen, aber maßlosem Hochmut zurück. Vorzuzishen sei daher ihre Ausbildung durch ausländische Experten an den Instituten ihrer Heimatländer. Hier gebe es noch wichtige Aufgaben für die Kirchen, und zwar vor allem durch die Heranbildung, Entsendung oder Finanzierung von wissenschaftlichem. technischem und handwerklichem Lehrpersonal.
Gerügt wurde die sowjetische Entwicklungspolitik. Sie sei vorwiegend ein expansionistisches Machtinstrument. Vor allem beruhe sie allzu sehr auf rein militärischen Lieferungen oder der Förderung wenig oder gar nichts versprechender politischer Prestigeprojekte.
Die Beiruter Konferenz brachte eine spürbare Distanzierung der kirchlichen von der staatlichen Entwicklungspolitik der westlichen Nationen. In den Referaten und Diskussionsbeiträgen klang immer wieder durch, worin sich die kirchliche von der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungshilfe unterscheide: Die Kirche müsse tun, was den Staaten so schwer falle, sie allen könne helfen ohne politische Absicht.
Bevölkerungsprobleme sind nicht mit der „Pille” allein zu lösen
Viel Zeit widmeten die Tagungsteilnehmer der Lage in Südamerika. Hier sei vor allem zu kämpfen für Landreformen und gerechte Steuern. Beides bildet aber auch das Rezept, mit dem die Entwicklungsprobleme nicht nur des amerikanischen Subkontinentes, sondern der eines Drittels der Menschheit zu lösen ist. Täglich werden auf der Erde gegenwärtig 180.000 Menschen, das ist die halbe Bevölkerung Luxemburgs, geboren. Das führt beinahe zwangsläufig, wie einer der Tagungsteilnehmer feststellte, spätestens Ende dieses Jahrhunderts zur Explosion der Hungerbombe. Doch obwohl sich die internationalen Gremien seit langem darüber einig seien, daß die reichen Länder mindestens ein Prozent ihres Bruttosozialproduktes für die Entwicklungshilfe aufwenden müßten, werde dieses Minimum nicht erreicht. Trotzdem müsse heute schon konstatiert werden, daß die Industriestaaten zur Bewältigung des Hungers in der übrigen Welt mindestens zwei Prozent ihres Bruttosozialproduktes bereitstellen müßten.
Die Kirchen ließen es in Beirut jedoch nicht mit Vorwürfen gegen egoistische Regierungen bewenden. Sie beschlossen konkrete Selbsthilfemaßnahmen, wobei sich zeigte, daß das weniger ein Geldproblem als eine Sache der moralischen Überzeugung ist. Hunger könne man nicht allein durch Geburtenregelung beseitigen, betonte man in Beirut, und diese sei weniger zu erreichen durch den Ruf nach der Pille als durch Erziehung zur sittlichen Verantwortung und zum Kampf jedes einzelnen für eine bessere Zukunft. Aufzuklären und zu lehren aber sei hauptsächlich Pflicht der Kirchen.
Pharisäer gab es kaime auf dieser Konferenz. Zu nahe war dazu wohl auch das Heilige Land. Von der libanesischen Hauptstadt äsit es nur ein Katzensprung bis nach Galiläa. Wenige Autostunden trennten die Südgrenze vom Nazareth, wo Jesus Christus lebte und predigte, und vom Jordan, wo der Täufer Johannes beschwörend rief: „Tut Buße!”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!