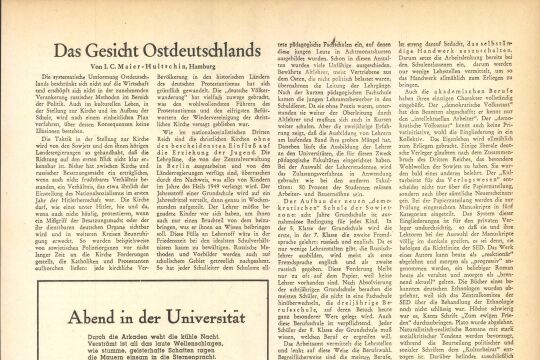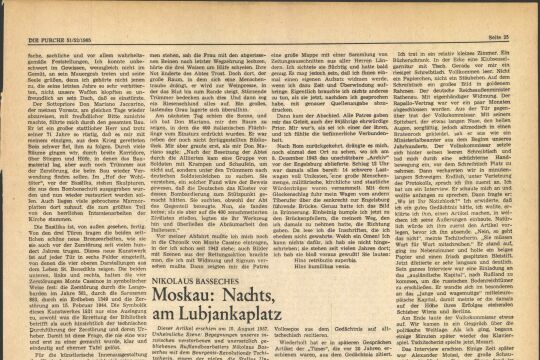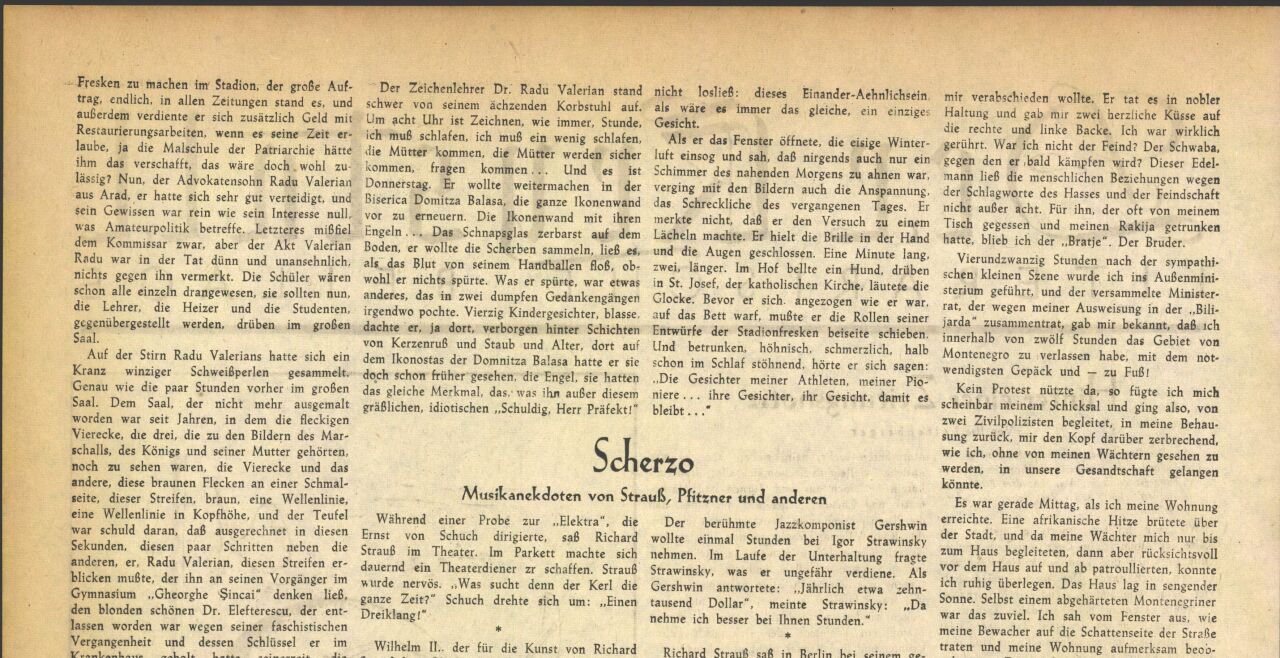
Gegen Ende Juli 1914 befand sich Montenegro, obzwar der König dem österreichischen Gesandten, Herrn Otto, immer wieder versicherte daß er unter keinen Umständen an einem Krieg gegen die österreichisch-ungarische Monarchie teilnehmen würde, in voller Mobilisierung. Ich bin überzeugt, daß die Versicherungen des Königs kein falsches Spiel, sondern ernst gemeint waren. Nichts hätte er seinem Land und Volk lieber erspart als einen Krieg. Er war scharfsinnig genug, zu wissen, daß er sein gewinnbringendes Spiel zwischen Rußland, Oesterreich und Italien nur im Frieden betreiben könne. Er wollte nur nicht eingestehen, daß er dem, Willen seiner russophi-!en Familie gegenüber machtlos sei und seine Beteuerungen daher, wie aufrichtig sie auch gemeint waren, nur problematischen Wert hatten. Diese These vertrat ich schon damals in Cetinje dem Gesandten gegenüber, was mich in einen heftigen Gegensatz zu ihm brachte. Einige Tage Vgl. „Die Furche“ (Krystall) Nr. 4 und s/1955.lang ging es in Cetinje lebhaft zu. Man bewarf die Fenster der Oesterreicher mit Steinen, machte ihnen Katzenkonzerte, beschimpfte sie auf der Straße, und zuletzt wollte man ihnen auf dem Markt nichts mehr verkaufen. Aber auch diese Haßwelle legte sich, und nun konnte man ruhig zusehen, wie die mobilisierten Männer in der traditionellen Begleitung ihrer Frauen auf den Lovcen zogen, um dort den ihnen bestimmten Abschnitt zu besetzen. Die Frau hatte in der montenegrinischen wahren Volksarmee eine sehr wichtige Funktion. Da es keine eigentliche Intendanz gab, hatte sie für den Nachschub und Ernährung der Krieger zu sorgen und teilte somit alle Gefahren der Feuerlinie.
Eines Nachmittags stand ich vor unserem Haus in der Katunska iilice, der Hauptverkehrsader der Residenz. In langen Reihen, bequemen Schrittes zogen die Mobilisierten ohne sichtbare Begeisterung in den Krieg, als plötzlich ein Mann aus der Reihe trat und zu mir kam. Es war mein Hausherr, der Kapetan. der sich von mir verabschieden wollte. Er tat es in nobler Haltung und gab mir zwei herzliche Küsse auf die rechte und linke Backe. Ich war wirklich gerührt. War ich nicht der Feind? Der Schwaba, gegen den er ,bald kämpfen wird? Dieser Edelmann ließ die menschlichen Beziehungen wegen der Schlagworte des Hasses und der Feindschaft nicht außer acht. Für ihn, der oft von meinem Tisch gegessen und meinen Rakija getrunken hatte, blieb ich der „Bratje“. Der Bruder.
Vierundzwanzig Stunden nach der sympathischen kleinen Szene wurde ich ins Außenministerium geführt, und der versammelte Ministerrat, der wegen meiner Ausweisung in der „Bili-jarda“ zusammentrat, gab mir bekannt, daß ich innerhalb von zwölf Stunden das Gebiet von Montenegro zu verlassen habe, mit dem notwendigsten Gepäck und — zu Fuß!
Kein Protest nützte da, so fügte ich mich scheinbar meinem Schicksal und ging also, von zwei Zivilpolizisten begleitet, in meine Behausung zurück, mir den Kopf darüber zerbrechend, wie ich, ohne von meinen Wächtern gesehen za werden, in unsere Gesandtschaft gelangen könnte.
Es war gerade Mittag, als ich meine Wohnung erreichte. Eine afrikanische Hitze brütete über der Stadt, und da meine Wächter mich nur bis zum Haus begleiteten, dann aber rücksichtsvoll vor dem Haus auf und ab patroullierten, konnte ich ruhig überlegen. Das Haus lag in sengender Sonne. Selbst einem abgehärteten Montenegriner war das zuviel. Ich sah vom Fenster aus, wie meine Bewacher auf die Schattenseite der Straße traten und meine Wohnung aufmerksam beobachteten. „Da werde ich versuchen, ein wenig Fregoli zu spielen“, dachte ich und zog mich schnell um. Statt des weißen Schantunganzugs kleidete ich mich in Dunkelgrau um, setzte einen breitrandigen Panamahut auf, trat auf die Gasse und ging gemächlichen Schrittes in der Richtung unserer Gesandtschaft, die von meiner Behausung kaum hundert Schritte entfernt lag. Als meine Wächter die List merkten, liefen sie mir zwar nach, ich aber war inzwischen beim Tor der Gesandtschaft hineingeschlüpft und ihren Griffen entgangen.
Der Gesandte hatte keine große Freude • an mir. Er war ein vorsichtiger Mann, dem Konflikte verhaßt waren. Da ich aber seine sofortig Intervention forderte, blieb ihm nichts anderes übrig, als in einer kurzen Note den Außenminister Plamenac zu bitten, entweder in die Gesandtschaft zu kommen oder aber, ihn sofort zu empfangen. Als Plamenac, eine Hüne von Gestalt, erschien, überließ er die Verhandlungen mit ihm mir. Nach längerer Debatte einigte ich mich mit Plamenac dahin, daß meine Frist, die um Mitternacht ablief, verlängert wurde, weiter, daß das Außenministerium einen zweispännigen Wagen zu besorgen hatte, der mich mit Gepäck bis zum Grenwächterhaus in Njegus transportieren solle. Dies ließ ich mir von Seiner Exzellenz schriftlich bestätigen, und wir schieden dann nach warmem Händeschütteln und Glückwünschen — Sretan Put — als gute Freunde. Daß sein erstes, wie er in das Ministerium zurückkam, gewesen war, nach Njegus zu depeschieren und dem Chef der Grenzwache, einem königlich montenegrinischen Oberst, den Befehl zu geben, den „heute nacht um 10 Uhr von der Gesandtschaft abgefahrenen Oesterreicher zu verhaften und nach Cetinje mit derselben Gelegenheit, wie gekommen, zurückzuschicken“, das wußte ich damals noch nicht. Punkt 22 Uhr fuhr ein Wagen, ein bequemer Fiaker, bei der Gesandtschaft vor, und ich stieg in den Wagen, meina Handtasche in der Gesandtschaft zurücklassend, da mir der Sekretär versprach, sie entweder selbst zu bringen oder durch die englische Gesandtschaft mir nach Cattaro nachzuschicken. Um Mitternacht war ich in Njegus Der Oberst empfing mich mit der Mitteilung, daß ich sofort nach Cetinje zurückzukehren habe. Vor dieser Katastrophe rettete mich ein reiner Zufall, und ich bin dem Mann, der diesen Zufall veranlaßte, noch heute dankbar, denn es ist unzweifelhaft, daß ich, wenn der Haftbefehl durchgeführt worden wäre, bis zur Eroberung Montenegros lange Jahre als Kriegsgefangener in Montenegro hätte verbringen müssen. Dieser Deus ex machina war ein früherer Leichtmatrose des Oesterreichischen Lloyds, der einige Zeit unter mir gedient hatte und nach seinem Ausscheiden aus dem Seedienst die Funktion eines Zollbeamten in Njegus ausübte. Damals, als ich in Njegus eintraf, diente er als Kapetan beim Abschnittskommando, und seine Freude war groß, als er, mich begrüßte. Als ihm der Oberst dann mitteilte, daß ich auf Grund einer Depesche aus Cetinje verhaftet sei und dorthin zurückkehren müsse, trat er warm für mich ein. Er erklärte dem Obersten, daß die Depesche sich nicht auf mich, sondern auf den Sekretär der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft, Herrn Golom-bani. beziehe Er möge nur in der gestrigen Depeschenpost nachsehen! Dort stehe es ausdrücklich mit Namen, daß der Sekretär zurückzubeordern sei - und ich sei keinesfalls dieser Sekretär! Der Oberst ließ sich leicht überreden, wir tranken noch schnell einen türkischen warben Bergen Kaffee, rauchten einige Zigaretten, und mein Schutzengel erhielt den Befehl, mich bis zur Grenze zu bringen, wie es in meinem Ausweisungsbefehl steht.
Es war finstere Nacht, als wir auf der Straße nach Cattaro kräftig losschritten. „Höre nur, Herr Commissario“, sagte mein Begleiter. „Ich weiß, daß man dich und nicht den Colombani verhaften soll. Aber du warst immer gut zu mir im Dienst am Schiff, und ich will nicht schlechter sein als du. Wenn du auf dem großen Serpentinenweg gehst, so könnte in dieser langen Zeit, bis du die Grenze erreichst, irgendein neuer Befehl aus Cetinje kommen. Siehst du da diesen schmalen Pfad? Das ist der Ziegenweg. Diesen Weg gehen wir Cernagorzen, wenn wir Tabak nach Oesterreich schmuggeln. Der Weg ist nicht gut, aber kurz. Wenn du schnell gehst, kannst du in anderthalb Stunden bei Fort San Giovanni sein und du bist frei in Oesterreich. Gib acht, wohin du deinen Fuß hinsetzt, denn der Boden läuft hier leicht davon und du bist in der Tiefe. „Bog po'zivio — i sretan put.“ — Und ich trat dann, begleitet von den Segenswünschen meines Schiffskameraden, den Abstieg in der stockfinsteren Nacht an, auf einem Weg, der selbst für Ziegen ein kleines Abenteuer war.
Langsam tastete ich mich abwärts, bis im Osten die Dämmerung eintrat Es wurde schnell hell. Da sah ich erst, daß ich meine Kleider zerrissen hatte und meine Hände bluteten. Nur vorwärts. Immer vorwärts, und um so schneller, als ich gleich beim ersten Schatten der Dämmerung weit hinter mir Gewehrfeuer hörte. Ich zweifelte nicht daran, daß man auf den Irrtum daraufgekommen war und, mich verfolgend, jetzt blindlings ins Nichts hineinfeuerte. Aus der Dämmerung wurde schnell Licht. Ich war etwa 700 Meter über dem Meeresspiegel und unter meinen Füßen lagen die ganze Bocche di Cattaro, die albanische Küste und in weiterer Ferne die schneeglänzenden albanischen Alpen. Viel Schönes habe ich in meinem Leben in allen Erdteilen gesehen, aber etwas Schöneres als diese Märchenlandschaft, eingetaucht in das Silber der weit draußen am unendlichen Meereshorizont aufgehenden Morgensonne, sah ich nie mehr. Etwa zweihundert Meter unter mir sah ich die altersgrauen Mauern der alten venezianischen Feste San Giovanni, die jetzt zu einem österreichischen Artilleriestand umgebaut wurde. Dort war die Grenze. Dort war die Freiheit!
Es war etwa vier Uhr früh, als ich die Höhe des Forts erreichte und mich, nunmehr meiner Sicherheit bewußt, auf einen Felsblock setzte. Plötzlich tauchten zwei österreichische Gendarmen auf, die mit schußbereitem Gewehr auf mich zugingen. „Sie sind verhaftet!“, schrien sie gleichzeitig, und mich erfaßte eine solche Lustigkeit, daß ich einen Lachkrampf bekam. Die Gendarmen schauten verdutzt drein und merkten daß sie mit mir keinen besonderen Fang gemacht haben. Aber verhaftet ist verhaftet. Wir schritten tüchtig aus und waren gegen 6 Uhr früh im Hafen. Unmittelbar vor dem alten venezianischen Tor, das in die Stadt führt, an der „Marina“, der Promenade der Schönen von Cattaro, stand ein hübsches Kaffeehaus, das trotz der frühen Morgenstunde schon in Betrieb war. In Cattaro, diesem vor allem militärischen Ort sind die Menschen Frühaufsteher. Die frischen Kaisersemmel und Kipfel von märchenhaften Dimensionen leuchteten goldgelb und der Kaffee duftete verführerisch. Wer könnte nach einem so anstrengenden Fußmarsch, wie es der Ziegenwej: von Njegus nach'Cattaro ist, solcher Lockung widerstehen? Ich lud meine neuen Bewacher zu einem kleinen Frühstück ein und wir tranken dort den besten Kaffee meines Lebens — oder kam es mir nur so vor? Dann bat ich sie, mich zum Bezirkshauptmann Budisawlevitsch zu führen, dem ich wichtige Mitteilungen zu machen habe.
Der liebenswürdige, echt österreichische Verwaltungsbeamte, der seinen schwierigen Posten glänzend versah, empfing mich mit großer Freude und Neugierde. — „Wie steht es in Cetinje?“ -war seine erste ungeduldige Frage. — „Die Berichte, die ich von dem Gesandten bekomme lauten optimistisch und versichern, daß es hier keinen Krieg geben werde. Aber das Divisions-kommando drängt auf Evakuierung. Was soll ich da machen?“ — Die Situation entsprach hier, an diesem neuralgischen Punkt der Bocche, ganz der Kontroverse, die mich vom Gesandten Otto trennte, und ich machte daraus auch dem Bezirkshauptmann gegenüber kein Hehl. — In der eine Stunde später einberufenen Sitzung der Zivil- und Militärbehörden, zu der mich der Bezirkshauptmann zuzog, setzte ich die Lage auseinander und trat für alle für den Kriegsfall notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, als unmittelbar erforderlich, ein. Die Beobachtungen, die unsere vorgeschobenen Beobachtungsposten auf der Festung Vermac machten, sprachen für die höchste Alarmbereitschaft der Montenegriner, und so wurde beschlossen, mit der Evakuierung Cattaros sofort zu beginnen. Es war ja auch höchste Zeit, denn Cattaro stand unter dem direkten Feuer der Lovcengeschütze und konnte innerhalb von einigen Stunden zusammengeschossen werden. Daß die Montenegriner dies dann nach Kriegsausbruch nicht taten, ist wohl nur darauf zurückzuführen, daß sie im Geiste Cattaro schon dem montenegrinischen Königreich einverleibt sahen und diese Perle der Krone nicht selbst zerstören wollten.
Gerne wäre ich noch einige Tage in Cattaro geblieben, wo sich ein bewegtes militärisches Leben abspielte. Aber der Divisionsnachrichten-offizier, Hauptmann Zimmermann, drängte auf meine Abreise. — „Es ist allgemeine Mobilisierung und Sie haben sich beim Marinekommando in Triest zu melden.“ — „Gut, dann warte ich nur den .Baron Gautsch' ab, der in zwei Tagen fällig ist, und fahre mit ihm direkt nach Triest.“ — „Nein“, entschied der Hauptmann. „Morgen früh fährt der Dampfer der Ungara-Kroata. Sie fahren bis nach Fiume und dann in drei Stunden nach Triest. Da gewinnen Sie beinahe 24 Stunden.“ — So schiffte ich mich am nächsten Tag auf die Ungara-Kroata ein und fuhr nach Triest. Hätte ich den Lloyddampfer „Baron Gautsch“ abgewartet, wäre ich jeder Wahrscheinlichkeit nach auch unter den dreieinhalbhundert Opfern dieser Katastrophe gewesen ...