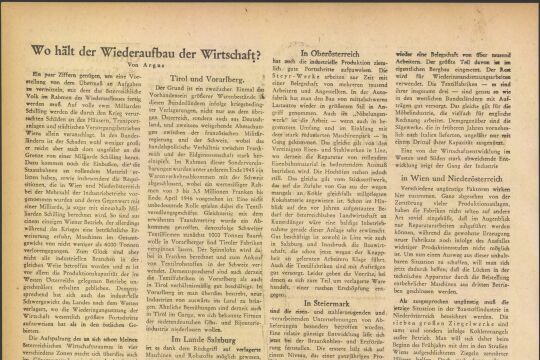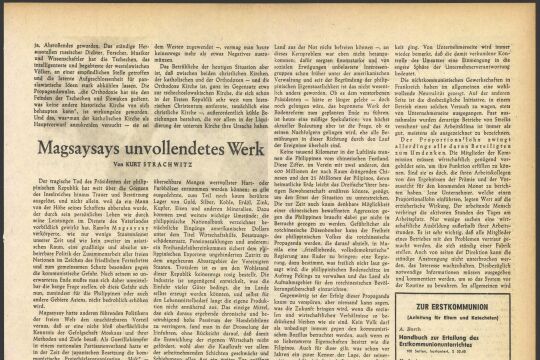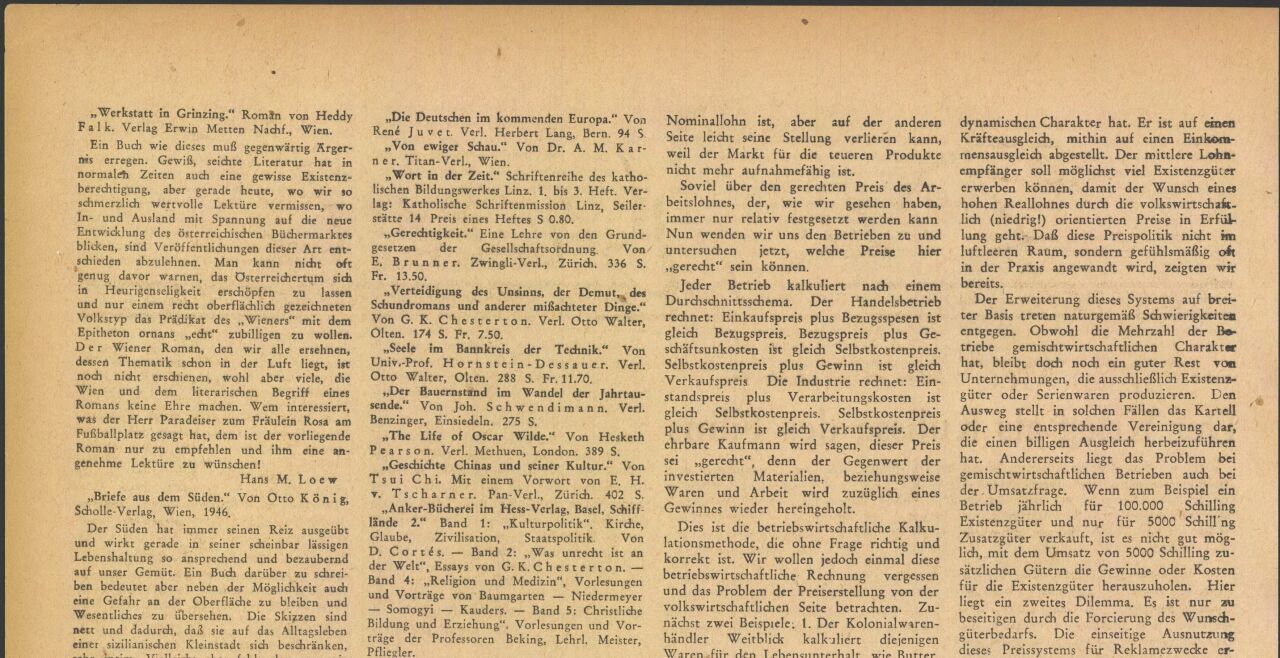
Der „gerechte Preis“ ist nicht erst die Forderung unserer Tage, sondern bewegt das Menschengeschlecht schön jahrhundertelang, ja, man kann sagen, Jahrtausende,. solange wir überhaupt die ersten Zeichen des Wirt-schaftens — mag die Form auch noch so primitiv sein — wahrnehmen können. Bereits im 13. Jahrhundert formulierte der Scholastiker Thomas von Aquino (1225 — 1274) scharf die Forderung des justum pre-tium, des gerechten Preises. Aquinos Ansicht ging von der Lehre des Aristoteles aus, der ähnliche Gedankengänge vertrat. Außerdem war mitbestimmend für seine Auffassung das kanonische Recht, das die Grundsätze des gerechten Preises im Taufchverkehr zur Geltung bringen wollte.
Die einfache Theorie des justum pretium sollte zur Genügsamkeit erziehen. Der Preis sollte Üen Wert des Tauschgutes ausdrücken, niemand sollte dabei übervorteilt werden. „Ein Ding ist um so mehr wert, je mehr es als sich selbst genügend befunden wird.“ Das war die Einstellung des Thomas von Aquino und anderer Kirchenväter, zu denen auch der Bischof Nikolaus von Oresmius zu rechnen wäre.
Es ist hier nicht der Ort, die großen Theorien der Nationalökonomen über die Preisfrage wiederzugeben. Es ist hier auch belanglos, sich über die Theorie des subjektiven und objektiven Preises zu unterhalten, sondern wir wollen den „gerechten Preis“ einmal von einer allgemeinverständlichen und unserer praktischen Vorstellung nicht fremden Betrachtungsweise ansehen.
Beginnen wir zunächst mit dem gerechten Preis für den Arbeitslohn. Dieser wird bekanntlich tariflich oder außertariflich nach Stunden, Tagen, Monaten oder sonstwie verträglich bemessen. Der eine verdient mehr, der andere weniger. Wäre es nicht richtiger, alle Mitmenschen mit ein und demselben Maß zu messen und zum Beispiel zu sagen: Jeder, der seine Arbeitskraft acht Stunden am Tage zur Verfügung stellt, soll x Schilling erhalten. Wohin würde das wohl führen? Zweifellos zu keiner besonderen Kraftanstrengung. Mayer würde sagen: Wenn ich genau so viel wie Müller erhalte, so strenge ich mich auch nur genau so viel wie dieser an, denn es gibt ja doch nicht mehr Entgelt. Schließlich verlöre ich meine Arbeitskraft durch erhöhte Leistung früher als Müller und könnt-e dann meine Familie nicht mehr ernähren.
Der gerechte Preis, des Arbeitslohnes resultiert also durchaus nicht aus der Formel: aufgewandte Arbeitszeit X Stundenpreis. Diese Erkenntnis ist wohl schon Allgemeingut geworden und auch der theoretisch nicht geschulte Arbeiter sieht die Logik dieses Schlusses ein. Anders liegt allerdings das Problem bei der Lösung der Frage nach der absoluten Lohnhöhe. Hier gibt es zunächst den allgemeinen Ausgangspunkt- Der Mindestlohn muß so hoch sein, daß er zur Bedarfsdeckung der notwendigen Existenzgüter ausreicht. Damit ist bereits gesagt, daß es nicht auf den Nominallohn ankommt, sondern ausschließlich auf den Reallohn. Beispiel: Ein Arbeiter im Burgenland erhält 120 Schilling im Monat und ein Arbeiter in Wien ebenfalls 120 Schilling. Da der Arbeiter in Wien zum Teil höhere Kleinhandelspreise und sonstige Kosten (Miete, für Fahrten usw.) aufwenden muß, so erhält der burgenländische Arbeiter trotz des gleichen Betrages höheren Lohn. Mit anderen Worten, der Reallohn (das ist die Möglichkeit, mit demselben Betrage möglichst viel einzukaufen) ist bei dem Bu-gen-länder hoher. Was nützt ein Lohn, der 1500 Schilling monatlich hoch ist, für den man aber tatsächlich nur ein Kilogramm Butter und drei Kilogramm Brot kaufen kann? Den Anschauungsunterricht erhielten wir in der Inflation nach dem ersten Weltkrieg und sehen wir heute bei verschiedenen unserer Nachbarn.
Der „niedrige“ Lohn ist also durchaus nicht immer ein Anzeichen schlechter Entlohnung. Man muß dabei nur die Frage stellen: Was kann sich der Arbeiter für diesen niedrigen Lohn kaufen? Und gerecht ist, um es noch einmal zu sagen, derjenige Lohn, der die Anschaffung aller Existenzmittel ermöglicht. Daran wird sich auch vor allen Dingen der Fabrikant gewöhnen müssen, der nicht allein die Senkung der Löhne im Auge haben darf, sondern, wenn dies schon der Fall sein muß, auch die Senkung nach der Deckungsmöglichkeit des Existenzgüterbedarfs bemessen muß.
In einer Volkswirtschaft, die vollständig unabhängig vom Weltmarkt ist — heute eine Utopie —, kann gewiß der Nominalwert des Lohnes hoch liegen, nicht aber fn einem Staat wie Österreich, der immer einen Teil der erforderlichen Lebensgüter aus dem Ausland beziehen muß, denn dann wird ein ungünstiger Preisauftrieb verursacht. Der Preisauftrieb kann handelspolitisch schädigend wirken, so daß der Arbeiter zwar stolz auf seinen hohen
Nominallohn ist, aber auf der anderen Seite leicht seine Stellung verlieren kann, weil der Markt für die teueren Produkte nicht mehr aufnahmefähig ist.
Soviel über den gerechten Preis des Arbeitslohnes, der, wie wir gesehen haben, immer nur relativ festgesetzt werden kann Nun wenden wir uns den Betrieben zu und untersuchen jetzt, welche Preise hier „gerecht“ sein können.
Jeder Betrieb kalkuliert nach einem Durchschnittsschema. Der Handelsbetrieb rechnet: Einkaufspreis plus Bezugsspesen ist gleich Bezugspreis. Bezugspreis plus Geschäftsunkosten ist gleich Selbstkostenpreis. Selbstkostenpreis plus Gewinn ist gleich Verkaufspreis Die Industrie rechnet: Einstandspreis plus Verarbeitungskosten ist gleich Selbstkostenpreis. Selbstkostenpreis plus Gewinn ist gleich Verkaufspreis. Der ehrbare Kaufmann wird sagen, dieser Preis sei „gerecht“, denn der Gegenwert der investierten Materialien. beziehungsweise Waren und Arbeit wird zuzüglich eines Gewinnes wieder hereingeholt.
Dies ist die betriebswirtschaftliche Kalkulationsmethode, die ohne Frage richtig und korrekt ist. Wir wollen jedoch einmal diese betriebswirtschaftliche Rechnung vergessen und das Problem der Preiserstellung von der volkswirtschaftlichen Seite betrachten. Zunächst zwei Beispiele: 1. Der Kolonialwarenhändler Weitblick kalkuliert diejenigen Waren(für den Lebensunterhalt, wie Butter, Schmalz, Zucker, Salz, Heringe (die gegenwärtige Mangellage und daraus resultierende Rationierung bleibt unberüdisichtigt). zum Selbstkostenpreis, ja, gelegentlich geht er sogar unter diesen. Gewinne zieht er nur aus den Waren, die nicht unbedingt zur Lebenserhaltung dienen und mehr zusätzlichen Bedarf darstellen, wie Sardinen Kaffee, Tee, Süßigkeiten Weine, Bier usw. Manche sagen, er sei ein ' 'uger Geschäftsmann. Er selbst behauptet, aus volkswirtsdiaftlichen Gründen so handeln zu müssen. Er finanziert also die Existenzgüter durch die Zusatz- (Luxus-) Güter. 2. Ein berühmter Chirurg nimmt durchschnittlich für eine Operation 600 Schilling, bei weniger Bemittelten nur 50 Schilling Durch die Mehrpreise, die er der reicheren Schicht abnimmt, finanziert er die Operationen an ärmeren Leuten, denn die 50 Schilling verbraucht er allein für Operationsmaterial und Hilfskräfte.
Wie sind nun diese Preiserstellungen in volkswirtschaftlicher Hinsicht zu beurteilen? Wir behaupten „günstig“, denn es ist richtig, den Mußbedarf möglichst niedrig zu kalkulieren und den Wunschbedarf dafür etwas höher. Die Folge davon ist, daß die Existenzgüter mit Hilfe der Zusatzgüter finanziert werden. Wir können die Bezeichnungen auch anders wählen: Die Mußgüter des täglichen Lebens sollen durch die Wunschgüter verbilligt werden. Der Kaufmann, der gewohnt ist, seine Preise auf Grund der Stückrechnung, das heißt, ohne jede . Rücksicht auf derartige volkswirtschaftliche Gedankengänge, zu ermitteln, wird vorerst wenig erbaut sein von dieser Theorie des „gerechten Preises“. Die Voraussetzung solcher Preise in betrieblicher Hinsicht wäre auch der gemischte Betrieb, das ist ein Betrieb, der nicht nur Existenzgüter, sondern gleichzeitig auch Zusätzgüter herstellt oder mit ihnen handelt. Dabei ist der Begriff „Zusatzgüter“ weitgehend zu fassen. Nicht allein diejenige Fabrik, die neben einfachen Nahrungsmitteln feine Genußmittel (Liköre, Delikatessen usw.) fabriziert, gilt als gemischter Betrieb, sondern auch die Fabrik mit Serienanfertigung und Sonderanfertigung ist dazu zu rechnen. Beispiele: Serienschuhfabrik mit gleichzeitiger Luxusschuhanfertigung; Auto-fabrik mit Serienwagen und Modelltypen.
Hier soll es also immer so sein, daß der Massenbedarf durch den Einzelbedarf des Bessergestellten teilweise mitfinanziert wird. Derjenige, der mit dem Serienschuh zu vierzehn Schilling nicht einverstanden ist, soll für einen besseren Schuh mehr zahlen, und zwar soviel mehr, daß der Serienschuh noch billiger abgegeben werden kann. Derjenige, dem die Schnelligkeit und Bequemlichkeit eines Serienwagens nicht genügt, soll für die bessere Ausrüstung mehr erlegen, als die reinen Mehrkosten betragen würden. Der Sonderwunsch wird bei dieser Preispolitik mit einem Überpreis belegt. Wer das einfache Brot nicht essen will, sondern Pumpernickel verlangt, soll mehr bezahlen, damit der Arme sein Brot noch billiger erhält. Wem der Hering als Nahrungsmittel nicht genügt, soll für seine Sardinen oder feine Fischkonserven mehr bezahlen, damit der Hering noch billiger wird. Wir sehen schon, daß der gerechte Preis dynamischen Charakter hat. Er ist auf einen Kräfteausgleich, mithin auf einen Einkom-mensausgleich abgestellt. Der mittlere Lohnempfänger soll möglichst viel Existenzgüter erwerben können, damit der Wunsch eines hohen Reallohnes durch die volkswirtschafe-lich (niedrig!) orientierten Preise in Erfüllung geht. Daß diese Preispolitik nicht im luftleeren Raum, sondern gefühlsmäßig olt in der Praxis angewandt wird, zeigten wir bereits.
Der Erweiterung dieses Systems auf breiter Basis treten naturgemäß Schwierigkeiten entgegen. Obwohl die Mehrzahl der Betriebe gemischtwirtschaftlichen Charakt hat, bleibt doch noch ein guter Rest von Unternehmungen, die ausschließlich Existena-güter oder Serienwaren produzieren. Den Ausweg stellt in solchen Fällen das Kartell oder eine entsprechende Vereinigung dar, die einen billigen Ausgleich herbeizuführen hat. Andererseits liegt das Problem bei gemischtwirtschaftlichen Betrieben auch bei der Umsatzfrage. Wenn zum Beispiel ein Betrieb jährlich für 100.000 Schilling Existenzgüter und nur für 500C Schill'ng Zusatzgüter verkauft, ist es nicht gut möglich, mit dem Umsatz von 5000 Schilling zusätzlichen Gütern die Gewinne oder Kosten für die Existenzgüter herauszuholen. Hier liegt ein zweites Dilemma. Es ist nur zu beseitigen durch die Forcierung des Wunsch-güterbedarfs. Die einseitige Ausnuming dieses Preissystems für Reklamezwecke erscheint naturgemäß ungerecht. Wenn em Warenhaus die Abteilung Strumpfwaren so billig arbeiten läßt, daß alle anderen Strumpfhändler der Stadt keine Betätigungsmöglichkeit mehr haben, liegt sicherlich eine mißbräuchlidie Anwendung des Systems (nämlich Dumping!) vor.
Wir fassen zusammen: Der volkswirt-schaftlidi gerechte Preis ist der dynamische Preis, der die Finanzierung der Existenzgüter durch die Zusatzgüter ermöglicht. Die einseitige Rechnung, Selbstkostenpreis plus Gewinn ist gleich Verkaufspreis, muß zugunsten der niedrigeren Preisgestaltung der Existenzgüter in ihrer starren'Anwendung eine wesentliche Einschränkung erfahren.