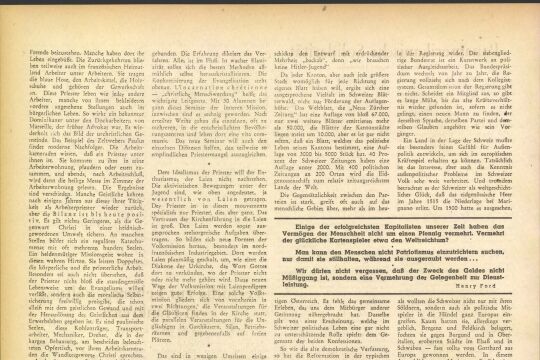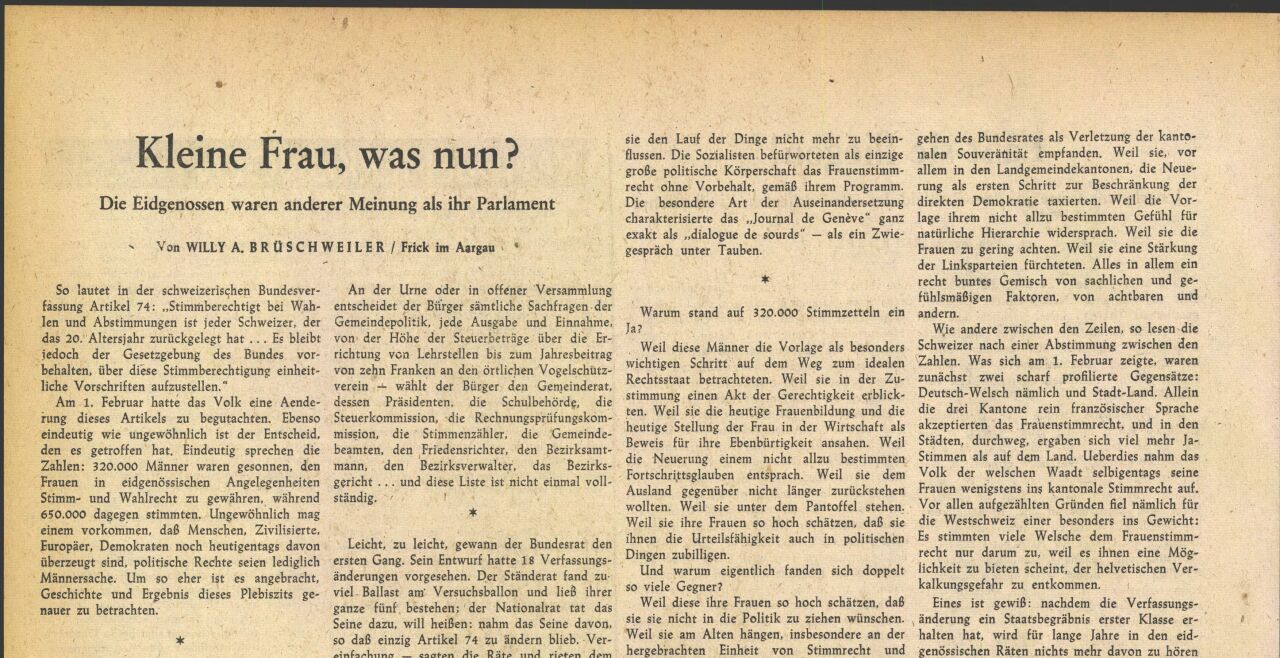
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kleine Frau, was nun ?
So lautet in der schweizerischen Bundesverfassung Artikel 74: „Stimmberechtigt bei Wahlen und Abstimmungen ist jeder Schweizer, der das 20. Altersjahr zurückgelegt hat … Es bleibt jedoch der Gesetzgebung des Bundes Vorbehalten, über diese Stimmberechtigung einheitliche Vorschriften aufzustellen.”
Am 1. Februar hatte das Volk eine Aende- rung dieses Artikels zu begutachten. Ebenso eindeutig wie ungewöhnlich ist der Entscheid, den es getroffen hat. Eindeutig sprechen die Zahlen: 320.000 Männer waren gesonnen, den Frauen in eidgenössischen Angelegenheiten Stimm- und Wahlrecht zu gewähren, während 650.000 dagegen stimmten. Ungewöhnlich mag einem Vorkommen, daß Menschen, Zivilisierte, Europäer, Demokraten noch heutigentags davon überzeugt sind, politische Rechte seien lediglich Männersache. Um so eher ist es angebracht, Geschichte und Ergebnis dieses Plebiszits genauer zu betrachten.
Bei der ersten (und zugleich letzten; Gesamtrevision der Bundesverfassung, im Jahre 1874, befaßten sich die Juristen erstmals mit der Frage, ob die Schweizer Frau politische Rechte erhalten sollte. Damals trieb man in der Eidgenossenschaft noch mehr Ideen- als Sach- Politik, und weil sich ja die Gelegenheit bot, das gesamte politische Leben in neue Bahnen zu leiten, schien ein solches Novum nicht abwegig, kam eigentlich gelegener als heute. Bloß drang der Vorschlag nicht einmal in den ersten Entwurf.
Kurz vor dem ersten Weltkrieg erst, infolge der englischen Suffragettenbewegung, wurde das Frauenstimmrecht in der Schweiz wieder diskutiert; das Züricher Volk legte die Möglichkeit seiner Einführung (nur das, nicht mehr) verfassungsmäßig fest. Seit aber vor vierzig Jahren in Europa die großen Veränderungen eintraten, ist in der Eidgenossenschaft das lebhafte Gespräch nicht’ mehr abgebrochen. Seit 1,92(3 zählt man in zehn Kantonen nitht weniger als 25 Versuche, die Frau in der Politik mitsprechen zu lassen — keiner fand die Gnade der Männer. Im Jahre 1929 erreichte eine Petition an die eidgenössischen Räte, von 170.000 Frauen unterzeichnet, nicht einmal die Volksabstimmung. Nach dem zweiten Weltkrieg vermeinten einige Frauenverbände das Ei des Kolumbus gefunden zu haben, indem sie recht laut die Meinung vertraten, es gerfüge durchaus, Artikel 74 weitherzig auszulegen, die Schweizerinnen unter dem Wort „Schweizer” tacite zu subsummieren und demnach ihrem Begehr auf dem Verordnungswege zu entsprechen. Der Einfall war ebenso kühn wie sophistisch, ver- anlaßte indessen den Bundesrat, „über das für die Einführung des Frauenstimmrechts einzuschlagende Verfahren” Bericht zu erstatten. Er hielt dafür, es entspreche dem Aufbau dės Bundesstaates besser, wenn Stimm- und Wahlrecht den Frauen vorerst in sozialen, später in politischen Belangen der Gemeinden eingeräumt werden, um endlich auf dem Wege über das kantonale auch das eidgenössische Recht zu ändern. Das geschah 1947.
Ebenderselbe Bundesrat gelangte aber schon sechs Jahre später in ebenderselben Sache an die eidgenössischen Räte mit einer Botschaft, die sich sowohl dem Inhalt nach als in der sprachlichen Güte von früheren Gepflogenheiten vorteilhaft abhob. Nach einer gründlichen Darstellung der Frauenstimmrechtsbestrebungen in der Schweiz wurden klar und sachlich das Pro und Kontra abgewogen, zu dem Ende, daß es sich rechtfertige, die Sache auf Bundesebene zur Entscheidung zu bringen, weil sie in den Kantonen nicht vom Fleck komme. Daß „unsere Demokratie auf ihren drei Stufen vom Stimmbürger bedeutend mehr verlangt als irgendein anderer Staat”, wurde zwar betont; wirklich galt es auf der obersten Stufe allein im Jahre 1958 über vier Verfassungsänderungen, einen Staatsvertrag und zwei Initiativbegehren abzustimmen. Auch verschwieg die Botschaft nicht, daß sich ernsthafte Bedenken gegen den Primat des Bundes hegen ließen, doch seien gerade die eidgenössischen Urnengänge eher geeignet, die staatsbürgerliche Schulung der Frau zu fördern - ein plausibles Argument, wenn man bedenkt, wie sehr ein Bürger im Rahmen bloß der Gemeinde beansprucht wird. Das muß man sich im einzelnen verdeutlichen, ufn ein richtiges Bild zu eewinnen.
An der Urne oder in offener Versammlung entscheidet der Burger sämtliche Sachfragen der Gemeindepolitik, jede Ausgabe und Einnahme, von der Höhe der Steuerbeträge über die Errichtung von Lehrstellen bis zum Jahresbeitrag von zehn Franken an den örtlichen Vogelschutzverein -1- wählt der Bürger den Gemeinderat, dessen Präsidenten, die Schulbehörde, die Steuerkommission, die Rechnungsprüfungskommission, die Stimmenzähler, die Gemeindebeamten, den Friedensrichter, den Bezirksamtmann, den Bezirksverwalter, das Bezirksgericht … und diese Liste, ist nicht einmal vollständig. ‘
Leicht, zu leicht, gewann der Bundesrat den ersten Gang. Sein Entwurf hatte 18 Verfassungsänderungen vorgesehen. Der Ständerat fand zuviel Ballast am’ Versuchsballon und ließ ihrer ganze fünf bestehen; der Nationalrat tat das Seine dazu, will heißen: nahm das Seine davon, so daß einzig Artikel 74 zu ändern blieb. Vereinfachung — sagten die Räte und rieten dem Volk zur Annahme. Schlingen — dachten sich ihrer etliche, Schlingen, in die sich das Projekt im Abstimmungskampf verwickeln sollte.
Die schweizerischen Frauenverbände führten ihre Sache gar nicht ungeschickt, vermieden tunlichst jeden Anschein von Ungeduld, von Zudringlichkeit, von streitbarer Frauenrechtlerei; dafür zeigten sie letzten Sommer in Zürich eine gr’oße Ausstellung für Frauenarbeit, wo die Tatsachen für sie sprechen und werben sollten. Arge Schicksalsschläge brachen jedoch über das gutgemeinte Werk herein.
Daß in Zürich die öffentlichen Lokale wieder allesamt spießbürgerlich um Mitternacht schließen müssen, schob man den Frauenvereinen in die Pantoffeln. Weitherum hörte man (und vermerkte es übel), die Art der besagten Ausstellung und einiges Drum und Dran entsprächen nicht eben der guten Absicht. Und ein Dolchstoß in den Rücken fehlte nicht: es bildeten sich Frauenkomitees gegen das Frauenstimmrecht. Endlich erschien ganz zur Unzeit ein. Buch mit dem Titel „Frauen im Laufgitter”, dessen Verfasserin in außerordentlich aggressivem Ton dartat, weicherweise die Schweizer Männer ihren Frauen ein abscheulich-unwürdiges Sklavendasein aufzwängen. Mit den Aussagen bafaßte sich die öffentliche Meinung wenig, wohl aber mit dem Tonfall. Das Werk wurde viel gelesen, meist verurteilt, überall besprochen: zu behaupten, diese Publikation allein habe dem Frauenstimmrecht Zehntausende von Stimmen gekostet, ist keineswegs übertrieben.
Zwei Monate vor dem Stichtag konnte man die Angelegenheit als erledigt ansehen; es blieb nur noch zu beachten, wie stark und unter welchen besonderen Aspekten die Vorlage abgelehnt würde. Selbstverständlich bezogen die schweizerischen und kantonalen Partei- und Verbandstage Stellung. Tatsächlich vermochten sie den Lauf der Dinge nicht mehr zu beeinflussen. Die Sozialisten befürworteten als einzige große politische Körperschaft das Frauenstimmrecht ohne Vorbehalt, gemäß ihrem Programm. Die besondere Art der Auseinandersetzung charakterisierte das „Journal de Genėve” ganz exakt als „dialogue de sourds” — als ein Zwiegespräch unter Tauben.
Warum stand auf 320.000 Stimmzetteln ein Ja?
Weil diese Männer die Vorlage als besonders wichtigen Schritt auf dem Weg zum idealen Rechtsstaat betrachteten. Weil sie in der Zustimmung einen Akt der Gerechtigkeit erblickten. Weil sie die heutige Frauenbildung und die heutige Stellung der Frau in der Wirtschaft als Beweis für ihre Ebenbürtigkeit ansahen. Weil die Neuerung einem nicht allzu bestimmten Fortschrittsglauben entsprach. Weil sie dem Ausland gegenüber nicht länger zurückstehen wollten. Weil sie unter dem Pantoffel stehen. Weil sie ihre Frauen so hoch schätzen, daß sie ihnen die Urteilsfähigkeit auch in politischen Dingen zubilligen.
Und warum eigentlich fanden sich doppelt so viele Gegner?
Weil diese ihre Frauen so hoch schätzen, daß sie sie nicht in die Politik zu ziehen wünschen. Weil sie am Alten hängen, insbesondere an der hergebrachten Einheit von Stimmrecht und Waffendienst. Weil sie nicht glaubten, daß die Neuerung dem Lande zum Guten oder zum Bessern ausschlagen könne. Weil sie das Vorgehen des Bundesrates als Verletzung der kantonalen Souveränität empfanden. Weil sie, vor allem in den Landgemeindekantonen, die Neuerung als ersten Schritt zur Beschränkung der direkten Demokratie taxierten. Weil die Vorlage ihrem nicht allzu bestimmten Gefühl für natürliche Hierarchie widersprach. Weil sie die Frauen zu gering achten. Weil sie eine Stärkung der Linksparteien fürchteten. Alles in allem ein recht buntes Gemisch von sachlichen und gefühlsmäßigen Faktoren, von achtbaren und andern.
Wie andere zwischen den Zeilen, so lesen die Schweizer nach einer Abstimmung zwischen den Zahlen. Was sich am 1. Februar zeigte, waren zunächst zwei scharf profilierte Gegensätze: Deutsch-Welsch nämlich und Stadt-Land. Allein die drei Kantone rein französischer Sprache akzeptierten das Frauenstimmrecht, und in den Städten, durchweg, ergaben sich viel mehr Ja- Stimmen als auf dem Land. Ueberdies nahm das Volk der welschen Waadt selbigentags seine Frauen wenigstens ins kantonale Stimmrecht auf. Vor allen auf gezählten Gründen fiel nämlich für die Westschweiz einer besonders ins Gewicht: Es stimmten viele Welsche dem Frauenstimmrecht nur darum zu, weil es ihnen eine Möglichkeit zu bieten scheint, der helvetischen Verkalkungsgefahr zu entkommen.
Eines ist gewiß: nachdem die Verfassungsänderung ein Staatsbegräbnis erster Klasse erhalten hat, wird für lange Jahre in den eidgenössischen Räten nichts mehr davon zu hören sein. Die politische Gleichstellung der Frau wird sich in hergebrachter Art von unten nach oben aufbauen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!