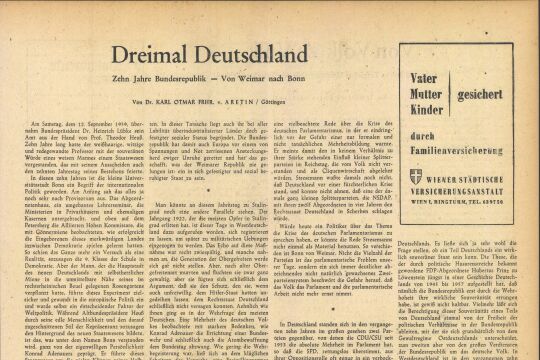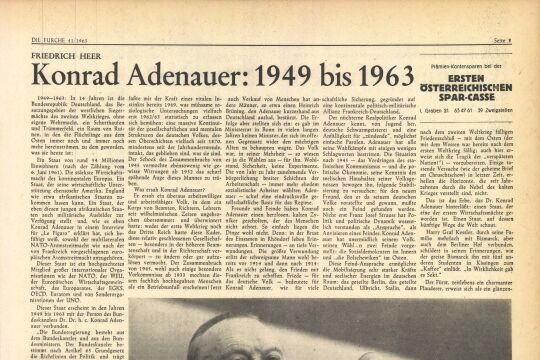Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Krise der „Staatspartei“
Auf ihrem letzten Bundesparteitag in Kiel erklärte sich die CDU, auf die 52 Prozent der Wählerstimmen der Bundestagswahl Vbn 1957 gestützt, selbst zur Staatspartei. Diese Behauptung hat im vergangenen halben Jahr eine beklemmende Bestätigung erfahren: Die überraschungsreiche Suche dieser Partei nach einem geeigneten Präsidentschaftskandidaten hat zu einer der ernstesten Staatskrisen in der deutschen Bundesrepublik geführt. Ein Machtkampf innerhalb der CDU hat die höchsten Staatsämter in ein zweifelhaftes 'Licht gerückt in einer Weise, wie man es bislang in einer Demokratie flicht für möglich gehalten hat.
Es ging hierbei um die Nachfolge des Bundespräsidenten Prof. Heuß. In einer seiner Ueberraschungsaktionen war es Adenauer gelungen, seinen Vizekanzler und wahrscheinlichsten Kandidaten auf seine Nachfolge, Bundeswirtschaftsminister Professor Erhard, als Kandidaten der CDU für das Bundespräsidentenamt aufzustellen. Nicht daß Adenauer den Wirtschaftsexperten Erhard als geeignetsten Nachfolger des weisen und überlegenen Professor Heuß gehalten hätte. Diese Frage stand offenbar gar nicht zur Diskussion. Es war ein offenkundiger Versuch, Erhard von der Nachfolge im Bundeskanzleramt auszuschließen. Erhard wäre besonders einer Gruppe mit autoritären Staatsvorstellungen um Innenminister Schröder als Bundeskanzler unangenehm gewesen.
Diese Aktion führte zur ersten sensationellen Niederlage Adenauers. Die Fraktion widersetzte sich und bestimmte Erhard, die Kandidatur nicht anzunehmen. Schon damals registrierten besorgte Stimmen, in welch schiefes Licht das höchste Amt im Staate durch solche Manipulationen geraten könne. Am 7. April jedoch schienen diese Sorgen durch den zweiten Blitzbeschluß Adenauers beseitigt, als er der erstaunten Welt seinen Entschluß kundtat, selbst für das höchste Amt im Staate kandidieren zu wollen. Die Fraktion — in unverhohlener Freude, den .Alten“ auf solch anständige Weise loszuwerden — applaudierte frenetisch und für den machtgewohnten alten Herrn etwas zu laut. Die Frage, ob dieser ausgesprochene Machtpolitiker für das entsagungsreiche Amt eines Bundespräsidenten auch geeignet sei, wurde wieder nicht gestellt. Diesmal war es die Fraktion, die jemanden loswerden wollte und dafür ziemlich unbekümmert das höchste Amt im Staate für geeignet hielt. Adenauers beziehungsreiche Hinweise, Bundespräsident Heuß hätte die im Grundgesetz vorhandenen Möglichkeiten nicht völlig ausgeschöpft, ließen bereits aufhorchen. Aber damit nicht genug: Man fand auch nichts dabei, den im Juli zu wählenden Bundespräsidenten Adenauer bis September als Bundeskanzler im Amt zu lassen, obwohl dies zumindest dem Geist des Grundgesetzes widersprach. Wieder war es auffallenderweise Innenminister Schröder, dessen Aufgabe der Schutz der Verfassung vor allzu freier Auslegung gewesen wäre, der sowohl Adenauers Kandidatur als auch dessen eigentümliche Interpretation des Grundgesetzes verteidigte.
In den folgenden Wochen — zur selben Zeit rangen in Genf die Außenminister der vier Großmächte um die Lösung des Deutschlandproblem?, wobei die westlichen für die Bundesrepublik sozusagen die Kastanien aus dem Feuer zu holen hatten — entwickelte sich in Bonn ein Kampf um die Nachfolge Adenauers, bei dem jedes Mittel erlaubt schien. Während Adenauer Finanzminister Etzel als künftigen Kanzler durchsetzen wollte, versteifte sich die Mehrheit der CDU/CSU-Fraktion auf Erhard als künftigen Kanzler. Ende Mai schien sich die zweite Niederlage Adenauers abzuzeichnen. Die CDU/CSU ging bereits an dia Nominierung neuer Minister, wobei Männer, die nur unter dem automatischen Regime Adenauers als Minister möglich waren, ersetzt werden sollten. Erhard war so siegesgewiß, nach Amerika zu reisen und sich dem amerikanischen Fernsehen als künftiger Bundeskanzler zu stellen. Die Abwesenheit seines stärksten Antipoden benützte Adenauer, von seiner Kandidatur auf das Bundespräsidentenamt zurückzutreten und seinen Willen kundzutun, weiter Bundeskanzler bleiben zu wollen. Die angegebenen Gründe, Präsident Eisenhower habe sein weiteres Verbleiben als Bundeskanzler gewünscht, die außenpolitische Lage hätte sich verschärft usw., erwiesen sich als falsch und mußten, wie die Behauptung über Eisenhower, nach kurzer Zeit zurückgenommen werden. Der zurückkehrende Erhard erzwang die öffentliche Zurücknahme aller Behauptungen Adenauers, durch die dieser die Fähigkeiten Erhards in Zweifel gestellt hatte. Alle Erklärungen Adenauers bis zu seiner Behauptung vor dem Bundestag am vergangenen Freitag, er habe bereits am 14. Mai das Kabinett von seiner Absicht, von der Bundespräsidentenkandidatur zurückzutreten, in Kenntnis gesetzt, erwiesen sich als unglaubwürdig. Die Fraktion, vor vollendete Tatsachen gestellt, beeilte sich mit peinlichem Eifer, sich der neuen Lage anzupassen. Innenminister Schröder pries genau das Gegenteil dessen als politische Weisheit, was er am 7. April für solche ausgegeben hatte. Allein Erhard zeigte ruhige Ueberlegenheit. Trotz der Brüskierung durch Adenauer hielt er, solange er im Ausland weilte, mit seinen Erklärungen zurück, verlangte jedoch nach seiner Rückkehr Klarstellung und Zurücknahme aller Verdächtigungen und Angriffe. In der heißen Bundestagsdebatte vom 12. Juni war er der einzige, der rückhaltlos die Schwere der Krise eingestand, aber auch seiner Ueberzeugung Ausdruck verlieh, daß sich ein Ausweg finden lasse.
Denn sicherlich gibt es einen Weg, aber nur den einer ehrlichen Auseinandersetzung, und nicht den unzähliger Erklärungen, von denen eine so unglaubwürdig ist wie die andere. Schon jetzt steht Erhard allein auf einsamer Höhe, allein deshalb, weil er die eigentümliche und seltene Eigenschaft besitzt, die Wahrheit zu sagen. Sollte dies der dritte Sieg Erhards über Adenauer sein? Dann hätte er ein schweres Erbe anzutreten. Das Ansehen der jungen deutschen Demokratie ist auch im Ausland stark angeschlagen. Es bleibt abzuwarten, wie der Kanzler mit dieser Stimmung fertig wird, der bisher innenpolitische Probleme durch Hinweise auf die schwierige außenpolitische Lage zu umgehen pflegte. . ,
Diese Bilanz deutscher Innenpolitik ist düster genug. Es haben sich aber in den 58 Tagen der Präsidentschaftskandidatur Adenauers auch Ansätze einer echten demokratischen Entwicklung gezeigt. In der CDU, von deren Politikern zweiter Garnitur man kaum etwas wußte, zeigten sich verantwortungsbewußte und verantwortungsvolle Persönlichkeiten, wie die Fraktionsvorsitzenden der CDU Krone und der CSU H ö c h e r 1, wie Bundestagspräsident Gerstenmaier, um nur einige Namen zu nennen, die bewiesen, daß auch in dieser Partei ein starkes demokratisches Element vorhanden ist. Diese erfreuliche Auflockerung griff auch auf die Oppositionspartei über, wobei der Exponent dieser Entwicklung der temperamentvolle SPD-Abgeordnete Mom-
m e r wurde. In der SPD ist ja in Anlehnung an den Adenauer-Kult der CDU ein Heroenkult um den dazu gänzlich ungeeigneten Parteiführer Ollenhauer entwickelt worden, der im Grunde nichts anderes ist, als eine getarnte Diktatur zwar verdienter, aber ganz offenkundig völlig unfähiger Funktionäre. Diese hielten strikte an der klassenkämpferischen Phraseologie fest, die im Mai neun sozialdemokratische Journalisten bei einem Besuch in Moskau Chruschtschow gegenüber die Anrede Genosse gebrauchen ließ. Verständnisinnig verbrüderten sich die Genossen auch in der Behauptung, Adenauer wolle keine Wiedervereinigung. Dieser Skandal wurde von Mommer in aller Schärfe angeprangert, und nun schien die längst überfällige Diskussion innerhalb der SPD in Gang zu kommen, ob die Partei in Zukunft von Politikern oder von Funktionären geleitet werden solle. Aber diese Diskussion erstarb, als das Gerücht einer weiteren Amtsführung Adenauers unversehens Gestalt annahm. Man einigte sich hinter verschlossenen Türen, nachdem man die Welt damit beruhigt hätte, daß Ollenhauer Chruschtschow nicht auch mit Genosse angeredet habe. So ist die deutsche Innenpolitik wieder in die Sterilität eines Streites um Adenauer zurückgekehrt, wie es zu Anfang dieses Jahres war. Dieser Streit nimmt beiden großen deutschen Parteien offen bar die Möglichkeit, politische Entscheidungen zu treffen.
Würden diese Ansätze demokratischer Politik, wie sie sich zwischen dem 7. April und dem 4. Juni- zeigten, bis zum Ausscheiden Adenauers aus dem Amt zurückgedrängt werden, so wäre der 4. Juni 1959 ein schicksalhaftes Datum deutscher Geschichte. Es könnte dann leicht der Beginn einer Entwicklung sein, in der ein zweiter Versuch deutscher Demokratie zugrunde ging. Die CDU, wenn sie den Begriff der Staatspartei nicht nur im negativen Sinn angewendet haben will, daß nämlich ihre Krisen gleich Staatskrisen sind, ist dem deutschen Volk heute nicht Erklärungen einer unverbrüchlichen Einheit schuldig. Es geht heute um den Nachweis, ob es nach Adenauer in Deutschland noch eine Demokratie geben kann oder ob dann alle demokratischen Einrichtungen, sei es durch interne Parteikämpfe oder diktatorische Entschließungen des Vorsitzenden, derart verschlissen sein werden, daß nur noch ein Diktator in Deutschland zu regieren- vermag. Sie muß, und das gilt in beschränktem Maß auch von der SPD, heute beweisen, daß in ihr die demokratischen Kräfte stärker sind als die diktatorischen. Denn von ihrer Haltung hängt das Schicksal der deutschen Demokratie ab.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!