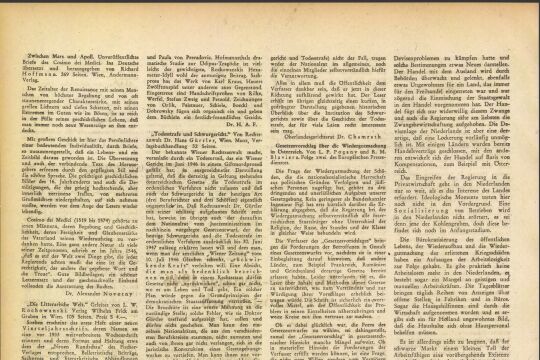Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nach Marcinelle...
Die Bergwerkskatastrophe von Marcinelle bei Charleroi bedeutet für Belgien ein nationales Unglück. Nur selten ist man in diesem Lande einer gleichen Solidarität begegnet. Am nationalen Trauertag, dem Begräbnistag der ersten Opfer, befand ich mich an der Küste. Die Sommersaison lag gänzlich lahm; sogar dort war halbmast geflaggt und jegliches Festprogramm aufgegeben.
Die im Lande herrschende Atmosphäre erinnert stark an einen ebenso tragischen Augustmonat, den wir Belgier' nicht so bald vergessen werden: 1935, als Königin Astrid starb. Auch damals fing eine Trauerzeit an, woran alle Provinzen des Landes und alle Bevölkerungsschichten Anteil hatten.
Heute sind nicht nur beträchtliche Geldsummen in den Kirchen aller Bistümer, bei den Angestellten vieler Betriebe, in den meisten Gemeinden eingesammelt, sondern jeder einzelne wird sich nun auch bewußt, daß nach dieser materiellen Hilfe an Witwen und Waisen noch viel zu tun übrigbleibt, um den Bergleuten bessere Arbeitsbedingungen zu gewähren.
Wenn wir, im Zusammenhang hiermit, ausländische Zeitungen zur Hand nehmen, müssen wir manches Mal staunen über die gegensätzlichen Aussagen, noch mehr aber über den Mangel an richtiger Kenntnis der Umstände dieser Katastrophe und unserer Bergindustrie im allgemeinen.
Das übrigens gut angeschriebene Pariser Tagblatt „Combat“ hat seinen Lesern anläßlich der Grubenkatastrophe von Marcinelle kaltblütig eine ganze Geschichte eines gleichartigen Bergbrandes vorgehalten, der 1920 in Anderlues ausgebrochen sei, 306 Opfer gefordert und deren Ueberreste endgültig im Schacht hinterlassen habe. Tatsächlich aber fand die Katastrophe von Anderlues 1905 statt und kostete 16 Bergleuten das Leben.
In anderen ausländischen Zeitungen wieder waren Anspielungen auf die Unzufriedenheit belgischer Arbeitergewerkschaften über die Arbeitsbedingungen in den belgischen Bergwerken zu lesen. Wenn man allerdings weiß, daß die Sicherheitszustände in den Bergwerken gerade auf einer engen Zusammenarbeit mit den Arbeitergewerkschaften beruhen und daß außerdem die Versuche der Regierung, die ältesten Schächte zu schließen, durch eben diese Syndikate vereitelt wurden, so bekommt man ein anderes Bild von der tatsächlichen Lage.
Ueber den Tod zweier sehr junger Arbeiter wurde ebenfalls ungenau berichtet. Die zwei Jungen, beide Schüler einer technischen Bergwerksschule, hatten an diesem verhängnisvollen Morgen ihren eigenen Vater in die Tiefen des Schachtes begleitet, um das Leben im Bergwerk aus der Nähe kennenzulernen.
Die wallonische Bergwerksgegend, eines der ältesten Industriegebiete Europas, besitzt eine soziale Tradition, die durch die Umstände der Katastrophe aufs tiefste erschüttert ist. Man braucht die Verhältnisse nicht schlimmer darzustellen als sie sind: es gibt auch so Grund genug zu Verbesserungen. Es ist schon so, daß das Arbeitsrisiko in der Gegend der Bergwerksindustrie prozentmäßig am höchsten ist; nicht aber sind die belgischen Bergwerke die gefährlichsten Europas. Nach einer Statistik des Arbeitsbüros in Genf sieht die Verteilung der Anzahl tödlicher Bergwerksunfälle in den wichtigsten Bergwerksgegenden, berechnet auf 1000 Arbeiter jährlich, folgendermaßen aus: USA (1950 bis 1954) 2,54
Kanada (1950 bis 1954) 1,80
Westdeutschland (1950 bis 1954) 1,45 Belgien (1951 bis 1955) 1,17
Italien (1950 bis 1953) 1,09
Saarland (1950 bis 195 3) 1,02
Frankreich (1950 bis 1954) 0,92 Großbritannien (1950 bis 1954) 0,71 Holland (1950 bis 1953) 0,53
Die Niederlande und England, deren Bergwerke wenig Berggas enthalten, stehen in dieser Umfallstatistik begreiflicherweise am Ende. Belgien liegt etwa in der Mitte, gleich hinter Italien.
Wohl ist es so, daß die Bergwerksgegend Südbelgiens (wo sich Marcinelle befindet), deren Betrieb bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht und dessen technische Mittel 1820 und 1825 zu den modernsten der ganzen Welt zählten, heute nicht mehr an der Spitze moderner Gerätschaft steht. Anderseits aber verfügt das Kohlenbecken Nordbelgiens über eine viel modernere Ausrüstung und leichter zu bearbeitende Stollen. Auch dieser Unterschied läßt sich in Ziffern ausdrücken. Das Verhältnis tödlicher Unfälle auf 10.000 Bergleute ergibt folgendes Bild:
1953: Charleroi (Südbelgien) 19,20
Kempen (Nordbelgien) 7,11 1954: Charleroi (Südbelgien) 15,50
Kempen (Nordbelgien) 9,86 1955: Charleroi (Südbelgien) 11,40
Kempen (Nordbelgien) 7,18 Dies alles soll nicht ausschließen, daß von den verantwortlichen Stellen ernsthaft geprüft werden muß, was auf diesem Gebiet noch zu geschehen hat.
In Belgien liegt der Grubenbesitz ausschließlich in der Hand des Privatbesitzes. Die Ausbeutung vieler Bergwerke im Süden des Landes bedeutet seit Jahren eines der schwersten Probleme in Belgiens ökonomischem Dasein: eine Frage, die nicht nur die Arbeitssicherheit, sondern ebenso die Ertragsfähigkeit unmittelbar betrifft. Keine der verantwortlichen Instanzen hat jemals den Mut aufgebracht, drastische Maßnahmen zu treffen: weder die Regierungen, die durch Flickmittel zahlloser Interventionen und indirekter Geldzuschüsse künstlich den Kohlenpreis herunterdrückten, noch die Parteien, die niemals ihr Nationalisierungsprogramm oder eine Strukturreform durchführten, noch die Arbeitergewerkschaften, die (ich, aus Furcht vor einem ökonomischen Rückschlag auf einen Teil der Wirtschaft, größeren Sanierungen widersetzten, noch auch die Banken, die das in den Bergwerksunternehmungen ruhende Kapital nicht preisgeben wollten. Diese jahrelange Flucht vor politischer und ökonomischer Verantwortlichkeit kommt durch die entsetzliche Katastrophe von Marcinelle mit einem Schlag voll ans Licht.
Heute endlich ist diese Frage bis ins Gewissen jedes einzelnen Bürgers durchgedrungen, und „Flickmittel“ genügen nicht mehr.
Man sollte wissen, daß in den meisten unserer Gruben die Produktionsposten nur zur Hälfte durch den Verkaufspreis der Steinkohlen gedeckt werden. Die sogenannten „Randgruben“ werden künstlich durch öffentliche Hilfeleistung am Leben erhalten. Die Unternehmung, in der die Katastrophe stattfand und deren Ausrüstung unzulänglich zu sein scheint, gehört nicht einmal zu diesen „Randgruben“. Diese Tatsache gibt wohl Anlaß zum Nachdenken über die Modernisierung eigentlicher „Randgruben“!
Natürlich ist es möglich, daß durch eine der drei Untersuchungen — die gerichtliche, die administrative und die technische — einem Beamten, der durch ein falsches Manöver Brand verursacht haben soll, die Schuld der Katastrophe angelastet wird; die öffentliche Meinung würde sich trotzdem nicht mit einer solchen „Schlußfolgerung“ abfinden. Das Publikum begreift nur allzu deutlich, daß wir im Zeitalter des Radars und der Television, der angewandten Electronic und der Automation leben. Es wird daher wohl kaum begreifen, daß ein einziger schlecht verstandener oder schlecht gegebener Befehl genügen kann, um im Luftköcher zugleich die Oelleitung, die Preßluftröhren und die Starkstromkabel durchzuschneiden. Die Verantwortlichkeit liegt dann in diesem Fall weniger bei demjenigen, der sich einer veralteten Ausrüstung bedienen muß, als vielmehr bei dem, der diese Ausrüstung nicht erneuern ließ.
Und so gelangt man wieder in den Kreislauf unzulänglicher Rentabilität und ökonomisch ungesunder Betriebsführung.
Seit dem Gesetz des Jahres 1927 sind auch Berufsvertreter der Grubenarbeiter selbst unmittelbar mit der Aufsicht über die Anwendung der Grubenpolizei beauftragt. Außer dieser offiziellen Inspektion wurden durch ein weiteres Gesetz vom September 1947 in allen Unternehmungen unter der Leitung eines Ingenieurs und unter Mitwirkung des Personals Dienststellen für Gesundheit und Sicherheit errichtet, vielfach auf paritätischer Grundlage. Was nützt jedoch diese soziale Kontrolle, wenn der Betrieb selbst durch einen Mangel an nötigen Kapitalanlagen lebensunfähig ist?
Um sich Rechenschaft davon zu geben, wie viele Instanzen sich heutzutage verantwortlich fühlen, würde es genügen, noch einmal die Berichte der Parlamentssitzung zu lesen, unter anderem den Bericht vom 14. Februar 1956. Dort hört man so manche Interpellationen von Arbeitervertretern, die gegen das Sanierungsprogramm des Wirtschaftsministers opponierten. Dieses Programm enthielt die allmähliche Schließung der „Randgruben“, wovon die Regierung eine Rationalisierung erhoffte, die Gegner aber Arbeitslosigkeit befürchteten. Auch hat man noch nicht vergessen, daß seinerzeit gegen das Schließen von Bergwerken gestreikt wurde.
Regierung und Parlament werden nun beide endlich ihre Ohnmacht überwinden müssen. Vorläufig kann noch nicht übersehen werden, wie die Lösung ausfallen wird. Laut offiziellen Berichten wartet die Regierung auf die Ergebnisse der Untersuchungen und das Parlament auf die Beratungen der Fachkommissionen. Eine Beschlußfassung wird nicht einfach sein. Unter den beiden Regierungsparteien ist die Sozialistische Partei für die Nationalisierung, die Liberale dagegen. Aber auch die Christliche Volkspartei, die zusammen mit einer Art kommunistischer Partei die Opposition darstellt, ist in einen demokratischen und einen konservativen Flügel zerrissen ...
Häufig hört man auch die Meinung, daß die Nationalisierung durchaus kein Zaubermittel sei. Die eigentliche Schwäche unserer Kohlenindustrie liegt nicht in ihrem Privatcharakter, sondern vielmehr in der Aufteilung des Kapitals in zahllose kleine Unternehmungen, das heißt in der Inkohärenz unserer Geldzuschußpolitik, wie sich vor kurzem noch ein fortschrittliches christliches Wochenblatt ausdrückte. Wir aber fügen die Frage hinzu, ob nicht gerade zwischen dem Privatcharakter dieser Industrie und ihrer Aufteilung ein Zusammenhang besteht.'
Die Diskussion wird schließlich kompliziert durch den Gegensatz zwischen den flämischen Gruppen, die lange schon bessere Kapitalanlagen und eine Betriebsreform in einigen verwahrlosten Bergwerken Nordbelgiens beanspruchen, und den wallonischen Gruppen, die sich dem widersetzen, um die Interessen des südbelgischen Kohlenbeckens und der wallonischen Regionalindustrie zu schützen.
Sei dem wie immer: Vor den Gräbern von Marcinelle müßten alle finanziellen, privaten und ideologischen Interessen in den Hintergrund treten. Jeder einzelne fühlt nur allzu deutlich, daß es hierbei um eine Humanitätsund Sittlichkeitsfrage geht. Realitätssinn und praktische Veranlagung, die in diesem Lande stets bedeutend waren, müßten auch Jetzt dem gesunden Menschenverstand den Sieg lassen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!