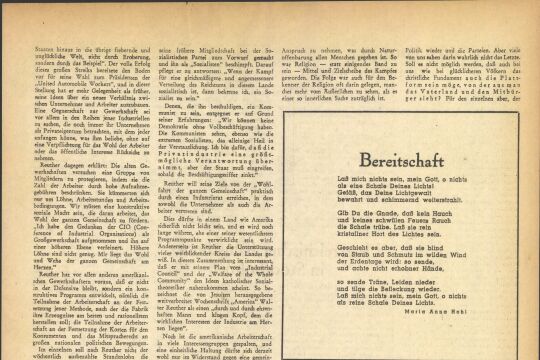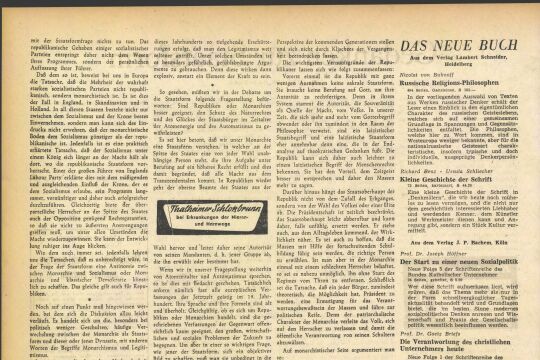Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nachwort zu einer Rede
Die Veranstaltung, mit der von der österreichischen Volkspartei das Gedenken an den 12. November 1918 und den Dreißigjahrbestand der Republik begangen wurde, reicht über die Bedeutung einer Gedenkfeier, die nach der gebührlichen Wiedergabe der gehaltenen Reden schweigend den Redaktionsarchiven einverleibt werden kann, weit hinaus. Es spricht eine starke Symbolik aus der Teilnahme des Bundespräsidenten an der Staatsfeier der Volkspartei. Die oberste Würde unseres Landes trägt ein alter Sozialist, der in harten Jahren an dem Bau dieses Staates mitgeplant und mitgeschaffen hat, der oft aber auch in den heißen Gefechten der Parteien ganz vorne gestanden ist, nie ein bequemer Gegner, doch ein zuverlässiger Partner, wenn er Bundesgenosse war. Sein jetziges Amt verpflichtet ihn für das ganze Volk und zu einer Stellung über den Parteien. Dennoch ist es ein Ereignis, daß Dr. Karl Renner bei einer Feier gesprochen hat, die nicht die seiner Partei war. In unserem öffentlichen Leben sehen so viele, in einseitige Parteidogmatik verkettet, am Wesentlichen vorbei, daß ein Wort über die Parteizäune hinüber, auch wenn es vom Bundespräsidenten gesprochen wird, ein gewisses Wagnis darstellt, schon gar, wenn es die Anerkennung des angesprochenen Teiles findet. Niemand ist darin erfahrener als einer, der wie Dr. Renner es in seiner eigenen Partei nicht immer leicht gehabt hat, vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil er in Wort und Schrift in historischen Situationen um die Synthese bemüht war. Dieser Synthese galt es wiederum, wenn der Bundespräsident sagte: „Wir, unsere politischen Parteien voran, haben aus 1918 gelernt: die parteimäßige Sondervertretung in allen Ehren, aber sie muß Bedacht nehmen auf das entscheidende Gesamtinteresse des Gemeinwesens und muß dem Staat geben, wessen der Staat bedarf.” Diese Erinnerung tut not und so auch die andere in dieser Rede, die Erinnerung an das, was das alte Donaureich war, welche Enttäuschungen dessen Zerstörung gebracht hat und „daß nach 1918 nichts an Stelle der Großmacht zurückblieb als die Ohnmacht der Kleinen und daß sie zwei Jahrzehnte später wechselweise der Überrennung durch die großen Nachbarn anheimfielen und heute noch in qualvoller Ungewißheit auf das Endergebnis dieser Umwälzung und das Ende ihrer Leiden harren”.
Ist das nur eine Totenklage eines in vielen Kämpfen und Erfahrungen zu schmerzlichen Erkenntnissen gereiften Mannes oder nicht vielmehr der Vorhalt, daß mit der Auflösung des Völkerstaates an der Donau zwar Kostbares verloren wurde, aber eine unsterbliche Wahrheit aus dem furchbaren Erlebnis der Kleinvölker des Donaubeckens hervorleuchtet: es werde auch in Zukunft im mitteleuropäischen Raum nicht Friede und Wohlfahrt zu Hause sein, wenn der Grundgedanke des Hauses, das hier zerstört ward, die Zusammenordnung in gegenseitiger Ergänzung um der Freiheit und der Lebensrechte jedes einzelnen willen, nicht in einer neuen zeitgemäßen Form Erfüllung finden wird. Nicht als ob dies von Terminen abhinge, vielmehr ist von einem unauslöschlichen Lebensgesetz die Rede, das, auf Generationen hinaus gesehen, wieder wirksam werden muß, wenn die Freiheit dieser Völker und ihre abendländische Kultur gerettet werden soll.
Solche in die Zukunft forschende Geschichtsbetrachtung ist tief eingewurzelt dem wahren österreichischen Wesen, und es ist eine allzuoft vergessene Wahrheit, daß allen Verneinungen zum Trotz in dem politischen Denken des Österreichers das Drängen nach einer konstruktiv staatlichen Gestaltung inmitten der großen modernen Parteien immer wieder lebendig geworden ist. Das geschah ebenso in dem Brünner Programm der Sozialdemokratischen Partei des alten Österreich, das inmitten der wilden Stürme der Nach-Badeni- Zeit vor einem halben Jahrhundert das Verlangen nach einem „demokratischen Nationalitätenbundesstaat” wie eine Fahne hißte, einem Staatswesen, „in dem national abgegrenzte Selbstverwaltungskörper gebildet werden sollten”, bestimmt, dem Sprachenstreit ein Ende zu machen und die Hausgemeinschaft der Donauvölker fester zu untermauern. Und derselbe Gedanke klang sechs Jahre später aus dem Eggenburger Programm der Ohristlichsozialen der Lueger-Zeit, die in einem solchen Neubau der Verfassung die Geborgenheit des Staatsganzen und aller seiner Teile sahen. Daß es trotz dieser inneren Nähe der staatspolitischen Zielsetzungen nicht gelang, die beiden Parteien in eine gemeinsame Frontstellung für den bedrohten Bestand der Völkergemeinschaft zu bringen, bildet einen Teil des Verhängnisses, das den Staat und seine Glieder, uns alle erreicht hat.
Wäre es jetzt nicht an der Zeit, aus den Lehren, die uns eine unerbittliche Geschichte gegeben, zu lernen, daß wir das Gemeinsame mit Bedacht zu pflegen haben? Nicht umsonst hat der Bundespräsident an seinen Hinweis auf den Vorrang des Gesamtinteresses des Gemeinwesens jene dankenswerten Sätze geknüpft, die den unersetzbaren Werten, welche die Vergangenheit umschloß, gerecht wurden. Unser politisches Leben wird an Rückhalt und Kraft gewinnen, wenn wir aus der politischen Dialektik die leichtfertige Ungerechtigkeit gegen das eigene Land verbannen, das eben ohne seine Geschichte nicht nur in seinen Mängeln, sondern auch in seinen Vorzügen und geistigen Schätzen nicht wäre, was es ist. Österreich ist kein Findelkind, das ohne Eltern seinen Gang in die Welt angetreten hat; man kann nicht tun, als ob diese Republik ohne Erbe plötzlich in dte Welt gesetzt worden wäre. Wir können als Österreicher nur bestehen mit dem Wissen um die alte, durch Jahrhunderte geübte Mission des österreichischen Wesens, ordnende Kraft der Mitte zu sein. Vielleicht werden sich doch einmal die ewigen Revolutionäre beruhigen, die sich nicht damit zurechtfinden, daß es einmal Kaiser und Könige gegeben hat, und so wenig von dem blutigen Erlebnis von gestern und von dem Geschehen ringsum wissen, daß sie noch immer von dem einstigen „Völkerkerker” reden.
Österreich wird nur sein und die Hingabe an das übergeordnete Gesamtinteresse wird nur richtunggebende Kraft haben, wenn der starke Glaube an Österreich und die Liebe zu ihm leben und doch auch ein wenig von dem Stolze, zu dem den Österreicher die Leistung seiner Eltern und Voreltern berechtigt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!