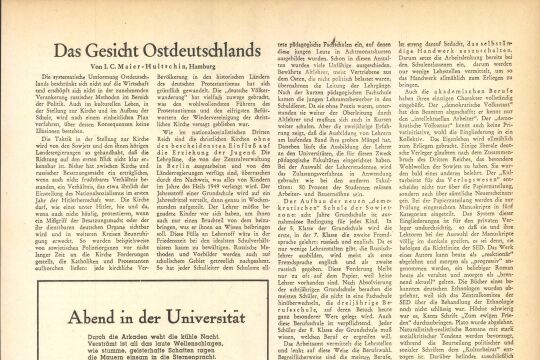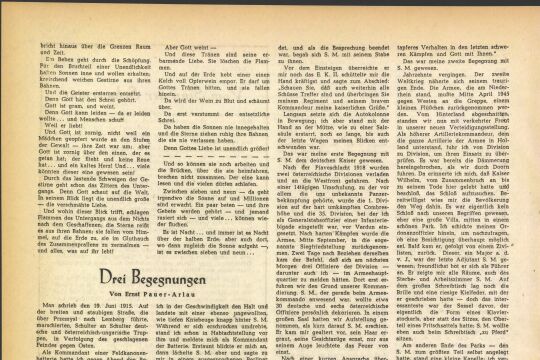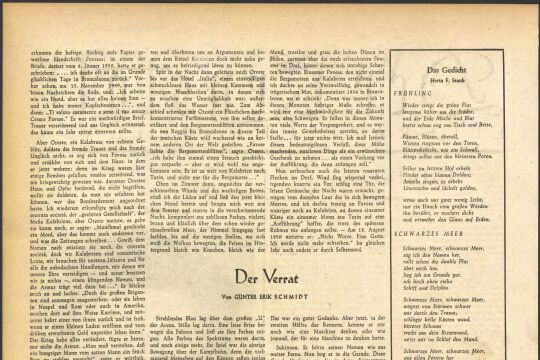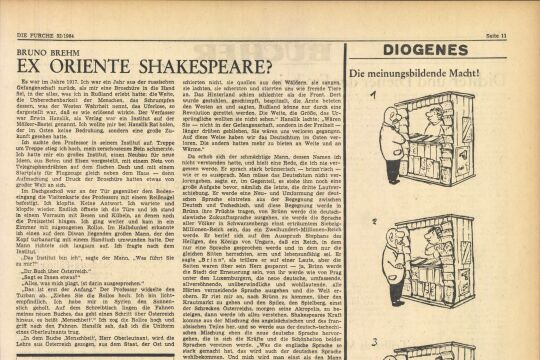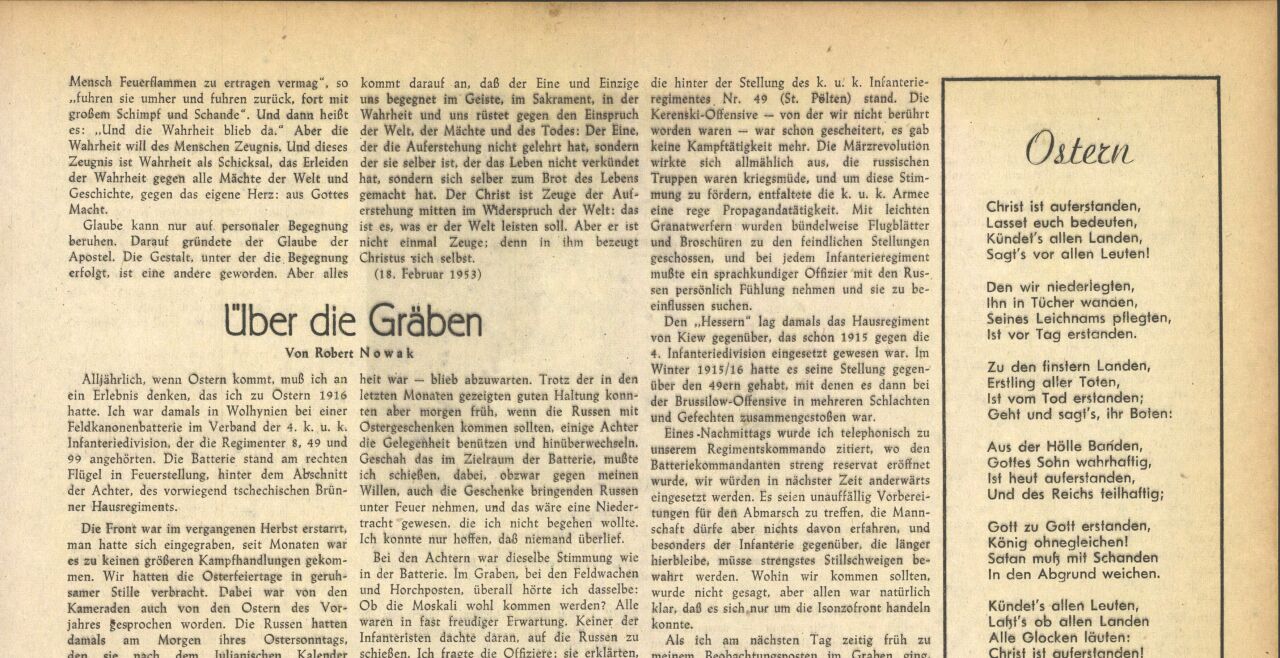
Alljährlich, wenn Ostern kommt, muß ich an ein Erlebnis denken, das ich zu Ostern 1916 hatte. Ich war damals in Wolhynien bei einer Feldkanonenbatterie im Verband der 4. k. u. k. Infanteriedivision, der die Regimenter 8, 49 und 99 angehörten. Die Batterie stand am rechten Flügel in Feuerstellung, hinter dem Abschnitt der Achter, des vorwiegend tschechischen Brünner Hausregiments.
Die Front war im vergangenen Herbst erstarrt, man hatte sich eingegraben, seit Monaten war es zu keinen größeren Kampfhandlungen gekommen. Wir hatten die Osterfeiertage in geruhsamer Stille verbracht. Dabei war von den Kameraden auch von den Ostern des Vorjahres gesprochen worden. Die Russen hatten damals am Morgen ihres Ostersonntags, den sie nach dem Julianischen Kalender ungefähr vierzehn Tage später feierten als wir, an einigen Stellen der Front den österreichischen Feldwachen Ostereier und Brot gebracht. Diese Geschenke waren von unseren Leuten mit Dank angenommen worden. Sonst geschah nichts, denn jedes Fraternisieren war natürlich streng verboten. Genau genommen galt das auch für die Annahme der Geschenke, aber da hatten die Offiziere ein Auge zugedrückt. Man war überrascht und angenehm berührt von dieser schönen Geste. Eigentlich war das viel mehr, denn diese Russen hatten uns, mitten im Krieg, symbolisch an ihrem Fest teilnehmen lassen, am höchsten christlichen Feiertag gezeigt, daß sie den Feind nicht haßten. Und das war etwas Großes ...
Seit Kriegsbeginn galten die Russen in der k. u. k. Armee als honorige Gegner; dieser gute Ruf wurde durch ihr Verhalten zu Ostern 1915 noch gefestigt.
Alles war gespannt, ob sich das heuer wiederholen würde, wir warteten geradezu darauf. Ich war zu Ostern 1915 nicht mehr an der Front gewesen, hatte aber von diesen Vorfällen gehört. Im stillen hoffte ich, die Russen würden wiederkommen, und das hätte ich gern gesehen. Es mußte ein merkwürdiges Gefühl sein, dem tapferen Gegner einmal anders, als Kamerad, gegenüberzustehen. Zufällig hatte ich an diesem Tag Beobachtungsposten im Schützengraben. Als ich mich bei meinem Batteriekommandanten, einem aktiven Hauptmann, abmeldete, schärfte et mir ein, nur ja gut aufzupassen, und erinnerte midi an das Verbot des Fraternisierens, das bei den Achtern besonders streng zu beachten sei. * Der Hauptmann war Tscheche, Berufsoffizier mit Leib und Seele, hervorragend tapfer und befähigt; er galt als der strengste Batteriekommandant des Regiments. Seine kaisertreue, gut österreichische Gesinnung war über jeden Zweifel erhaben; er bewies sie auch 1918 beim Zusammenbruch. Von Natur wortkarg und verschlossen, sprach er immer nur das Notwendigste, und so waren auch seine Instruktionen kurz und prägnant. Obzwar er es nicht ausdrücklich sagte, glaubte ich doch herauszuhören, daß, falls Russen mit Ostergeschenken kommen sollten, nicht gleich scharf geschossen werden müßte. Ich fragte nicht weiter und ritt zum Beobachtungsstand.
Beim Gedanken an den kommenden Oster-morgen wurde mir doch etwas unbehaglich zumute. Der Hinweis des Hauptmanns auf die Achter war berechtigt. Dieses Regiment, eines der ältesten der k. u. k. Armee — es war aus den Holkschen Jägern Wallensteins hervorgegangen —, hatte sich zu Beginn des Krieges gut geschlagen. Später waren mit den Marschbataillonen unverläßl'iche Elemente eingesickert, die Kampfmoral sank, und 1915 waren die Achter ausgesprochen schlecht. Einmal war sogar ein ganzes Bataillon übergelaufen. Der Regimentskommandant hatte damals einen Nervenzusammenbruch erlitten und wurde von der Front direkt in eine Heilanstalt gebracht. Das Regiment sollte strafweise aufgelöst werden, wie das Infanterieregiment Nr. 28, die Präger „Pepici“, dann wurde aber doch davon abgesehen. Die Achter bekamen einen neuen Kommandanten, den Obersten Hospodaf, und der machte wieder eine Truppe aus ihnen. Der äußere Eindruck des Regiments war jetzt ausgezeichnet; wie es sich im Kampf bewähren würde — wozu im Stelluneskriee keine Gelegenheit war — blieb abzuwarten. Trotz der in den letzten Monaten gezeigten guten Haltung konnten aber morgen früh, wenn die Russen mit Ostergeschenken kommen sollten, einige Achter die Gelegenheit benützen und hinüberwechseln. Geschah das im Ziclraum der Batterie, mußte ich schießen, dabei, obzwar gegen meinen Willen, auch die Geschenke bringenden Russen unter Feuer nehmen, und das wäre eine Niedertracht gewesen, die ich nicht begehen wollte. Ich konnte nur hoffen, daß niemand überlief.
Bei den Achtern war dieselbe Stimmung wie in der Batterie. Im Graben, bei den Feldwachen und Horchposten, überall hörte ich dasselbe: Ob die Moskali wohl kommen werden? Alle waren in fast freudiger Frwartung. Keiner der Infanteristen dachte daran, auf die Russen zu schießen. Ich fragte die Offiziere; sie erklärten, ihrer Leute vollkommen sicher zu sein.
Als der Morgen graute, saß ich schon beim 40fachen Fernrohr und suchte den Zielraum der Batterie ab. Nichts zu sehen. Allmählich wurde es heller und die Sicht besser — und da kamen sie! Am nördlichen Ende des Feuerbereichs der Batterie zwei Russen, dann noch ein dritter, ohne Waffen; jeder trug ein kleines Bündel. Sie gingen auf unsere Feldwache zu. Dort stand plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, ein Oesterreicher, auch ohne Gewehr, daneben einer, der ihm nur bis zur Hüfte reichte; der traute sich offenbar nicht, ganz aus dem Graben zu steigen. Jetzt waren die Russen herangekommen; der Oesterreicher salutierte und nahm die Geschenke entgegen. In diesem Augenblick fielen zwei Gewehrschüsse — ich konnte nicht ausnehmen von welcher Seite —, anscheinend Warnungsschüsse in die Luft, denn niemand duckte sich. Die Russen kehrten sofort um. Einer, auch schon im Gehen begriffen, wandte sich noch einmal zu dem Oesterreicher, sie schüttelten einander die Hände, dann tauchte der Achter im Graben unter, und die Russen verschwanden in Richtung ihrer Linien. Das ganze hatte nur wenige Sekunden gedauert.
Natürlich schoß ich nicht, und mein Kamerad von der Nachbarbatterie auch nicht. Als ich mittags abgelöst wurde, meldete ich dem Hauptmann, was ich beobachtet hatte. Er machte mir keine Vorwürfe. Ein flüchtiges Lächeln, und damit war die Angelegenheit erledigt, es wurde nicht weiter darüber gesprochen.
Wenige Wochen später begann die Brussilow-Offensive. Tags vorher hatten Russen aus den vordersten Gräben zu uns herübergerufen, morgen gehe es los, da hätte die Ruhe an der Front ein Ende. Sie sagten also gewissermal5cn Fehde an, wie im Mittelalter. Wir waren allerdings schon unterrichtet. Die Offensive setzte mit einem Trommelfeuer ein, wie man es bisher im Osten noch nicht erlebt hatte. Unsere Stellungen, obzwar gut ausgebaut, wurden zum Teil zerstört, und dann setzten die Russen zum Sturm an. Sie kämpften mit der heldenmütigen Tapferkeit, die schon Napoleon an ihnen gerühmt hatte, aber unsere Infanterie gab ihnen nichts nach. Alle Angriffe wurden abgeschlagen, nirgends kam der Gegner in unsere Gräben. Am nächsten Tag mußte die Division aber doch zurückgenommen werden, weil den Russen im Süden, bei Luck, ein größerer Duschbruch gelungen war. Es entspannen sich erbitterte, beiderseits sehr verlustreiche Kämpfe, die über zwei Monate dauerten.
Was zu Ostern zwischen den Linien vorgefallen war, hatte weder bei den Russen noch bei den Oesterreichern der sogenannten Kampfmoral geschadet. Hervorragend schlugen sich die Achter, die damals unbestritten das beste Regiment der Division waren. Sie bekamen eine Belobung vom Armeekorps und auch vom deutschen AOK. Linsingen, dem zur Zeit die 4. Infanteriedivision unterstellt war. An der Spitze seines Regiments, das er persönlich zum Angriff führte, holte sich Oberst Hospodaf den Theresienorden.
Nach dem letzten Gefecht am 8. August 1916 trat in diesem Frontabschnitt Ruhe ein. Die Stellungen wurden ausgebaut, es begann wieder der langweilige Grabendienst. Die Märzrevolution in Petersburg brachte vorläufig auch keine Aenderung, alles blieb beim alten.
Im Spätsommer 1917 führte ich eine Batterie,die hinter der Stellung des k. u. k. Infanterieregimentes Nr. 49 (St. Pölten) stand. Die Kerenski-Offensive — von der wir nicht berührt worden waren — war schon gescheitert, es gab keine Kampftätigkeit mehr. Die Märzrevolution wirkte sich allmählich aus, die russischen Truppen waren kriegsmüde, und um diese Stimmung zu fördern, entfaltete die k. u. k. Armee eine rege Propagandatätigkeit. Mit leichten Granatwerfern wurden bündelweise Flugblätter und Broschüren zu den feindlichen Stellungen geschossen, und bei jedem Infanterieregiment mußte ein sprachkundiger Offizier mit den Russen persönlich Fühlung nehmen und sie zu beeinflussen suchen.
Den „Hessern“ lag damals das Hausregiment von Kiew gegenüber, das schon 1915 gegen die 4. Infanteriedivision eingesetzt gewesen war. Im Winter 1915/16 hatte es seine Stellung gegenüber den 49ern gehabt, mit denen es dann bei der Brussilow-Offensive in mehreren Schlachten und Gefechten zusammengestoßen war.
Eines -Nachmittags wurde ich telephonisch zu unserem Regimentskommando zitiert, wo den Batteriekommandanten streng reservat eröffnet wurde, wir würden in nächster Zeit anderwärts eingesetzt werden. Es seien unauffällig Vorbereitungen für den Abmarsch zu treffen, die Mannschaft dürfe aber nichts davon erfahren, und besonders der Infanterie gegenüber, die länger hierbleibe, müsse strengstes Stillschweigen bewahrt werden. Wohin wir kommen sollten, wurde nicht gesagt, aber allen war natürlich klar, daß es sich,nur um die Isonzofront handeln konnte.
Als ich am nächsten Tag zeitig früh zu meinem Beobachtungsposten im Graben ging, traf ich den Propagandaleutnant der 49er, der eben von seiner morgendlichen Unterhaltung mit den Russen zurückkam. Sichtlich verdattert: ich hatte noch nie ein so maßlos erstauntes Gesicht gesehen. Auf meine Frage erzählte er, die Russen hätten sich in aller Form von ihm verabschiedet. „Es tut uns leid, daß euer Regiment fortkommt“, hatten sie gesagt. „Wir kennen einander doch schon so lang und haben oft gegen euch gekämpft. Ihr seid immer anständige, ehrliche Gegner gewesen.“ Und dann hatten sie dem Leutnant, der von dem bevorstehenden Abmarsch der Division keine Ahnung hatte, die Hand geschüttelt und ihm und dem Regiment Nr. 49 viel Glück auf dem neuen Kriegsschauplatz gewünscht.
Wie viele andere hatte auch ich damals vor allem das Komische dieses Erlebnisses empfunden. Wir lachten darüber und anerkannten das gute Funktionieren des russischen Nachrichtendienstes. Erst später kam mir zu Bewußtsein, daß in diesen Abschiedsworten einfacher russischer Soldaten ein Gefühl echter Kameradschaft Ausdruck gefunden hatte, ein menschliches Gefühl, das an der Kampffront zwischen Gegnern aufgekeimt war, die einander oft mit der Waffe gegenübergestanden und schwere blutige Verluste zugefügt hatten.
Ich glaube nicht, daß im zweiten Weltkrieg etwas dieser Art vorgekommen ist oder auch nur möglich gewesen wäre.