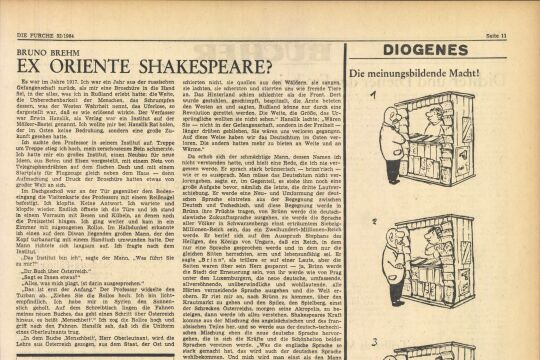Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Osterreichische Aktenstucke aus Peking
Diplomatische Berichte beleuchten das Verhältnis Chinas zum “Westen und Christentum um die Jahrhundertwende
Diplomatische Berichte beleuchten das Verhältnis Chinas zum “Westen und Christentum um die Jahrhundertwende
Die k. u. k. Gesandtschaft für Ostasien“, die erst im Jahre 1896 in zwei verschiedene Missionen, eine für China und eine für Japan, geteilt worden ist, war ein Gebilde ganz eigener Art. Lange Zeit fast ein Aschenbrödel unter den diplomatischen Vertretungen der österreichisch-ungarischen Monarchie, wurde sie dennoch nicht nur von ausgezeichneten Kennern Asiens und seiner Völker, sondern auch von wirklichen Könnern auf diplomatischem Gebiet geleitet. Und so kommt es, daß gerade ihre Berichte eine Fülle von Meldungen bringen, die auch heute noch für die Beurteilung der Geschehnisse im Fernen Osten von außerordentlichem Interesse sind.
Wie nicht anders zu erwarten, nehmen in dieser Berichterstattung die Fragen der Auseinandersetzung Chinas mit dem Christentum einen hervorragenden Platz ein. Und wenn es sich dabei auch zumeist um mehr oder weniger äußerliche Dinge handelt, wie Schutz der Missionsstationen, Verfolgungen von Konvertiten, Beschwerden der Missionare usw., so lassen sich doch daraus verschiedene Punkte klar entnehmen: so vor allem, daß es keineswegs Intoleranz oder Abneigung des Chinesentums oder der chinesischen Regierung gegen das Christentum an sich gewesen ist, was immer wieder Verfolgungen aufflammen ließ, sondern erstens Abneigung des Chinesen gegen die Fremden und das Fremde überhaupt, dann aber auch der Mißbrauch des Missionswesens durch einige der europäischen Gesandtschaften zu rein politischen Zwecken.
Die Richtigkeit dieser Auffassung vermochte sich allerdings im .Zeitalter des Imperialismus“ bei den europäischen Mächten kaum Geltung zu verschaffen, aber auf chinesischer Seite wurde sie durch Jahrzehnte mit immer steigendem Nachdruck verfochten, und zwar gerade von den führenden Männern, wie etwa Li-Hung-Tschang oder Yuan-S h i - K a i. Besonders von den Äußerungen des ersteren, unzweifelhaft des bedeutendsten Staatsmannes und des universalsten Geistes, den das neuere China hervorgebracht hat, sind die Berichte jener Jahrzehnte voll. Sie können geradezu als Schulbeispiel dafür gelten, wie sich diese Auffassung der Beziehungen zwischen Chinesentum und Christentum allmählich entwickelt und durchgesetzt hat.
In seiner Jugend stand auch Li-Hung-Tschang auf einem streng ablehnenden Standpunkt, und als er kaum seinen Doktor der Literatur an der kaiserlichen Han-lin-Universität in Peking gemadit hatte, also am Beginn seiner langen politischen Laufbahn, da äußerte er sich noch recht drastisch über die christlichen Missionare und das Missionswesen:
Diese fremden Teufel“, sagte er da, „kommen nicht zum Segen des Landes herein. Sie predigen und sprechen in lautem Ton, halten ihre Hände hoch und behaupten, zum Besten des Landes zu kommen, aber ich höre, daß jeder einzelne von ihnen ein bezahlter Agent irgendeiner fremden Macht ist und sie nur hierherkommen, um gegen die Regierung zu spionieren. Diese Schwarzröcke sind von einer Sekte der ausländischen Teufel; man sagt, es gäbe viele Sekten, alle hassen sich- untereinander, aber alle predigen sie für denselben Gott„ den sie ,Tien-fu' (himmlischer Vater) nennen. Wenn sie solchen Vater haben, kann er nicht stolz auf seine Söhne sein, denn es sind ungelehrte Leute und Barbaren. Aber es ist wunderbar, daß sie imstande sind, einige der Unsrigen von der alten Religion und Philosophie abzubringen; ich kann das nicht begreifen und glaube, diese verrückte Sache wird bald ein Ende nehmen.“
Als aber Li-Hung-Tschang rasch höher stieg auf der politischen Stufenleiter, als er als Feldherr und als Vizekönig und Erster Staatssekretär im täglichen Verkehr mit Ausländern stand und viele von ihnen seine Freunde nannte, da klärte sich sein Blick auch für das Verhältnis der christlichen Religion zum Chinesentum. Nun gab er allenthalben seiner Uberzeugung dahin Ausdruck, daß der christliche Glaube gar nicht um seiner selbst willen so verhaßt sei, sondern lediglich deshalb, weil er eben ausländisch“ sei.
Während mehrerer Jahre“, so meinte er nun, „habe ich der Religion des Westens ein recht eingehendes Studium gewidmet und viel darüber nachgedacht, und ich kann nicht finden, daß sie sich mit unserer Philosophie im Widerspruch befindet. Im Gegenteil, die Lehren des Konfuzius und die von Jesus scheinen beide auf einem erhabenen Standpunkt zu stehen, geschaffen und verbreitet zur Besserung der Menschheit, der .Heiden' sowohl wie der Christen. Soviel weiß ich, daß, wenn mein Los so gefallen wäre, daß ich in England, Frankreich oder Amerika lebte, ich selber gern ein Christ wäre, denn das ist die Religion jener Länder, und ein Mann, der sein Leben nach diesen Grundsätzen führt, würde alle Schwierigkeiten vermeiden und geachtet werden, er würde nicht an Konfuzius denken, denn er würde seiner und seiner Lehre nicht bedürfen. Umgekehrt ist es dasselbe mit China: Ich habe kein Verlangen nach Christus, wenn ich nur unserem eigenen großen Philosophen folge. Aber wenn ich daher auch nicht einen persönlichen Ruf zur christlichen Religion empfinde, so will ich mich ihr doch nicht feindlich gegenüberstellen, und ich glaube vielmehr, daß es Tausende, vielleicht Millionen in China gibt, die in gewisser Weise einen Segen durch die Kenntnis von Jesus erfahren würden, besonders weil sie sich gar keine Mühe geben, sich nach den Vorschriften des Konfuzius zu richten. So möchte ich die Gefühle der intelligenteren Beamten und Literaten der Neuzeit dahin zusammenfassen, daß es der Ausländer als solcher ist, der gehaßt wird, nicht wegen seiner Religion sondern weil man ihn im übrigen fürchtet. Man fürchtet ihn jetzt gar nicht, weil er der Diener Jesu Christi ist oder ein Bekenner der Lehre dieses großen Mannes, sondern weil er möglicherweise ein Feind der politischen und industriellen Unabhängigkeit des Landes ist. Es ist an der Zeit, daß unser Volk sich klar macht, daß nicht alle Ausländer sich gleich sind und daß viele Christen manchen Taoisten und Verehrern Buddhas vorzuziehen sind.“
Seine merkwürdigste Begegnung mit dem Christentum hatte Li-Hung-Tschang jedoch wenige Jahre vor seinem Tod, und seine Worte darüber sind ein ergreifendes Zeugnis dafür, wie geistig und sittlich hochstehend dieser chinesische Weise und Staatsmann gewesen ist.
Während der Friedensverhandlungen mit Japan in Shimonoseki, 1895, hatte ein japanischer Fanatiker, ein „Verrückter“, einen Anschlag auf ihn verübt und ihn durch einen Revolverschuß ins Gesicht schwer verletzt. Spontan waren ihm daraufhin aus ganz Japan Sympathiekundgebungen zugekommen, und als erste hatte die kleine christliche Missionsstation Ketuki bei Moji eine Abordnung mit Blumen in sein Krankenzimmer entsendet. Heimgekehrt in seinen vizeköniglichen Palast in Tientsin, berichtet nun Li-Hung-Tschang am 28. Juli:
„Ich kann es nicht glauben, daß alle Leute schlecht sind, denn ich hatte heute, vor einer Stunde, ein Erlebnis, das mich glauben läßt, daß auch außer Amt und Geschäften, außer Reichtum und Ehre es kleine Begebenheiten gibt, die eines Mannes Herz bewegen und es ihm fühlbar machen, daß die Menschheit nicht nur aus Eisen, Gewinnsucht und Lüge besteht. Denn heute war diese Wohnung, die mir seit 24 Jahren gehört, der Schauplatz einer großen Mission, so wie niemals vorher sich eine genaht hatte. Ich weinte fast, als ich sie empfing: zwei eingeborene Christen kamen den weiten Weg von der jämmerlichen Stadt Ketuki in Japan, um mir Arzneien für meinen Kopfschmerz zu bringen und sich zu erkundigen, ob es mir besser gingel Ich möchte wissen, ob sie es taten, weil das Christentum es lehrt? Es muß wohl so sein, denn die Japaner sind Menschen, die die Ausländer hassen, besonders die Chinesen. So müssen es doch neue Gedanken sein, die dieser Mann und sein Sohn in ihren Kopf aufnahmen,um derartiges zu tun. Sato, so h:eß der Mann, erzählte mir, daß sie in ihrer Missionsstation täglich von mir gesprochen hätten, seit sie damals bei mir gewesen waren, und daß sie stets zum Gott der Christen gebetet hätten, daß er mich gesundmachen möge. Nun aber hätten sie die Ungewißheit nicht länger ertragen, hätten Geld untereinander gesammelt und ihn und seinen kleinen Sohn zu mir gesandt mit guten Wünschen und einigen Mitteln aus Kräutern.
Ich glaube, dies Christentum macht arme und bescheidene Leute mutig und unerschrocken, denn ehe ich Sato und seinen Sohn reich beschenkt entließ, frug er mich, ob er für mich beten dürfe. Ich sagte ,ja', weil ich glaubte, sie wollten es tun, wenn sie wieder zu Hause wären, aber er sagte seinem kleinen Sohn etwas und sie knieten gleich vor der Tür nieder und sprachen ein Gebet. Ich konnte es nicht verhindern, daß mir das Herz klopfte, als ich diesen Mann da mit seinem Sohn knien sah, zu Gott betend
— zu dem Gott, der mit mir wäre und mit ihnen und der ganzen Menschheit —, daß ich wieder ganz gesund werden möchte. Es tat mir leid, sie fortgehen zu sehen. In diesem alten Haus, das das meine 20 Jahre hindurch war, haben sich merkwürdige Ereignisse abgespielt. Große Beratungen wurden darin abgehalten, mitternächtliche Konferenzen, die die ganze Welt betrafen, ich habe darin Könige und Fürsten, Gesandte, Minister, Räuber, Mörder und Bettler empfangen; Menschen sind' von hier aus verurteilt und zum Tode geführt, andere mit Geschenken und Ländereien beglückt worden; Eisenbahnkontrakte wurden hier abgeschlossen, öffentliche Ämter vergeben. Aber bei jeder Gelegenheit, was sie auch sein mochte, blieb ich absoluter Herr meines Hauses und meiner selbst
— bis vor einer Stunde. Da war es, glaube ich, das erstemal, daß ich das Gefühl hatte, es würde mir eine Gunst erwiesen.
Armer, guter Herr Sato, da kommt er den weiten Weg von Japan her, um für den .Heiden', den alten Vizekönig, ein christliches Gebet zu sprechen! Ich glaube nicht, daß irgend jemand außerhalb meiner Familie mich genügend liebte, um derartiges für mich zu tun. Ich liebe die Japaner nicht, aber vielleicht könnte das Christentum mich dazu bringenl“
Hat der abgeklärte Weise und konfuzianische Philosoph Li-Hung-Tschang am Ende seines langen, erfolgreichen Lehens nicht doch noch „einen persönlichen Ruf zur christlichen Religion“ empfunden?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!