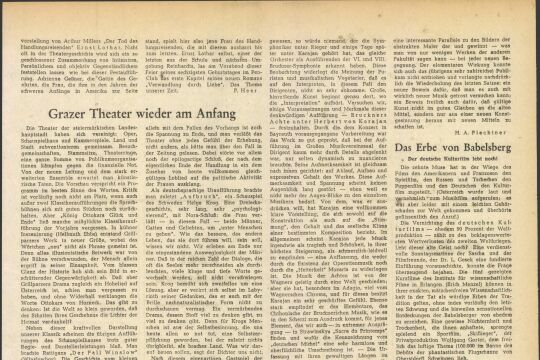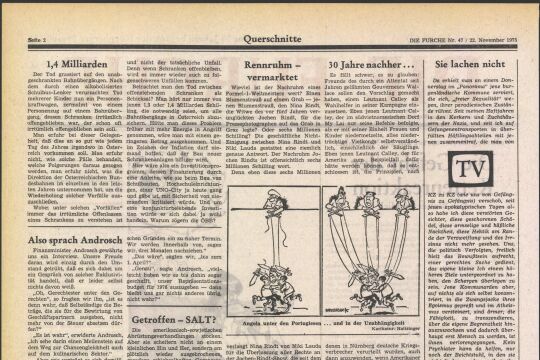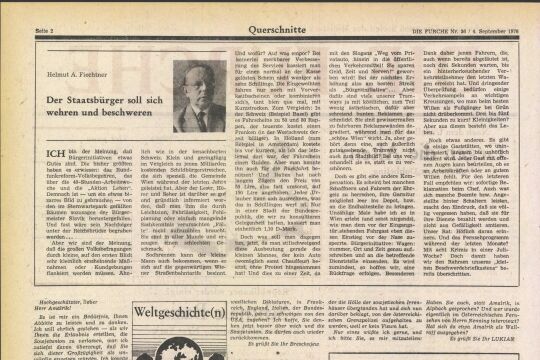Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Pegasus im Joche
Mit dem Demissionsschreiben, das Herbert von Karajan am 7. Februar 1962 an den Unterrichtsminister richtete, hat eine ebenso glanzvolle wie schwierige Ära der Wiener Staatsoper ihr Ende, zumindest aber eine einschneidende Zäsur erfahren. Der Anlaß für diesen die Öffentlichkeit überraschenden Schritt Karajans war eine ganz bestimmte Phase in dem nun schon seit mehr als fünf Monaten schwelenden Konflikt zwischen dem technischen Personal und der Bundestheaterverwaltung beziehungsweise der Operndirektion. Die Verhandlungen zur Behebung dieser Differenzen wurden — worauf wir schon im November des vergangenen Jahres hingewiesen haben — von seiten der Bundestheaterverwaltung recht lässig geführt, vielleicht auch ein wenig auf die leichte Schulter genommen, obwohl die Weigerung des technischen Personals, die bisher übliche hohe Zahl von Überstunden zu leisten, den regulären Betrieb immer mehr störte, zu häufigen Ilmdispositionen des Spielplan zwang, die Aufführung längerer und szenisch komplizierter Werke verhinderte und schließlich auch die Absage und Verschiebung eines Ballettpremierenabends notwendig machte.
„Um einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu finden“, hat Karajan— nach der Darstellung in seinem Demissionsschreiben — mit Unterrichtsminister Dr. Drimmel vereinbart, „die Operndirektion solle nunmehr von sich aus versuchen, im persönlichen Kontakt mit allen Gruppen des technischen Personals der Staatsoper die echten Bedingungen zur Wiederherstellung eines gesicherten künstlerischen Betriebes und eines guten Arbeitsklimas als Grundlage neuer Verhandlungen zu klären“. Unmittelbar darnach wurde weiterverhandelt — aber nur zwischen der Bundestheaterverwaltung und der „Gewerkschaft technisches Personal“. Also ohne Karajan. Und es wurde auch ein Kompromiß erzielt, von dem der Außenstehende freilich den unangenehmen Eindruck hat, dieser sei vor allem im Hinblick auf den Opernball zustande gekommen, an dem so viele einflußreiche Prominente bekanntlich sehr interessiert sind. „Die Tarsache“, so begründet Karajan seine Demission, „daß man sich unter bewußter Ausschaltung des künstlerischen Leiters und seiner Direktion auf einen Kompromißvorschlag geeinigt hat, stellt einen so schwerwiegenden Eingriff in die Kompetenzen des künstlerischen Leiters dar, daß dessen Funktion unter solchen Umständen sinnlos wird und es ihm unmöglich macht, das von
Ihnen seit Jahren in ihn gesetzte Vertrauen in Zukunft rechtfertigen zu können.“
Aus einer Erklärung, die Unterrichtsminister Dr. Drimmel am 9. Februar abgab, erfuhr man dann, daß erstens der Kompetenzbereich Karajans durch die stattgefundenen Verhandlungen nicht verletzt worden sei, und daß zweitens der Streit um ein t i e f e-res Problem gehe: „Herr von Karajan lehnte die Struktur der Bundestheater ab. Was er wollte, war die Emanzipierung der Staatsoper“, zugleich ihre Eingliederung in ein weltweites Kombinat, „als eine Verbindung der vier oder fünf bedeutendsten Opernhäuser in Europa. England und USA. Herbert von Karajan erwartet sich davon die Wahrung des einzigartigen Prestiges der Wiener Staatsoper, den Schutz vpr der Mittelmäßigkeit“.
Aber ist das neu? Konnte das jemanden, der Karajans Eigenart und Ambitionen kennt, irgendwie überraschen? Hat er nicht unter eben diesen Auspizien die Leitung der Wiener Staatsoper angetreten? Als im Juni 1956 Herbert von Karajan :um künstlerischen Leiter der Wiener Staatsoper ernannt wurde, haben wir das keineswegs mit Enthusiasmus begrüßt, sondern waren eher skeptisch. Und zwar nicht nur deshalb, weil uns die ungute Art mißfallen hat, in deT Dr. Karl Böhm, der unmittelbare Vorgänger Karajans, „abserviert“ wurde. Sondern weil wir uns, im Hinblick auf Karajans damals noch umfangreichere Auslandsverpflichtungen, fragten, wie denn das um alles in der Welt gut gehen sollte, zumal in Karajans Vertrag keine Präsenzklausel (wie bei Böhm) aufgenommen war, er aber als künstlerischer Leiter doch wohl die Oberaufsicht und Verantwortung über und für sämtliche, auch in seiner Abwesenheit stattfindenden Aufführungen zu tragen hatte.
Damals tauchte zum erstenmal vor unseren Augen das deprimierende Bild vom Pegasus im Joche auf.
Drei Tage nach Karajans Betrauung wurde vom damaligen Leiter der Bundestheaterverwaltung (Dr. Marboe), Karajan und dem Generalintendanten der Scala noch ein anderer Vertrag unterzeichnet, betreffend jede Art künstlerischer Kollaboration mit dem Mailänder Opernhaus. Man weiß, was aus diesem bilateral geplanten Austausch inzwischen geworden ist. Es muß aber auch daran erinnert werden, daß Punkt 6 jenes Vertrages einen Aufruf an andere große Operninstitute enthielt, an diesem Austausch teilzunehmen (vgl. hierzu Dr. Drimmels Ausführungen in seiner Erklärung vom 9. Februar 1962). Für diejenigen, die noch an die Eigenständigkeit der Wiener Oper, einen Wiener Opernstil oder gar das „Wiener Ensemble“ glaubten, war dieser Vertrag ein Alarmzeichen. Und die Kritik daran ist, trotz einzelner glanzvoller italienischer Abende, nie ganz verstummt.
Zunächst aber wollen wir unsere Meinung über Karajan als Künstler präzisieren.
Am Dirigentenpult bot Karajan das fast unheimliche Bild eines Mannes, der dreißig-, der hundertmal hintereinander ins Schwarze trifft. Alles, was er jahraus, jahrein dirigierte, war von der gleichen makellosen Vollkommenheit (wobei wir das Wort „Perfektion“ wegen seines konfektionären Charakters, welcher der Einmaligkeit der jeweiligen Leistung nicht gerecht wird,
absichtlich vermeiden). Ob Bruckners Achte oder „Peter und der Wolf“, ob „Parsifal“ oder „Fledermaus“ — es bleibt dem Hörer nichts zu wünschen übrig. Solche Leistungen sind, von aller technischen Meisterschaft abgesehen, die sie zu ihrer Realisierung bedürfen, nur möglich durch eine kongeniale Einfühlung in die Werke der Großen, und man kann diese Fähigkeit, ohne das Schöpferische, herabzusetzen, als die Genialität des Interpreten bezeichnen. — Auch mit seinen Inszenierungen, die im Detail nicht immer geglückt waren, streift Karajan die obere Sphäre, und zwar durch die Deutlichkeit der Vision, die er von einem Bild, einer Szene hat. Daher die 75 Beleuchtungsproben zu „Götterdämmerung“, und nicht nur aus Spieltrieb, der ja bei fast allen künstlerischen Naturen festzustellen ist. Aber wußte er, als er anfing zu inszenieren, was er sich da alles auflud? Auch unter dieses Joch hat sich unser Pegasus begeben. '
Am wenigsten glücklich war Karajan bei der Auswahl der Novitäten. Entweder er kannte die zeitgenössische Produktion zuwenig oder er ging von vornherein den Weg des geringsten Widerstandes und fällte seine Entscheidungen nach außerkünstlerischen, sagen wir: mehr praktischen Kriterien. Das galt gleichermaßen für Salzburg wie für Wien. Dort bescherte er uns eine Reihe uninteressanter Premieren, hier verloren die Staatsoper und ihr Publikum immer mehr den Kontakt nicht nur zum Neuen, sondern zum Geistigen des Musiktheaters ganz allgemein. In diesem Blatt befaßte sich, noch zur Zeit von Dr. Hilbert, eine ganze Reihe
von Artikeln und temperamentvollen, kenntnisreichen Leserbriefen mit dem Komplex „das geistige Profil der Wiener Staatsoper“.
Mit solchen Fragen sich zu beschäftigen, haben Publikum und Presse längst aufgehört. Wer, in der Direktion oder in der Verwaltung, hat die Fähigkeit oder auch nur die Zeit, sich mit solchen Dingen abzugeben, wo doch das Interesse ausschließlich der Besetzung, weniger schon dem Dirigenten, am allerwenigsten dem - Regisseur einer Aufführung, aber schon gar nicht dem Werk gilt? Dieses; Abgleiten ins „Kulinarische“, zu dem das Wiener Opernpublikum ohnedies neigt, war die größte Gefahr während der Karajan-Ära, zumindest die von NichtFans am ernstesten genommene. Nicht nur, daß das Wiener Opernpublikum jahrelang, vor jedem frischen Windhauch beschirmt, sondern daß seiner kulinarischen Neigung durch immer luxuriösere Aufführungen stets neue Nahrung zugeführt wurde, war das Besorgniserregende. Das gleiche gilt auch für die Regie und das Bühnenbild, wo kaum einmal etwas Kühnes und Neues versucht wurde. (Daß man auch ältere Werke -zu erregender Lebendigkeit -erwecken kann, wird derjenige nicht bestreiten, der etwa Wieland Wagners „Aida“-Inszenierung gesehen hat.)
Diese Sorge um das „geistige Profil“ der Wiener Staatsoper möge nicht unberücksichtigt bleiben, wenn man letzt nach einem „Direktor“, wie ihn Unterrichtsminister Dr. Drimmel mit Recht fordert. Ausschau hält. Von einem großen Interpreten, dessen Kraft und Interesse jeweils nur auf das in
Vorbereitung befindliche Werk zentriert ist, kann das nicht oder nur ausnahmsweise erwartet werden.
Der Leiter eines großen Hauses muß außer einem eigenen geistigen Profil aber noch andere Eigenschaften haben: die de Hausvaters, der alle Sorgen und Nöte seiner vielen Kinder kennt; die eines Gärtners, der jedem Bäumchen seinen Platz gibt und auch ein Auge für den Nachwuchs hat; schließlich auch die eines — womöglich gutgelaunten — Zirkusdirektors, der durch keinerlei Kapriolen aus dem Konzept gebracht werden kann. Ein solcher Mann darf — und wird — sich .nie als „Pegasus im Joche“ fühlen. Denn er weiß, was auf ihn wartet. Unter anderem: die Bundestheaterverwaltung mit ihrem Chef.
Aber noch ist vielleicht das Kapitel „Karajan“ nicht abgeschlossen. Es war jedenfalls, von dem dissonanten Ausgang abgesehen, kein unrühmliches in der Geschichte der Wiener Oper. Der Minister und sein über Länder, Wolken und Meere stürmender Pegasus — sie haben es in diesem Quinquennium nicht leicht gehabt. Ruft man sich noch einmal die komplizierten Prämissen dieser Direktionsära ins Gedächtnis zurück — eine der Quadratur des Kreises nicht unähnliche Rechnung —, so wundert man sich, daß es s o lange s o gut gegangen ist. Das aber kann nur als ein Zeichen dafür genommen werden, daß es beide Teile am guten Willen nicht fehlen ließen. Möge dieser auch Herrn von Karajan in Erinnerung bleiben bei den künftigen Entschlüssen, die er in bezug auf die Wiener Staatsoper zu fassen haben wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!