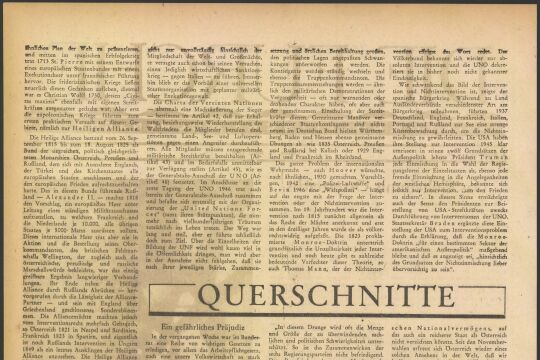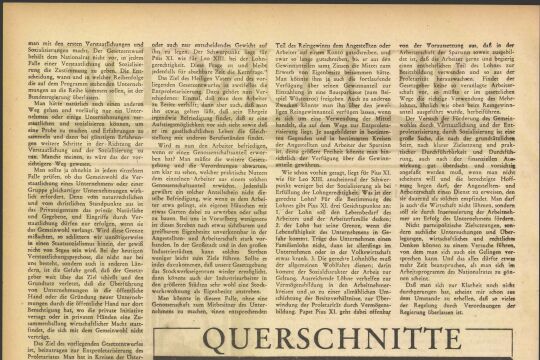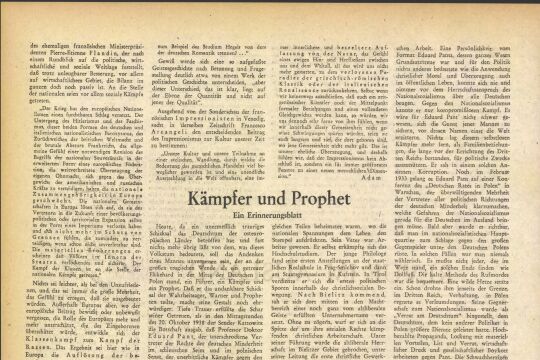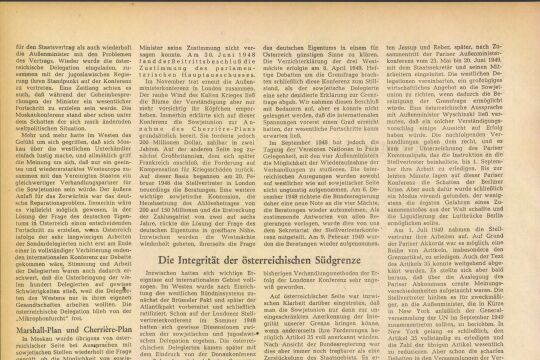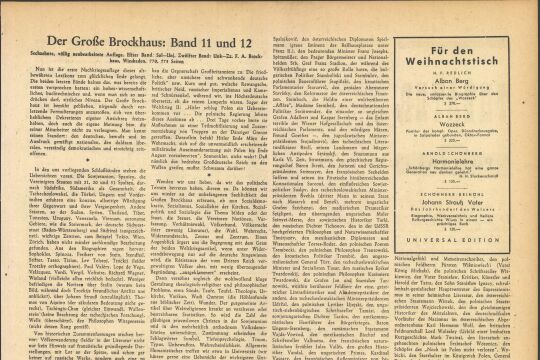Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randbemerkungen ZUR WOCHE
JETZT IST DIE ZEIT, da eine seltsame Unruhe die Sekretariate aller politischen Parteien befällt. Dicke Polstertüren schließen sich, Konferenzen wechseln mit Aussprachen unter vier Augen. Gebetene und ungebetene Besucher klopfen an. Gute „Freunde“ belauern sich gegenseitig wie Indianer auf dem Kriegspfad. Kein Wunder: geht es doch wieder um Nationalratsmandate, um die Erneuerung von alten, um die Erwerbung von neuen. 165 Abgeordnete haben im großen Saal des Hauses der Gesetzgebung Platz, aber viel, viel mehr Anwärter sind bereit, Würde und Bürde eines Volksvertreters zu übernehmen. Darum stellt sich hinzu, wer sich eben berufen fühlt, und spielt mit bei dem wenig erbaulichen Schauspiel dieser Wochen. Die Namen der Glücklichen, die mit Aussicht auf Erfolg Placierten werden wir noch rechtzeitig erfahren. Aus der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode lassen sich unschwer Schlüsse ziehen, die gerade bei der Erstellung der einzelen Kandidaten von Einfluß sein sollten. Erinnern wir uns nur: wann horchte in den letzten drei Jahren die österreichische Bevölkerung auf ihre Parlamentarier, wann sahen sich Parteiblätter veranlaßt, in Sonderdrucken ganze Reden Abgeordneter zu verbreiten? Zum Beispiel fast immer, wenn ein einzelner Abgeordneter, ein Innsbrucker Universi- tätsprofessor, dem zu einer Fülle des Wissens auch noch die Gabe der Rede geschenkt ist, das Wort ergriff. Dieser Innsbrucker Professor aber wurde — das ist zu wenig bekannt — auf der Liste des Tiroler Bauernbundes gewählt. Die Tiroler Bauern haben diese Wahl sicher nie bedauert, ihre ureigensten agrarischen Interessen erlitten dadurch, daß sie einen Mann von Bildung und politischer Kultur, einen „G’studierten“, in die Volksvertretung geschickt hatten, bestimmt keinen Nachteil. Im Gegenteil: Freude mußten sie empfinden bei den Erfolgen ihres Abgeordneten. Das war nur ein Beispiel. Es läßt den Wunsch wachwerden nach einer größeren Zahl von geistig und politisch selbständigen Menschen auf den Bänken des Nationalrates 1953 — mit einem Wort: nach ausgeprägten Persönlichkeiten. Gut beraten sind alle jene politischen Gruppen, die sich solcher Menschen, ungeachtet des obligaten innerparteilichen Dschungelkrieges um Mandate, versichern.
„STAATSBÜRGER IN UNIFORM“. Es ist zuviel gesagt: diese drei Worte halten die Tragödie Deutschlands in den letzten einhundertfünfzig Jahren fest. Schärfer als Hegels These und Antithese im Reichshimmel der Ideen standen sich diese beiden gegenüber: der „Staatsbürger“ und der „Mann“ in „Uniform“. Als Symbol für den Zerfall Deutschlands in ein Reich in Waffen, „Blut“ und „Eisen“, das „Realpolitik“ betreibt, und von Offizieren des Königs und Kaisers vertreten wird, und in ein hilflos-lächerliches Geistreich, für das die ohnmächtige Resistance Virchows und Mommsens gegen Bismarck charakteristisch ist. Potsdam und Weimar also. 1S71 spricht der Kriegsfreiwillige Nietzsche bereits von der Abdankung des deutschen Geistes zugunsten des Deutschen Reiches. Die „Zivilisten“ hatten den innenpolitischen Kampf des 19. Jahrhunderts verloren, worauf die „Männer in Uniform“ die Kriege des 20. Jahrhunderts beginnen und verlieren durften. Es geziemt sich heute, klar und deutlich festzuhalten: das deutsche Bürgertum hatte gerade in Preußen, zwischen 1818 und 1870, einen bitterernsten parlamentarischen Kampf um die Kontrolle, um die Herrschaft über das Heer, die Armee geführt. Und war gegen Adel, König, Herrschaftscliquen unterlegen. Wir kennen aus den Veröffentlichungen der letzten Jahre die weltpolitische Bedeutung dieses Ringens: in England und Amerika siegte der „Zivilist“ über die Armee: das Ergebnis: eine abgewogene Außenpolitik, eine Kriegsführung auch, in der der Soldat nur Mittel ist. In der es nur in den allerseltensten Fällen dem Soldaten gestattet wird, Politik zu betreiben. Anders in Deutschland: nicht der Staatsbürger erzog sich hier seine Armee, sondern die Armee steckte den Staatsbürger in Uniform und zog ihm damit seine Menschenrechte ab wie eine schlechte „zivilistis ehe Clamotte“. Die berühmt-berüchtigte Militarisierung des deutschen Volkes ist nichts anderes als eben dies: daß es der „Wehrmacht“ gestattet wurde, Menschen nach ihrem Bild und Gleichnis zu formen, und daß dies nicht gekaufte und erpreßte, teilweise sogar gestohlene Söldner waren, wie unter Friedrich dem Großen, sondern daß von der Regierung als Menschenmaterial zur Verfügung gestellt wurde: der deutsche Staatsbürger. Der in dem Augenblick, indem er die Uniform anzog, aus dem Reich Kants, Goethes und Schillers hinüberglitt in das Befehlsreich seines Feldwebels und Offiziers, vieler Befehlsgeber und Befehlsempfänger. Es wird also verständlich, wenn mehr als eine innerdeutsche Öffentlichkeit, genau: der ganze demokratische Westen, tief beunruhigt wurde, als aus Bonn Nachrichten kamen von der Entlassung der Exponenten einer neuen Erziehung in der deutschen Wehrmacht, in der „Dienststelle Blank“. Theodor Blank, der Sicherheitsbeauftragte der westdeutschen Bundesregierung, hielt es nun, mit Recht, für notwendig, der Öffentlichkeit beruhigende Erklärungen abzugeben: er vertrete nach wie vor die neue Richtung: also „Staatsbürger in Uniform“, nicht: „Zivilisten“, aus denen erst richtige Menschen gemacht werden müssen, durch Drill und Kadavergehorsam. Die Gerüchte, daß die alte Richtung obsiegt hätte, seien falsch. Wir wollen gerne Herrn Blank Glauben schenken; ist er doch bekannt als ein Mann von aufrechter demokratischer Gesinnung. Und wollen hoffen, daß er selbst sich durchsetzen kann. Denn es steht viel auf dem Spiel, in den Spielen um die „Dienststelle Blank“, um das Bonner Kriegsministerium, die Schule der Nation, des deutschen Menschen: wird es die Armee sein, oder wird diese selbst der Schule der Nation unterworfen, und das heißt ihren leidvollen Erfahrungen in mehr als drei Kriegen? — Die junge deutsche Demokratie steht hier vor ihrer bisher schwersten Belastungsprobe.
BUNDES WÜTEN GEGEN DIE EIGENE VERGANGENHEIT ist eine jener Krankheiten, vor denen kein Volk gefeit zu sein scheint. Auch die Österreicher haben in den letzten dreißig Jahren mehrmals von verschiedener politischer Seite Versuche erlebt, die Wurzeln der eigenen Existenz mit System auszuroden. Aber all das war ein
Kinderspiel gegenüber dem, was zur Zeit im kommunistischen Polen geplant wird. Die polnische Architektur und Plastik ist bekanntlich seit ihren Anfängen stark von der deutschen und seit der Renaissancezeit auch von der italienischen Kunst beeinflußt worden. Die Kirchen von Czerwinsk, Koscielce, Plozk u. a., die aus dem 12. und 13. Jahrhundert stammen, verraten den Einfluß der deutschen romanischen Architektur. Die Erztüren des Gnesener Doms würden um 1127 in der berühmten Magdeburger Gießhütte angefertigt. Im 13. Jahrhundert war die Anlehnung an die Architektur der Zisterzienser in Polen spürbar. Vom 14. bis 16. Jahrhundert setzte sich im nördlichen Polen dann die Backsteingotik im Stil des Deutschen Ordens durch, während im südlichen Teil des Landes, besonders in Krakau, böhmische und süddeutsche Einflüsse führend waren. Aus Nürnberg kam Veit Stoß nach Krakau, wo er den berühmten Hauptaltar der Marienkirche schuf. Die Renaissancezeit brachte dann starke italienische Einflüsse zu den deutschen. Obwohl in der Barockepoche die Baukunst einen stärkeren polnischen Eigencharakter zu entwickeln beginnt, bleiben deutsche und italienische Einflüsse auch jetzt spürbar. So war es nun einmal, so darf es aber nach der Ideologie der neuen Herren in Warschau nie gewesen sein. Die Lösung ist einfach. So einfach, daß auch der abgebrühte Nachrichtenempfänger aus dem europäischen Osten auf horchen muß. Die Spitzhacke beginnt im Land an der Weichsel ein schauriges Werk. Ein „Großbauprogramm“ sieht nämlich den Abbruch von 67 8 8 Barock- und Renaissancebauten vor, die später durch „volksdemokratische Monumentalbauten“ im sowjetischen Baustil ersetzt werden sollen. In den Kostenvoranschlägen für dieses unwahrscheinliche Programm wird die Summe von 20 Milliarden Zloty genannt. Polen hat in seiner langen leidvollen Geschichte zwischen West und Ost schon vieles durchlitten und überdauert. Allein in unseren Tagen und nach solchen Tatarennachrichten gehört schon ein Berge versetzender Glaube dazu, in das alte „Noch ist Polen nicht verloren“ einzustimmen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!