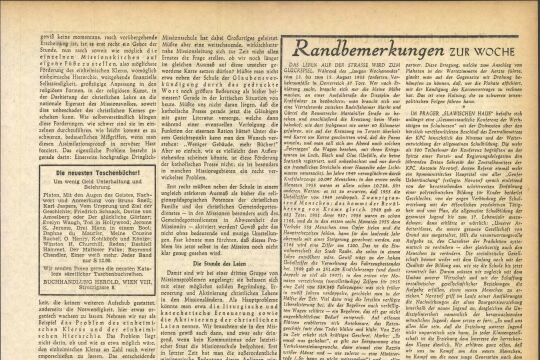Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
RANDBEMERKUNGEN ZUR WOCHE
VOLKSPARTEI UND INDUSTRIE. Das war der Titel eines Leitaufsafzes der „Furche” in Nummer 31 vom 1. August. Sein Verfasser sprach deutliche Worte von der Malaise, die sich in die Beziehungen zwischen Volkspartei und Industrie in den letzten Monaten eingeschlichen habe. Wenn es eines Kommentars zu jenen Ausführungen bedurft hätte, nun, der nicht gerade alltägliche Angriff des Organs der „Vereinigung österreichischer Industrieller”, „Die Industrie”, gegen das OeVP-Generalsekrefariaf wie die prompte scharfe Replik desselben haben ihn geliefert. Noch ist es Sommer. Noch geht so ein Duell, das zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise eine innerpolitische Sensation gewesen wäre, in der das politische Interesse nicht gerade fördernden Hitze und allgemeinen Ferienstimmung unter. Aber bald schreiben wir Herbst. Der politische Alltag fordert dann wieder sein Recht. Unser Leitartikler hatte nur zu recht, wenn er schrieb: „Es ist hoch an der Zeit, daß sich in den Beziehungen zwischen OeVP und Industrie etwas ändert, ehe die Malaise, die sich eingeschlichen hat, zum Malheur wird.”
UM DAS VERSTÄNDNIS DER MITBÜRGER. Landwirtschaftsminisfer Dipl.-Ing. Hartmann beschäftigte sich in drei Reden, die er in der vergangenen Woche vor verschiedenen Gremien der Landwirtschaft in Klagenfurt gehalten hat, nicht zum erstenmal mit dem eigentlichen wunden Punkt im Verhältnis zwischen den Bauern und den übrigen Bürgern. In einem modernen Staat mit hochentwickelter Industrie wie Oesterreich gerät die Bauernschaft in die Gefahr der Isolierung. Die Bauernschaft fühle sich diskriminiert, wenn sie zur Kenntnis nehmen muf;, daß das Volkseinkommen im landwirtschaftlichen Sektor seit. 1951 bloß um 40 Prozent gestiegen ist, im Gegensatz zu 87 Prozent der Gesamtwirtschaft in derselben Zeitspanne. Minister Hartmann gab gerne zu, daß die Aufwärtsentwicklung der Landwirtschaft ohne die Entwicklung vom Agrarstaaf zum Industriestaat, wie sie in den letzten Jahrzehnten in Oesterreich vor sich ging, nie möglich gewesen wäre. Die österreichische Agrarpolitik sei jedoch in immer zunehmendem Maße belastet mit der Erhaltung und Sicherung der Existenz der kleinen und mittleren Familienbetriebe im Berg- und Flachland, die mit 86 Prozent die weitaus überwiegende Mehrzahl aller bäuerlichen Betriebe in Oesterreich stellen. Die Bauern wollen, daß das Sozialgefälle zwischen dem agrarischen und nichfagrarischen Volksfeil gehoben wird. Sie sind keine Anhänger der Zwangswirtschaft oder des Kollektivismus, sondern befürworten eine vernünftige Marktordnung. „Je enger aber die Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen im gesamten Wirtschaffsorganismus sind, desto wichtiger ist es, daß sie zusammen — und nicht gegeneinander wirken und daß ein Teil den Problemen des anderen das nötige Verständnis entgegenbringt.’ Um dieses gegenseitige Verständnis geht es der österreichischen Agrarpolitik heute mehr als je. Die WetferkataSfrophen dieses Sommers, die schweren Schäden, welche die Landwirtschaft auch heuer wieder erlitten hat, waren für den neuen Landwirfschaffsminisfer ein Anlaß mehr, als Anwalt dieser Politik gerade jetzt, in der „Urlaubssaison” der bloß um gutes Badewetter Besorgten, vor die Oeffenflichkeif zu freien.
FALSCHE SCHWURE. In unserem weiß-blauen Nachbarland hat es, wie man dort zu sagen pflegt, „gschnackelf”. Der bayrische Spielbankprozeß ist zu Ende. Alle fünf des Meineids Angeklagten wurden schuldiggesprochen und zu Strafen zwischen 15 und 33 Monafen verurteilt. Die in Sachen des Sfaates vorsätzlich falsch erhobenen Schwurfinger gehörten aber nicht etwa zu in einen Raufhandel verwickelten Bauernburschen, sondern zu den rechten Händen des weiland stellvertretenden Ministerpräsidenten, des weiland Innenministers und zweier Volksvertreter. Der fünfte war „Zivilist”. Sie haben also damit, ihr Amt gering-, den eigenen Profit hochschäfzend, Land und Volk, CSU und Bayernparfei einen äußerst schlechten Dienst erwiesen. Das Haupfärgernis an der Spielbankaffäre war aber, wie die „Süddeutsche Zeitung” in einem glänzenden Leitartikel schrieb, das: „Kleine Leute, in hohe Aemter gekommen, sitzen einem schlitzohrigen, skrupellosen Halbseidenen namens Freisehner auf, lassen sich reihum kaufen und können nur schlottern, wenn sie vor Gericht geladen werden, ob nun als Angeklagte oder als Zeugen.” Die borstige Reaktion der Bayern, die den Jusfizpalast in München umlagerten, spannte sich vom „Des is no vui zuwenig” bis zum „Recht geschieht’s eahna”. Ein des Weges kommender Ordensmann sagte dem fragenden Reporter: „Ich bin befangen. Ich möchte dazu nicht aussagen.” Und damit hatte er, der mehr weiß als die anderen, unbewußt an die ganze Problematik des Eides vor Gericht gerührt, da ja, wie kriminalistische Fachleute schätzen, ungefähr 90 Prozent aller begangenen Meineide unaufgedeckt bleiben.
GUTE NACHRICHTEN AUS ALBION. Die Nachricht von dem bevorstehenden Familienglück im Hause Windsor, die in diesen hochsommerlichen Tagen in den nach „Aufmachern” lechzenden Redaktionen der Boulevardpresse ein- getroffen ist, hat diese zunächst von ihren größten Sorgen befreit. Die schöne Zeit des täglichen Rätselratens um die Zukunft der kapriziösen, aber unentschlossenen Soraya ist schon lange vorbei. Auch Prinzessin Margaret gab ihren Anhängern zunächst keine neue Gelegenheit mehr, mit bangem Herzen um ihr Schicksal zu sorgen, Das belgische Prinzenpaar entzieht sich derzeit den neugierigen Blicken. Während ihres Besuches in Kanada wurde also neuerlich Königin Elizabeth „unter die Lupe genommen”, und schon schwätzten die Besserwisser, dank dei vielenorts beheimateten Sitte des Abschreibens, selbst in den entlegensten Provinzblätfern vor Krankheit und Familienzwist, bis das offizielle Kommunique in London alles zum Besserer wandte. Man weiß jetzt allerdings, was einem bevorstehf. Die intimen Details werden dem Leser einer gewissen Presse keineswegs vorenf- halten. Dem „Recht auf Information” wird diesmal im weitesten Sinne genüge getan. Man kann über diesen Drang nach Wissen um die Lebensäußerungen gekrönter Häupter gefeilter Meinung sein, ja, man kann sogar daraus gewisse politische Schlüsse ziehen. Die Art und Weise jedoch, wie diesem Wunsch seifens einer Publizistik, die gerne auf ihre (zweifellos bestehende) demokratische Funktion, ja Aufgabe pocht und immer und überall ernst genommen werden will, nachgekommen wird, ist auf jeden Fall von Uebel. Es soll also heißen; Englische Königsfamilie? Ja. Die Geschichten über sie? Nein, dreimal nein!
EIN VERGESSENER TRITT AB. In diesen Tagen wurde, auch im eigenen Land fast unbemerkt, der Träger eines vor Jahren noch gefürchteten Namens, Jozsef Rėvai, in Budapest zu Grabe getragen. Der frühgealferfe, schwer herzkranke Mann war bis zur ersten Ministerpräsidenfen- schaft Imre Nagys im Jahre 1953 Minister für „Volkserziehung” in Ungarn, oberster Lenker und Herr von Presse und Propaganda, Ideologie und Kultur, und in dieser Eigenschaft, zusammen mit Räkosi und Gero, Mitglied eines obersten Triumvirats, das damals die ungarische Volksdemokratie regierte. Wie seine beiden Kollegen, entstammte auch Rėvai dem jüdischen Kleinbürgertum, war, nach wenig geglückten Versuchen auf literarischem Gebiet, ein Berufsrevolutionär mit scharfem Intellekt, einer, der sich in seinen Moskauer Jahren vor und während des zweiten Weltkrieges die Glaubenssätze und die Anwendungspraxis des Marxismus-Leninismus stalinistischer Prägung so zu eigen gemacht hat, wie fast kein zweiter von seinen Genossen. So wurde Rėvai der beste Schüler Schdanows und Wegbereiter des „sozialistischen Realismus” in Ungarns Kunst und Literatur. Nach seiner Absetzung als Minister ist es um ihn, den damals schon Schwerkranken, still geworden. Er besann sich damals wieder seiner unglückseligen Liebe zur ungarischen Literatur, wurde auch wieder menschlich zugänglicher und fing an, nach der Rückkehr Räkosis an die unumschränkte Macht, diesen immer zynischer und verblendeter werdenden Diktator in den internen Parteigremien zu kritisieren. Nach der Revolution des Jahres 1956, die freilich nicht seine Sache sein konnte, erhob er noch einige Male die Stimme, um die Eklektiker und Opportunisten um Kadär an die noch verbliebenen Grundsätze der alten Lehre zu gemahnen. Eine Rolle in der Oeffentlichkeit spielte er jedoch nicht mehr. Mit ihm friti der letzte Ideologe des Marxismus- Leninismus von Format in Ungarn ab. Sein fast lautloses Verschwinden zeigt, wie sehr sich das Antlitz der kommunistischen Revolution in der „vorgelagerten Festung Ungarn” gewandelt hat.
DIE VÖLKER HÖREN MIT. Die nun beginnende nächste Phase der weltpolitischen Auseinandersetzungen, bisher von manchen gerne „Kalter Krieg” genannt, verspricht, friedlicher, aber nicht leichter zu werden. Es ist falsch, die bereits bevorstehenden Treffen auf „höchster Ebene” damit abwerten zu wollen, daß man sagt, Eisenhower und Chruschtschow können in ihren Gesprächen die unerhört komplizierten, miteinander in vielfältigem Zusammenhang stehenden Probleme gar nicht erst richtig definieren, geschweige denn irrt Handumdrehen lösen. Dies könne bloß Sache der Geheimdiplomafie sein. Wer so spricht, vergißt, daß in diesem Herbst in Washington, Moskau und wo immer noch die beiden Regierungschefs einander gegenüber- sfehen werden, Reporter und Kameraleute jedes Wort, jede Geste, jedes Lächeln oder jeden unfreundlichen Blick registrieren und, ins Immense vergrößert, in alle Welt weiterleiten werden. Die ersten Meldungen geben bereits heute einen Vorgeschmack von den kommenden Ereignissen. So liest man, daß- Chruschtschow amerikanische Fabriken und Farmen besuchen wird und daß Arbeiter-, ja Rentnerfamilien in der Sowjetunion dem Wunsch Ausdruck geben, Eisenhower ihre Wohnungen zeigen zu können. Man soll diese „propagandistischen Kniffe” nicht unterschätzen. Es gibt eben eine öffentliche Meinung als wichtigen Faktor der Politik, sowohl im Westen als auch im Osten. Das weiß Chruschtschow, und das wissen, wie die letzten Wochen besonders eindringlich zeigen, auch die Amerikaner. Und wenn die letzten Schritte als „Flucht in die Oeffenflichkeif” gewertet wurden, dann aus gutem Grund: denn so besteht die Möglichkeit, die „heißen Eisen” erst einmal abzukühlen, und das scheint auf jeden Fall vernünftig.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!