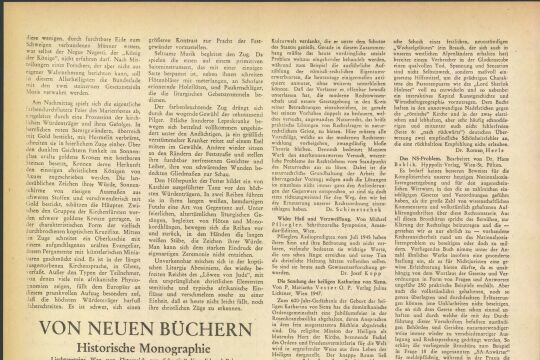Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
REVUE IM AUSLAND
In den englischen Zeitschriften nimmt das sich immer mehr zuspitzende Palästinaproblem in Artikeln und Zuschriften einen breiten Raum ein. So widmet die Wochenzeitschrift „The Tablet" in ihrer Nummer vom 21. Februar der „Entwicklung in Palästina" und der ,.Z u- kunft von Jerusalem“ zwei redaktionelle Artikel, wobei sie in beiden Fällen, einmal für ganz Palästina, dann aber besonders für Jerusalem und die heiligen Stätten, auf die „tragische Wahrheit“ hinweist, daß
„aller Wahrscheinlichkeit nach dem Abzug der britischen Truppen im Mai ausgedehnte und mörderische Kämpfe folgen werden, deren Hauptopfer die jüdischen Siedler sein dürften. Hier hat sich eine bemerkenswerte Veränderung vollzogen, und jene zionistischen Juden, deren einziges Ziel es so lange war, Großbritannien zur Aufgabe des Mandats zu zwingen, sind nun in wachsendem Ausmaß und mit Recht alarmiert durch die Aussichten, die sich ihnen für die Zeit nach dem Abzug der Briten eröffnen. Ihre Beweisführung geht dahin, daß die Gefahr für sie tatsächlich ständig wächst, solange sie sich nicht bewaffnen dürfen, während Waffen ungehindert in die benachbarten arabischen Staaten eingeführt werden.“
Die Annahme aber, daß eine volle Bewaffnung der Juden die Araber zum Hinnehmen der Teilung und des jüdischen Staates bewegen würde, bezeichnet das englische Blatt als eine jener Illusionen, die sich immer wieder aus der verhängnisvollen Unterschätzung der Araber durch die Juden ergäben. Eine Lösung des Palästinaproblems könne nicht durch eine Teilung erfolgen, sondern nur durch die Schaffung eines Staates unter internationaler Garantie, der die Rechte der Juden und der Araber gewährleiste, zugleich aber auch die durch die angeblich christlichen Großmächte viel zu wenig beachteten Rechte der Christen, die den beiden anderen die Möglichkeit eröffnen, „die Araber-Juden-Rivalität in einen weiteren Rahmen unter internationale Verwaltung zu stellen“.
Die Konstituierung von Jerusalem als einem internationalen Gebiet nach dem Vorbild des Tangerstatuts — die einzige Möglichkeit, um den Ausbruch eines Blutbades in der Heiligen Stadt am Vorabend des Pfingstfestes zu verhindern —, könnte als erstes erreichbares Ziel der Palästinakommission schließlich der Ausgangspunkt für eine Lösung des gesamten Problems werden.
Die heuer ihr 75jähriges Bestandsjubiläum feiernde, in deutscher Sprache in Philadelphia erscheinende katholische Wochenschrift „Nordamerika“ bringt in ihrer Nummer vom 5. Februar Ausführungen von E. T. Reichenberger über den „H irtenbrief der tschechischen Bischof e“, die im Hinblick auf die inzwischen eingetretene Entwicklung in der Tschechoslowakei von besonderem Interesse sind. Pfarrer Reichenberger, der nach der Besetzung seiner Heimat durch das Hitlerregime in die Emigration ging und der in den vergangenen Jahren mit seinen mutigen Artikeln in der deutschsprachigen und katholischen Presse der neuen Welt seinen heimatlosen Landsleuten und zahllosen
Kriegsgefangenen ein großzügiger Helfer und moralischer Halt war, bezeichnet diesen über Ungerechtigkeit, sittliche Verwilderung und „geheimen, versteckten Kulturkampf“ klagenden Hirtenbrief als „lange überfällig", vermißt aber auch in diesem Dokument ein Wort der Liebe und Hirtensorge für die ehemaligen deutschen Diöze- sanen der Bischöfe.
„Es gibt aber keine Doppelmoral, wie wir hundcrtcmal betont haben: für Deutsche und für Tschechen; für Privatpersonen und für den Staat; für den Staat und für die Kirche. Wenn es erlaubt wait, deutsches Privateigentum zu rauben, warum sollten die Gangster, die man rief, jetzt vor tschechischem Eigentum halt- madien; wenn es recht war, das Eigentum der deutschen Kirchengemeinden zu rauben, warum sollte man jetzt nicht auch das der tschechischen Kirchen unter dem Titel ,Bodenreform' stehlen dürfen? Wer Grundsätze aufgibt, gibt sich selber und seine Rechte preis.“
Der Hirtenbrief widerlegte aber auch die, wie etwa noch im vergangenen Jahr vom Minister Msgr. Hala in Paris aufgestellte Behauptung von ddr außerordentlich starken Position der tschechischen Katholiken.
„Gebe Gott, es wäre anders, und die Tscheche! wäre ein Stützpunkt des Christentums in Osteuropa statt eine Festung des Bolschewismus. Man kann das Christentum nicht mit Chauvinismus retten, auch nicht mit Kompromissen mit dem Antichrist."
In der rechtsstehenden französischen Zeitschrift „E c r i t s de Paris, Revue des questions actuelles", die mit zahlreichen Artikeln und Dokumentationen eine systematische Kampagne zur Rehabilitierung von Marschall P 6 t a i n betreibt und in den kommenden Nummern fortzusetzen verspricht, behandelt in der Jännernummer Michel Dacier „Das deiriokrati- sche Paradoxon“.
„Dem Individuum gewisse geheiligte Grundrechte zusprechen, zugleich die Allmacht der Majorität anerkennen, das ist der doppelte Inhalt der Idee der Demokratie. Diese beiden Prinzipien, von denen staatsrechtlich das erste .Garantie der Menschenrechte', das zweite .Volkssouveränität' genannt wird, scheinen unvereinbar. Tatsächlich schließt die Unberührbarkeit der dem Menschen zugestandenen Schutzbestimmungen die unbegrenzte Macht des gesetzgebenden Volkes aus. Andererseits, wenn man, um diesem Widerspruch zu entgehen, eine der Komponenten des Konzepts verwirft, so endet man entweder bei der Anarchie, wobei man nur die Religion der .Menschenrechte' bewahrt, oder beim Despotismus, indem man die .Volkssouveränität' auf den Thron setzt.“
Nach eher eingehenden kritischen Darstellung der französischen Verfassungsentwicklung seit der großen Revolution, die eine Rückkehr zur Monarchie ebenso ausschließe wie die „subalterne Tyrannei einer einzigen Partei“, erhebt Dacier am Schluß die Forderung, durch verschiedene Sicherungen, wie eine zweite Kammer, ein mehr die Persönlichkeit als die Partei berücksich gendes Wahlrecht, sowie durch die Erweiterung der Rechte des Präsidenten demagogischen Auswüchsen der Volkssouveränität gewisse Schranken zu setzen.
Dieselbe Frage des Verhältnisses von Menschenrecht, Volkssouveränität and De mokratie behandelt der Abgeordnete und ehemalige Dekan der juridischen Fakultät in Algier, P. E. V i a r d, in einem Artikel „Betrachtungen über die Souveränität" in der der offenen Diskussion gewidmeten „R evue Politique et Parlamentair e" (Jänner-März). Er vertritt dabei die Ansicht,
„daß, wenn die Souveränität nicht mehr dieselben Grundlagen hat, wenn sie nicht mehr auf einem Monarchen, sondern auf einem Volk beruht, sie dennoch ihre Natur nicht verändert hat; sie bleibt eine absolute Souveränität, bedroht von denselben und gefährlichen Verirrungen und für die sich dieselben Probleme der Begrenzung und Kontrolle ergeben. Es scheint daher, daß sich zu einem gewissen Zeitpunkt kein Hindernis dem souveränen Akt auf der Ebene des öffentlichen Rechts entgegenstellen kann und daß nur auf der sittlichen Ebene Begrenzungen deir Souveränität bestehen können.“
Da auf die Dauer keine verfassungstechnische Maßnahme die Tyrannei der Majorität verhindern könne, käme cs auch hier, wie einst in der absoluten Monarchie, vor allem auf die moralische „Prinzenerziehung" an.
„Es ist die Ehre und zugleich die Gefahr der Demokratien, daß sie von jedem Bürger die Eigenschaften verlangen, die man von einem Monarchen fordert. Man sagt, daß in Rom einst jeder Senator die Aufgabe eines Königs hatte. Heute hat jeder Bürger in seinen Händen ein Teilchen der Souveränität. Er muß daher die Schmeicheleien der Höflinge, die Hirngespinste der theoretischen Phantasten vermeiden: vor allem aber muß er von seinen Delegierten und Dienern und im gegebenen Fall auch von sich selbst eine mit dem Sittengesetz m Einklang stehende Entscheidung verlangen ... Weil du Staatsbürger bist, bist du König, kann man jedem sagen; aber dann ist, im vergrößerten Maßstab der Erziehung eines Volkes, die moralische Erziehung des Fürsten notwendiger denn je.“
In der Jännernummer der englischen Literatur- und Kunstzeitschrift „H o r i- z o n“ veröffentlicht der bekannte Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell einen Essay „S ü n d e“ („Sin“), dessen abwegige Gedankengänge wohl zum Teil aus der Opposition gegen den das Denken der angelsächsischen Völker auch heute noch so tief beeinflussenden, strengen puritanischen Sündenbegriff zu verstehen sind. Russell — der übrigens vor einigen Wochen im „Dritten Programm“ des englischen Rundfunks eine vielbeachtete Diskussion über „Die Ecistenz Gottes“ mit dem Jesuitenpater Coplestone hielt — gebt in diesem Essay von der Erkenntnis aus, daß ein Gefühl für Sünde fast in jedem Menschen feststellbar sei. Aber er glaube nicht wie die meisten Psychologen, daß dieses Gefühl angeboren sei, sondern halte es für das Ergebnis einer bereits in frühester Jugend entstandenen Furcht vor Strafe und Vorwürfen durch eine anerkannte Autorität. Russell wiederholt hier eine schon von anderen aufgestellte These, immerhin erkennt er, daß der Begriff der Sünde unlöslich mit dem Glauben an ein göttliches Gesetz verbunden sei, während er zugleich die A n- nahmc der menschlichen Willensfreiheit voraussetze. Russell geht dann soweit, auch die letztere zu leugnen; bekennt, für ihn bedeutet auch „Gerechtigkeit" nur „Lohn und Strafe nach dem System, das am wahrscheinlichsten ein sozial wünschenswertes Verhalten fördert“. Für die Praxis schreckt er davor zurück, mit dem Begriff der „Sünde“ zugleich die Begriffe von „Gut“ und „Böse“ zu verwerfen. Der englische Philosoph verirrt sich dann in ein Gestrüpp strafrechtlicher Theorien, in denen er den R e c h t s positivismus bis ins Absurdum treibt:
„ .Gute' Taten sind die, welche man zweckmäßigerweise lobt, ,böse' Taten solche, die man zweckmäßigerweise (!) tadelt. Lob und Tadel bleiben als mächtige Antriebe, um ein Verhalten zu fördern, das dem allgemeinen Interesse dient. Auch Lohn und Strafe bleiben. Doch was die Strafe betrifft, so bringt die Ablehnung der .Sünde' einen Unterschied mit sich, der eine gewisse praktische Bedeutung hat, denn bei der Einstellung, die ich vertrete, ist Strafe per se immer ein Übel und ist nur gerechtfertigt durch ihre abschreckende Wirkung. Wenn es möglich wäre, das Publikum in der Überzeugung zu halten, daß Einbrecher eingesperrt werden, während sie in Wirklichkeit glücklich auf einer entlegenen Südseeinsel leben dürfen, so wäre das besser als Strafe; der einzige Einwand dagegen ist der, daß es früher oder später doch durchsickern und eine allgemeine Einbruchswelle zur Folge haben würde."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!