
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
So macht man Präsidenten
Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Journalist Theodor White hatte mit seinem Buch „The Making of The President 1960” eine Darstellung des Wahlkampfes, in dem John F. Kennedy sich ein kurzbefristetes Recht auf das Weiße Haus erkämpft hatte, gegeben. Dafür hatte er den vielbegehrten Pulitzer-Preds erhalten. Nun hat er sich an den Wahlkampf von 1964 gewagt. Jedoch erreicht sein neues Buch „The Making of The President 1964” nicht das Niveau des ersten. Möglicherweise hatte White von der Persönlichkeit Kennedys die magische Inspiration erhalten, die ihn über sich selbst hinauswachsen ließ. Trotzdem war auch das neue Buch monatelang ein Bestseller. Man muß White auf jeden Fall zugestehen, daß er in das bisher aus primitiver Schwarzweißmalerei bestehende Bild des Wahlkampfes die Zwischentöne hineinschraffierte.
Europäer mögen bezweifeln, daß White ihnen viel zu sagen hat. Sie interessieren sich für die außenpolitischen Folgen des Wahlergebnisses mehr als für seine innenpolitischen Vorbedingungen. Eine Erklärung des Verhaltens Mr. Johnsons in Vietnam und Santo Domingo wird man bei White allerdings nicht finden. Trotzdem ist das Buch auch für den aufschlußreich, der sich nicht auf amerikanische Fragen spezialisiert.
White meint, daß zwei Ereignisse den Ausgang des Wahlkampfes von Anfang an festlegten. Das eine war die Ermordung Kennedys. Sie entrückte diesen aus dem Bezirk der Männer mit einer Anlage zur Größe in das Reich der Giganten. Damit erhielt die Demokratische Partei einen Schutzheiligen, gegen den jeder Republikaner einen schweren Stand gehabt hätte. Das andere ist die Revolution der Neger, deren Beginn White mit 1960 ansetzt. Der ermordete Präsident und später sein Nachfolger bemühten sich, den Sturzbach der Revolution mit Gesetzen in ruhige Wässer abzuleiten. Barry Goldwater fehlte dafür Gespür und Befähigung.
White stellt jedoch heraus — dies muß gleich zugefügt werden —, daß der republikanische Kandidat alle Anstrengungen machte, damit nicht Funken des Wahlkampfes die Wut der Neger lichterloh anfachten. Er bewies das eindrücklich, als er die Vorführung des Filmes „Mütter für ein moralisches Amerika”, auf den seine Anhänger ihre letzten j -.ff- nungen gesetzt hatten, verbot. Der Film hätte Rassenkämpfe auslösen können. White führt andere Beispiele für Goldwaters Bemühungen, seine Anhänger zu zügeln, an. Allerdings gibt er dem Republikaner nicht Kredit für humanitäre Motive, sondern für wahlstrategische. Tatsächlich vermißt er Mitgefühl bei Goldwater in hohem Maße.
Jedoch wird Goldwater selbst dann keine ausschlaggebende politische Rolle mehr spielen, falls es ihm nächstes Jahr gelingen sollte, einen Sitz im Senat zurückzugewinnen. Es ist daher wichtiger, auf die Aspekte des Buches einzugehen, die auch für Nichtamerikaner bedeutsam sind, weil man aus ihnen die Richtung, die die Vereinigten Staaten einschlagen werden, deutlich ersehen kann.
Auswirkungen der Negerrevolution
In erster Linie handelt es sich hierbei um die Auswirkungen der Negerrevolution. White ist keineswegs von dem Fortschrittsglauben erfüllt, der darauf vertraut, daß alles sich zum besten wenden wird. Er fürchtet, daß der Verfall der farbigen Familie, den ihr Korrespondent in einem früheren Artikel erwähnt hat, hochbrisanten Sprengstoff in die amerikanische Gesellschaft trägt. Er könnte dadurch ausgelöst werden, daß die Neger im Begriff sind, in den hauptsächlichen Großstädten die Mehrheit zu erringen. „Bis 1990 … wird diese Entwicklung, falls sie nicht geändert wird, den Vereinigten Staaten eine Zivilisation geben, unter der sieben ihrer größten Städte … überwiegend von Negern bewohnt sein werden.” Die Ausnahmen werden New York, Los Angeles und Houston sein. Diese Entwicklung könnte vor allem durch eine Beendigung der panischen Flucht der Weißen in die Vorort gehemmt werden, was zum Verfall der Familie beiträgt. Dieser Verfall der Familie spült Neger- tühner herauf, die katilinarische Existenzen sind. Der Verfasser personifiziert den Konflikt zwischen den gemäßigten Führern, von denen viele, wie er zugibt, den besten Weißen durchaus ebenbürtig sind, und den radikalen, ih einer Kontrastierung von Robert Motes und Isiah Brunson.
Moses ist ein junger Mann aus New York. Als begabter Mathematiker hatte er eine gute Stellung, die er aufgab, und riskierte totgeschlagen zu werden, um in Mississippi der lilienweißen regulären demokratischen Parteiorganisation eine rassisch integrierte — die sogenannte Mississippi-Freiheitspartei — gegenüberzustellen. Mit Mut, Geduld und Zähigkeit rang er der nationalen Parteiführung das Zugeständnis ab, bei der Parteikonvention 1964 zwei Delegierte seiner Gruppe zu plazieren. Brunson ist ein Zweiundzwan- zigjähriger, mit mangelnder Schulbildung, der vor dam Terror seines Staates, Südkarolina, nach New York geflohen war, um dort Aufruhr zu entfachen. In einem Interview sagte er White: „Wenn tausend Unschuldige dabei ums Leben kommen, muß es eben geschehen.”
Wie damals in Weimar…
Auch die Straßendemonstrationen ängstigen den Verfasser. Er sieht Ähnlichkeiten mit der Republik von Weimar. Wie dort beginnen hier Gegendemonstrationen: „… — darnach kann das geheiligte Recht zur friedlichen Versammlung in die gefährlichste Bedrohung einer geordneten Regierung verzerrt werden, und das größte Bürgerrecht von allen, der Innere Frieden, zerstört werden.”
Es ist nicht uninteressant, daß White der Ansicht ist, die Führerschicht, die die Trägerin der Macht ist (power elite nennt man das hierzulande), hätte eine kontrollierte Integration auf dem Wohnungsmarkt angestrebt. Aber ihr entglitten die Zügel. Auf die Überflutung des Wohnungsmarktes durch die Farbigen kam es zu solchen Reaktionen wie dem Rumford-Gesetz in Kalifornien, das versucht, die Tore des Schwarzen Ghettos zuzuhalten. Damit hat sich der Rassenkonflikt verschärft.
Whites zweite Beobachtung, die über die Grenzen des Landes Interesse verdient, bezieht sich auf den Verfall der Republikanischen Partei. Bis zur Aufstellung Eisenhowers war New York das Machtzentrum, wenn auch nicht mehr des Landes, so doch der Republikanischen Partei. Im Sommer 1964 bildeten sich die traditionellen Republikanischen Königmacher ein, sie könnten mit Gouverneur Scranton das wiederholen, was ihnen 1940 mit Wendell Willkie so brillant geglückt war, nämlich die Partei in Reih und Glied hinter einen Führer zu formieren. Einer der Beteiligten gestand hinterher ein: „Es war unglaublich. Wir riefen alle die alten Namen an. Aber sie waren entweder nicht mehr vorhanden, oder nicht mehr in der Politik. Es war, als ob die Goldwater-Leute die Telephonzentrale der Partei verlegt hätten, und unsere Nummern waren alle tot. Dewey fehlte daraufhin zum erstenmal seit 28 Jahren bei einer Konvention der Partei.
Nur eine lose Verbindung
So wurde aus der „Großen Alten Partei” eine lose Verbindung von Gruppen, deren Schwergewicht sich vom Osten zum fernen Westen uritl Süden verlagert. Dabei ist der letztere eine Sackgasse für die Partei, angesichts der zunehmenden Registrierung der farbigen Wähler. Bei den letzten Wahlen erhielt Johnson überall mindestens 95 Prozent ihrer Stimmen, in manchen großstädtischen Bezirken sogar beinahe 99 Prozent. Unter diesen Umständen nimmt es nicht wunder, daß sogar die Republikaner wenig Hoffnung für die nahe Zukunft hegen.
Whites dritte Beobachtung bezieht sich auf Lyndon Johnson. Es muß vorausgescbickt werden, daß er mit gutem Willen für die Politiker überfließt. Er will bei dem Präsidenten eine erstaunliche Metamorphose, von dem Manipulator zu dem zweckbestimmten Staatsmann, wahmehmen. „Die Politik der Mittel war eine, die er als Senatsbaron ebensogut wie irgend ein anderer gelernt hatte — in ihrer ganzen Erbärmlichkeit, ihrem Schmutz und der endgültigen Immoralität, mit der erhabene Ideen im Senat durchwegs kompromittiert werden, um die allgemeine ÜbereinStimmung zu erzielen, der ein Gesetz entspringt. Aus diesem trüben Hintergrund der Mittel und der Werkzeuge war 1960 ein Mann emporgekommen, der als Vizepräsident nützlich erschien; 1964 stieg ein Präsident auf, der zwar die Politik der Mittel kannte, aber sich noch an die Träume erinnerte, die ihn als hungernden jungen Mann bewegt hatten.” Im Schlußabsatz des Buches wird White schließlich von seiner Bewunderung für Lyndon Johnson zu dieser Bemerkung hingerissen:
„Das hervorstechende Paradox von 1964 war, daß die Amerikaner den Präsidenten gewählt hatten, für den die Politik eine Leidenschaft darstellte, wie für keinen anderen. Er schlug vor, aus der Präsidentschaft, falls möglich, ein unpolitisches Amt zu machen, und bereitete, falls er damit Erfolg hatte, allen den unbekannten jüngeren Führern der Zukunft, die auch 1964 gewählt wurden, den Boden.”
Diese Bemerkung erscheint utopisch. In einer vorübergehenden Situation, wie der gegenwärtigen — die es in der amerikanischen Geschichte mehrmals gegeben hat — in der eine bedeutsame Opposition fehlt, ist eine unpolitische Präsidentschaft möglich. Wie soll sie aber durchgeftihrt werden, wenn das Zweiparteiensystem wieder funktioniert? Sollte sich aber diesmal kein neues Zweiparteiensystem herausbilden, wird sich das Gesicht der amerikanischen Demokratie in einer Weise verändern, wie White es sich anscheinend nicht vorstellen kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!







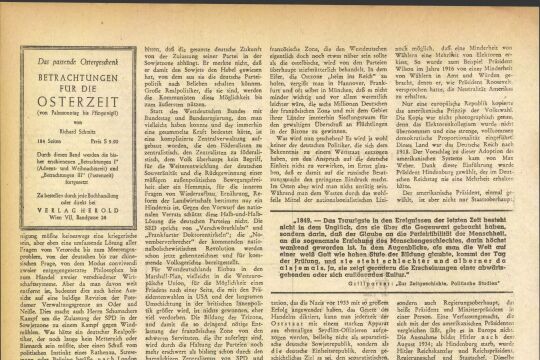






























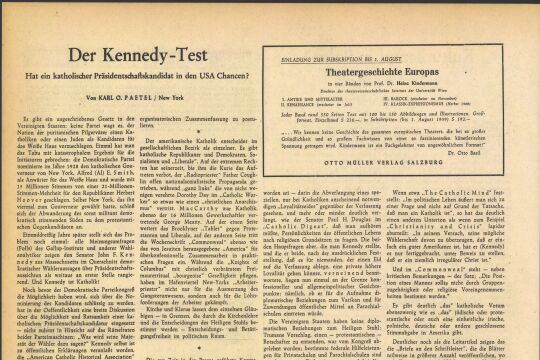
























.jpg)



































