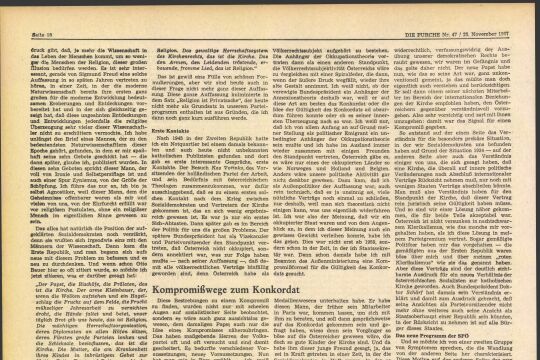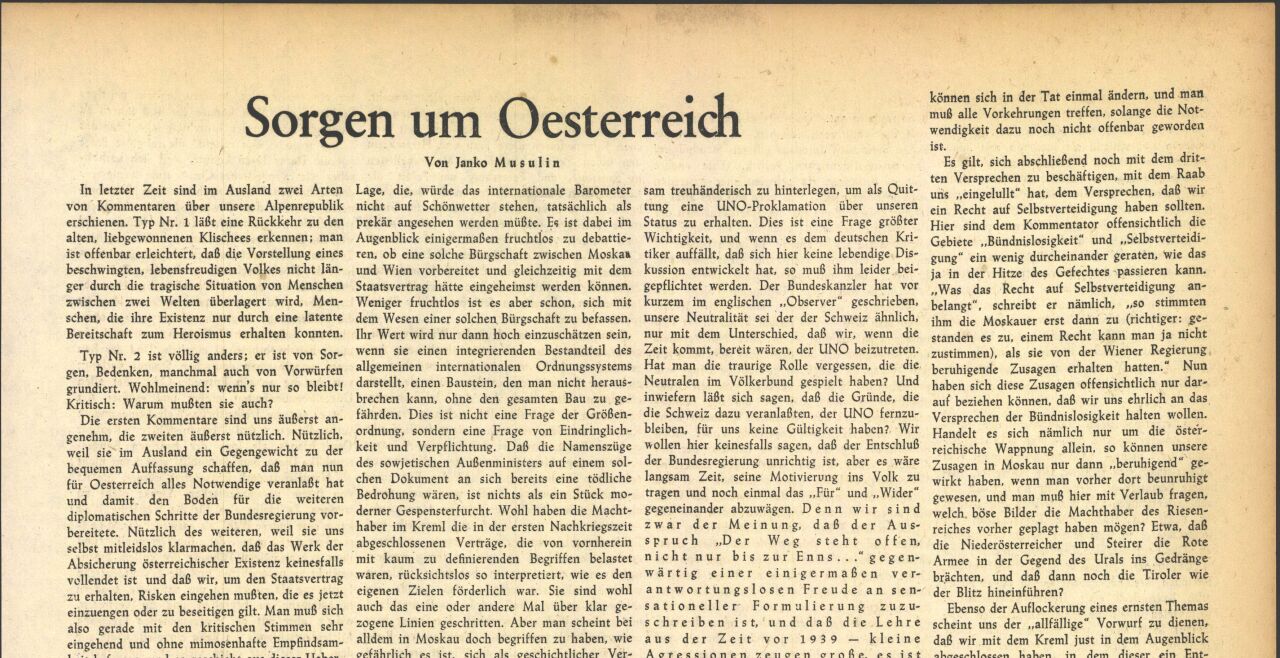
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sorgen um Oesterreich
In letzter Zeit sind im Ausland zwei Arten von Kommentaren über unsere Alpenrepublik erschienen. Typ Nr. 1 läßt eine Rückkehr zu den alten, liebgewonnenen Klischees erkennen; man ist offenbar erleichtert, daß die Vorstellung eines beschwingten, lebensfreudigen Volkes nicht länger durch die tragische Situation von Menschen zwischen zwei Welten überlagert wird, Menschen, die ihre Existenz nur durch eine latente Bereitschaft zum Heroismus erhalten konnten.
Typ Nr. 2 ist völlig anders; er ist von Sorgen, Bedenken, manchmal auch von Vorwürfen grundiert. Wohlmeinend: wenn's nur so bleibt! Kritisch: Warum mußten sie auch?
Die ersten Kommentare sind uns äußerst angenehm, die zweiten äußerst nützlich. Nützlich, weil sie im Ausland ein Gegengewicht zu der bequemen Auffassung schaffen, daß man nun für Oesterreich alles Notwendige veranlaßt hat und damit den Boden für die weiteren diplomatischen Schritte der Bundesregierung vorbereitete. Nützlich des weiteren, weil sie uns selbst mitleidslos klarmachen, daß das Werk der Absicherung österreichischer Existenz keinesfalls vollendet ist und daß wir, um den Staatsvertrag zu erhalten, Risken eingehen mußten, die es jetzt einzuengen oder zu beseitigen gilt. Man muß sich also gerade mit den kritischen Stimmen sehr eingehend und ohne mimosenhafte Empfindsamkeit befassen, und es geschieht aus dieser Ueber-legung heraus, daß wir uns hier einem Kommentar zuwenden, den eine der angesehendsten und einflußreichsten deutschen Wochenzeitschriften vor kurzem unter dem Titel „Moskau fischt an der Donau“ veröffentlicht hat . Dort widmet man sich zunächst den drei Versprechungen, mit denen Bundeskanzler Raab uns vertröstet haben soll: daß wir neutral, und zwar aus freiem Willen neutral, sein sollen, daß wir Sicherheitsbürgschaften von den bisherigen Besatzungsmächten und schließlich das Recht auf Selbstverteidigung erhalten würden. Mit all dem ist es indes, dem Kommentar in diesem deutschen Blatt nach, Essig: „Daß die Sowjets den Oesterreichern erlaubten, sich erst nach dem Inkrafttreten des Staatsvertrages aus freien Stücken neutral zu erklären, war eine Spiegelfechterei für Kindergemüter. Oesterreichs Verpflichtung, bündnislos zti bleiben, war Moskaus Grundbedingung Von Anfang an. Zweitens: Aus den Sicherheitsbürgschaften wurde nichts, weil ja nicht nur Moskau, sondern auch Washington für die deutschen Zuschauer spielt und weil solche Bürgschaften überhaupt lebensgefährlich sind, wenn sich die Sowjets daran beteiligen. Was — drittens — das Recht auf Selbstverteidigung anbelangt, so stimmten ihm die Moskauer erst dann zu, als sie von der Wiener Regierung beruhigende Zusagen erhalten hatten.“ Trotzdem ist der Kommentator nicht dafür, mit der Regierung zu streng ins Gericht zu gehen. „Was man ihr allenfalls vorwerfen könnte“, meint er, „ist, daß sie sich zur Extratour mit dem Kreml just in dem Augenblick hergab, in welchem dieser ein Entspannungsmanöver brauchte.“ Hat man, durch diese Milde verleitet, ein wenig Mut gefaßt und vermeint, mit einer weltgeschichtlichen Rüge durchzurutschen, so wird man bald eines besseren belehrt. Wir wissen gar nicht, wie schlecht es um uns steht, hat man uns doch „den Staatsvertrag wie eine Wollhaube über Augen und Ohren gezogen“, so daß es keine öffentliche Diskussion gibt. Aber: „Der Weg steht offen, nicht nur bis zur Enns, denn jede Großmacht überlegt es sich zweimal, ehe sie sich ohne besondere Verpflichtung wegen eines kleinen Landes den Schrecknissen des Atomkrieges aussetzt.“
Wir möchten annehmen, daß der Leser bei dieser oder jener Stelle zornig Einspruch erheben wollte. Aber mit solchem Hochfahren ist uns nicht gedient, wir haben es hier mit einem ganzen Bündel von Argumenten zu tun, die uns vereinzelt auch anderswo begegnen und müssen uns daher gelassen und nüchtern mit ihnen auseinandersetzen. Der erste Einwand gegen die Politik der Bundesregierung ist leicht zu entkräften: Niemand dachte an Spiegelfechterei, als man übereinkam, die Neutralitätserklärung dem Staatsvertrag folgen zu lassen. Es war dies ganz einfach die korrekte Reihenfolge. Daß der grundsätzliche Entschluß schon vorher gefallen war, ist niemals geleugnet worden. Wer meint, hier von „Spiegelfechterei“ sprechen zu dürfen, könnte dieses Recht auch beispielsweise bei jeder Trauung für sich in Anspruch nehmen, sind doch die Brautleute meist schon vor dem letzten „Ja“ handelseins geworden.
Aber so geringfügig der erste Einwand erscheint, so rasch senkt sich auch die Waagschale unter dem Gewicht des zweiten: Wir haben in der Tat bis jetzt keine Sicherheitsgarantie erhalten und schweben daher in einer
Lage, die, würde das internationale Barometer nicht auf Schönwetter stehen, tatsächlich als prekär angesehen werden müßte. Es ist dabei im Augenblick einigermaßen fruchtlos zu debattieren, ob eine solche Bürgschaft zwischen Moska und Wien vorbereitet und gleichzeitig mit dem Staatsvertrag hätte eingeheimst werden können. Weniger fruchtlos ist es aber schon, sich mit dem Wesen einer solchen Bürgschaft zu befassen. Ihr Wert wird nur dann hoch einzuschätzen sein, wenn sie einen integrierenden Bestandteil des allgemeinen internationalen Ordnungssystems darstellt, einen Baustein, den man nicht herausbrechen kann, ohne den gesamten Bau zu gefährden. Dies ist nicht eine Frage der Größenordnung, sondern eine Frage von Eindringlichkeit und Verpflichtung. Daß die Namenszüge des sowjetischen Außenministers auf einem solchen Dokument an sich bereits eine tödliche Bedrohung wären, ist nichts als ein Stück moderner Gespensterfurcht. Wohl haben die Machthaber im Kreml die in der ersten Nachkriegszeit abgeschlossenen Verträge, die von vornherein mit kaum zu definierenden Begriffen belastet waren, rücksichtslos so interpretiert, wie es den eigenen Zielen förderlich war. Sie sind wohl auch das eine oder andere Mal über klar gezogene Linien geschritten. Aber man scheint bei alldem in Moskau doch begriffen zu haben, wie gefährlich es ist, sich als geschichtlicher Vertragskontrahent zu disqualifizieren und sieht heute sicherlich ein, wie leicht vertragslose Zeiten in friedenslose Zeiten übergehen. Es ist nicht nur das: Unsere staatliche Existenz basiert jetzt auf einem Vertragswerk, das die russische Unterschrift trägt; dieses Vertragswerk enthält vor allem österreichische Verpflichtungen. Würde unsere Lage gefährlicher werden, wenn sich ihm ein zweites zugesellt, das nun vor allem eine russische Verpflichtung enthalten würde?
Man wird hier vielleicht einwenden, daß es einigermaßen nutzlos ist, sich über eine Bürgschaft den Kopf zu zerbrechen, von der wir gar nicht wissen, ob wir sie überhaupt noch aushandeln können. Nun ist es aber so, daß zwei Wege offenzustehen scheinen, die uns, wenn vielleicht auch nicht die Bürgschaft, so doch die Sicherheit bringen können, die wir uns von einer solchen Garantie erhoffen. Wir können entweder der UNO beitreten, oder den Versuch machen, zwar nicht Mitglied zu werden, aber unsere Neutralität bei diesem Weltforum gleichsam treuhänderisch zu hinterlegen, um als Quittung eine UNO-Proklamation über unseren Status zu erhalten. Dies ist eine Frage größter Wichtigkeit, und wenn es dem deutschen Kritiker auffällt, daß sich hier keine lebendige Diskussion entwickelt hat, so muß ihm leider beigepflichtet werden. Der Bundeskanzler hat vor kurzem im englischen „Observer“ geschrieben, unsere Neutralität sei der der Schweiz ähnlich, nur mit dem Unterschied, daß wir, wenn die Zeit kommt, bereit wären, der UNO beizutreten. Hat man die traurige Rolle vergessen, die die Neutralen im Völkerbund gespielt haben? Und inwiefern läßt sich sagen, daß die Gründe, die die Schweiz dazu veranlaßten, der UNO fernzubleiben, für uns keine Gültigkeit haben? Wir wollen hier keinesfalls sagen, daß der Entschluß der Bundesregierung unrichtig ist, aber es wäre langsam Zeit, seine Motivierung ins Volk zu tragen und noch einmal das „Für“ und „Wider“ gegeneinander abzuwägen. Denn wir sind zwar der Meinung, daß der Ausspruch „Der Weg steht offen, nicht nur bis zur Enns...“gegenwärtig einer einigermaßen verantwortungslosen Freude an sensationeller Formulierung zuzuschreiben ist, und daß die Lehre aus der Zeit vor 1939 — kleine Agressionen zeugen große, es ist nutzlos, die Schwachen zu opfern, um die eigene Haut zu retten — den westlichen Staatsmännern heute nicht weniger ins Herz geschrieben ist als zur Zeit des Korea-Krieges, aber die Verhältnisse können sich in der Tat einmal ändern, und man muß alle Vorkehrungen treffen, solange die Notwendigkeit dazu noch nicht offenbar geworden ist.
Es gilt, sich abschließend noch mit dem dritten Versprechen zu beschäftigen, mit dem Raab uns „eingelullt“ hat, dem Versprechen, daß wir ein Recht auf Selbstverteidigung haben sollten. Hier sind dem Kommentator offensichtlich die Gebiete „Bündnislosigkeit“ und „Selbstverteidigung“ ein wenig durcheinander geraten, wie das ja in der Hitze des Gefechtes passieren kann. „Was das Recht auf Selbstverteidigung anbelangt“, schreibt er nämlich, „so stimmten ihm die Moskauer erst dann zu (richtiger: gestanden es zu, einem Recht kann man ja nicht zustimmen), als sie von der Wiener Regierung beruhigende Zusagen erhalten hatten.“ Nun haben sich diese Zusagen offensichtlich nur darauf beziehen können, daß wir uns ehrlich an das Versprechen der Bündnislosigkeit halten wollen. Handelt es sich nämlich nur um die österreichische Wappnung allein, so können unsere Zusagen in Moskau nur dann „beruhigend“ gewirkt haben, wenn man vorher dort beunruhigt gewesen, und man muß hier mit Verlaub fragen, welch böse Bilder die Machthaber des Riesenreiches vorher geplagt haben mögen? Etwa, daß die Niederösterreicher und Steirer die Rote Armee in der Gegend des Urals ins Gedränge brächten, und daß dann noch die Tiroler wie der Blitz hineinführen?
Ebenso der Auflockerung eines ernsten Themas scheint uns der „allfällige“ Vorwurf zu dienen, daß wir mit dem Kreml just in dem Augenblick abgeschlossen haben, in dem dieser ein Entspannungsmanöver brauchte. War dies nicht die einzige Chance? Und ist es nicht von altersher die Weisheit der Dompteure, den Bären dann zu Kunststücken zu veranlassen, wenn er freundlichen Mutes ist, nicht aber, wenn er einen ganz besonderen Ingrimm zeigt?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!