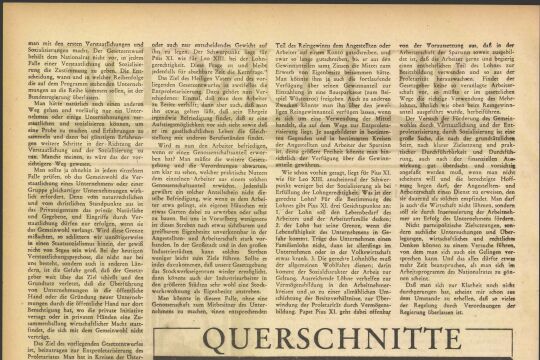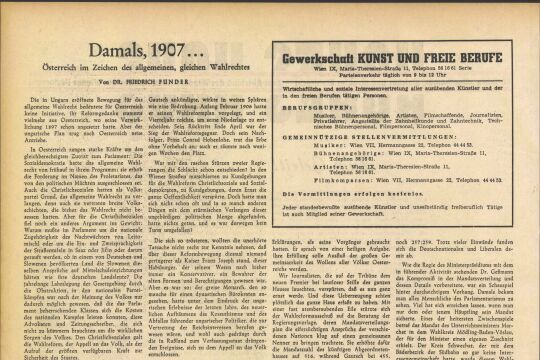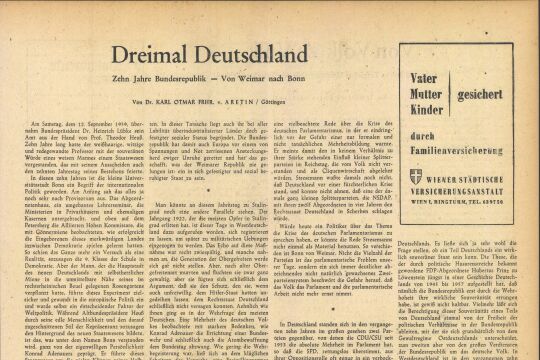Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
SPD und Bundeswehr
„Wenn die Sozialdemokratische Partei Deutschlands die bewaffnete Macht nicht vom Staate isolieren und sie auch nicht zu einem Instrument der herrschenden Partei werden lasten will, dann muß sie sich um ein engeres Verhältnis zur Bundeswehr bemühen.“ Mit diesen Worten wollte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Fritz Erler den Widerstand brechen, den die unteren Parteiorgane der Sozialdemokraten noch- immer einem engeren Kontakt zur Bundeswehr entgegensetzen. Die Stuttgarter Entschließung der SPD zu einer gemeinsamen Wehrpolitik kam etwa zu dem Zeitpunkt, da Bundes-' kanzler Adenauer in Wurzburg'der SPD mangelnde Vaterlandsliebe vorzuwerfen müssen glaubte.
Beides, die Vorbehalte gegenüber Waffe und Wehr und das Wort von der mangelnden Vaterlandsliebe der Sozialdemokraten, haben in der deutschen Vergangenheit bereits einmal eine tragische Rolle gespielt. Bis heute ist die SPD die Gefangene einer unrealistischen und unfruchtbaren Doktrin. Die Ressentiments der. Linken, das ideologisch verklammerte Unbehagen gegenüber der Streitmacht des Staates haben eine alte Geschichte; sie sind keineswegs etwa nur die Folge des marxistischen Geburtsfehlers der SPD, vielmehr ein echtes, seelisches Trauma. Ursprünglich hat es einen unbezweifelten Wehrwillen in der deutschen Arbeiterschaft gegeben, der im Erfurter Programm von 1891 seinen klaren Ausdruck in dem Postulat fand: „Erziehung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit.“ Die Forderung ging nach einem Volksheer, einer Miliz auf der Basis der als höchst demokratisch empfundenen allgemeinen Wehrpflicht. Einer der ältesten Führer der bayrischen Sozialdemokratie, der 1922 verstorbene Georg von Vollmar, einstiger Kürassier-Offizier, 1870 verwundet, hat nie aus seiner wehrwilligen Gesinnung ein Hehl gemacht. August Bebel, Sohn eines preußischen Unteroffiziers, die mächtigste Erscheinung der Partei und ihr herrischer Exerziermeister, hat eine ganze Generation von Proletariern für den Staat erzogen. Auf ihn ging der Pflichteifer und die strenge Disziplin der Funktionäre zurück. Noch in seiner letzten Reichstagsrede 1913 polterte er, falls Rußland angreife, werde er, „noch als alter Kerl die Knarre auf den Buckel nehmen“.
Seitdem 1814 gegen den erbitterten Widerstand der Junker die allgemeine Wehrpflicht in Preußen eingeführt worden war, war die Armee nach dem Ergänzungsprinzip ein „Volksheer“, der Heeresverfassung nach aber ein Instrument des die unumschränkte Kommandogewalt besitzenden Königs (und Kaisers) und demnach der alten bekämpften Gesellschaftsordnung. Der preußische Kriegsminister mußte ein Soldat, der dem Souverän durch den überkommenen Gehorsamsbegriff verbunden war, durfte aber kein dem Reichstag verantwortlicher Parlamentarier sein. Der Generalstab und die Kommandierenden Generäle in den Korpsbereichen waren unmittelbar nur dem Monarchen unterstellt. In dieser Sonderstellung zwischen monarchischer Staatsform und sich entwickelndem Parlamentarismus liegt die Wurzel für die Befangenheit, die die Haltung der Arbeitervertreter zur Bundeswehr bestimmt und ihre alten Unterdrückten-gefühle neu belebt.
Am stärksten hat sich der Konflikt Armee-Sozialdemokratie während der unglücklichen Sozialistengesetze ausgewirkt, die Bismarck 1878 gegen die erstarkende Arbeiterbewegung erlassen hatte. Sie blieben bis 1890 in Kraft und erreichten genau das Gegenteil. In diesen „heroischen Jahren“ verdreifachte sich die 'Zahl ,der Sozialdemokraten. Wehrpflichtige, die als Sozialdemokraten verdächtig waren, sollten durch die
Offiziere überwacht werden. Die zweifache Rolle, in die man die Subalternoffiziere drängte, Erzieher und Geheimpolizist zu sein, hat die Spannungen nur noch erhöht. Wie der Offizier zur bevorzugten Kaste zählte, als erster Stand im Staate galt, so wurde der Sozialdemokrat schlechthin zum Staatsfeind gestempelt. Während noch der kluge, äußerst humane Friedrich III., der 100-Tage-Kaiser, als Kronprinz die Berliner Arbeiterviertel durchstreift hat und auch in Friedrichshain vor dem Massengrab der Märzgefallenen von 1848, einem Heiligtum der Linksparteien, gestanden war, entwickelte sich unter seinem unausgeglichenen Sohn, Wilhelm IL, ein Zustand, den man ehrlicherweise als militaristisch bezeichnen mußte. Das heißt, militärische Prinzipien wurden zu einer allgemeingültigen Lebenshaltung. Törichte Reden des immer alles besser wissenden, gern forsch einher schmetternden jungen Kaisers vertieften noch die Kluft; 1903 kam aus kaiserlichem Munde das böse Wort von den „vaterlandslosen Gesellen“.
Freilich, das Offizierskorps war von einer oft ins Auge stechenden politischen Unwissenheit, die gar nicht der Tradition entsprach, denn Scharnhorsts, des großen Reformers, Ideal war der politisch gebildete, allerdings nicht politisierende Offizier. Leutnants von 19 Jahren befehligten dann im Krieg Familienväter und mancher Offizier erhielt die erste Vorlesung über die soziale Frage erst im Schützengraben durch seinen Burschen, der organisierter Sozial-
Gespräche unter Offizieren verpönt und noch 1917 mußte ein Heeresbefehl der Gruppe von' Mackensen tadelnd feststellen, daß die
Fragebogen für die Offiziersaspiranten noch immer die Frage „nach der politischen Gesinnung der Angehörigen des zu Befördernden“ enthalte.
Bei Kriegsausbruch 1914 sprach Wilhelm II. das große Wort: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.“ Und tatsächlich folgte die Arbeiterschaft ohne Widerspruch, ja mit heißem Herzen dem Ruf zu den Fahnen. In der Erklärung der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion bei Bewilligung der Kriegskredite findet sich der tief verwundetem Gefühl entsprungene Satz: „Wir lassen in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stich.“ Sicherlich hat es auch innerhalb der deutschen Arbeiterschaft einen echten Pazifismus gegeben, er wurde in den Augusttagen 1914 so wie in den anderen Ländern von der patriotischen Woge einfach weggespült.
Das Fronterleben, das gemeinsame Erlebnis bisher getrennt lebender Schichten fand in der Heimat keine gleichwertige gesetzesgeberische Tat. Den gleichen Millionen, von denen man mit Selbstverständlichkeit das Opfer des Lebens forderte, verweigerte man ebenso selbstverständlich das Wahlrecht. Die Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht stand noch 1917 in Preußen zur Debatte. Sie wurde vom Kaiser in Homburg mit einem klaren „Nein“ beantwortet. Ja, abgesehen von schüchternen Versuchen bei Kriegsbeginn fand es der Souverän des immerhin halbkonstitutionellen Reiches nicht für nötig, mit der stärksten oppositionellen Fraktion des Reichstages in Fühlung zu treten. Das war um so unverständlicher, als der Krieg, wie Bebel schon prophezeit hatte, ohne den sozialdemokratischen Feldsoldaten und Rüstungsarbeiter nicht hätte geführt werden können. An einen organischen Einbau der Opposition in den Staat war überhaupt nicht gedacht worden.
Die Sozialdemokratie hatte den republikanischen Staat von Anfang an angesteuert, aber, als die Stunde kam, war sie, wie der hellsichtige Friedrich Ebert sah, nicht einmal personell in der Lage, die maßgebenden Positionen zu besetzen. Man konnte daher witzeln, die Republik sei die Fortsetzung des Kaiserreiches mit anderen Mitteln. Die Beziehungen der Reichswehr zur Republik waren von vornherein belastet, weil das konservative Bürgertum und der Adel das neue republikanische Heer aufbauten und die allgemeine Wehrpflicht vom Friedensdiktat verboten wurde, damit aber der alte Traum eines sozialistischen Volksheeres für immer illusorisch gernacjvjt w,ur.de. Wgjl Eb,sr|, als Reichspräsident , und Noske als,Reichswehrminister (beide Sozialdemokraten) mit Reichswehrverbänden und Freikorps die Einheit des Landes retteten, bedachte man sie aus den eigenen Reihen mit blutrünstigen Beiworten. Die Reichswehr und die Arbeiterschaft sahen sich alle Jahre hindurch über einen Graben hinweg mit Mißtrauen an. Ihr Schöpfer, General von Seeckt, seiner Einstellung nach weder Demokrat noch Republikaner, sondern, wie viele seiner Kameraden, überzeugter Monarchist, erzog sie in Distanz zum Staat, bewahrte aber doch die Loyalität gegenüber dem Staat von Weimar. Immerhin ging, wa symptomatisch war, die in der Kaiserzeit einsetzende Verbürgerlichung zurück, 1912 waren 19,2 Prozent der Leutnants adeliger Herkunft, 1932 aber 27,9 Prozent. Das sichtbare Symbol des Andersseins war aber die schwarz-weißrote Kriegsflagge, die den Gegensatz zur schwarzrotgoldenen der Demokratie demonstrierte.
Auch der Staat und die Linksparteien bezogen nie ein klares Verhältnis zur eigenen Schutz-und Verteidigungsmacht. Es blieb • bei einem folgenschweren „Halbverhältnis“ zwischen Sozialdemokratie und Reichswehr. Ein eindeutiges Bekenntnis hätte vielerlei Ressentiments in den Offizierskasinos und im Funktionärskorps zunichte gemacht. Julius Leber, ehemals Leutnant und ausgezeichneter Stoßtruppführer, eine der markantesten Persönlichkeiten der SPD, mahnte am Magdeburger Parteitag 1929: „Die Spannung (zwischen der Arbeiterklasse und der Reichswehr) ist ein gewaltiger Passivposten der Republik, sie ist aber auch ein Passivsaldo der deutschen Sozialdemokratischen Partei.“ Fast 30 Jahre später ist der SPD-Wehrbeauftragte Fritz Erler zu der gleichen warnenden Erkenntnis gekommen, weil der noch immer durch die Erinnerung an den unseligen latenten Konflikt Heer—Arbeiterschaft belastete linke Flügel der Partei den Beschluß für bessere Beziehungen mißbilligt hat. Es wäre folgenschwer, wenn die unteren Parteiorganisationen nicht einsähen, daß die SPD heute zu den staatserhaltenden und nicht mehr zu den radikal staatsbekämpfenden Gruppen zählt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!