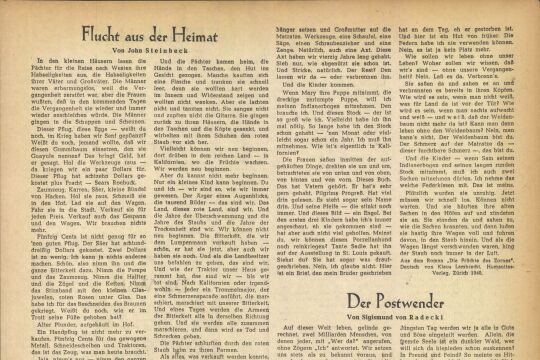Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Suranjan und seine Freunde
Unter Suranjans Freunden sind die Muslime in der Überzahl. Es ist allerdings nicht ganz korrekt, sie als Muslime zu bezeichnen, denn mit religiösen Dingen haben sie in der Regel nicht viel zu tun, und selbst wenn, so hindert sie das jedenfalls nicht daran, Suranjan als engen Freund zu betrachten.
Kamal etwa hat ihn vergangenes Jahr mit der ganzen Familie zu sich eingeladen. Auch die Hindus Pulak, Kajal, Asim und Jaybed gehören zu Suranjans Freunden, doch näher steht er Kamal, Haider, Relal oder Rabiul. Und wenn Suranjan in Schwierigkeiten war, haben ihm eher Haider, Belal und Kamal geholfen als Kajal und Asim.
Einmal muß Sudhamay nachts um halb zwei ins Suhrawardy-Krankenhaus eingeliefert werden. Dr. Haripada hatte gesagt: „Es is.t ein Herzinfarkt. Bring ihn sofort ins Krankenhaus.” Als Suranjan Kajal Bescheid sagte, meinte Kajal gähnend: „Wie willst du ihn denn so spät noch dorthin befördern? Warte bis morgen früh, dann können wir etwas unternehmen.” Belal dagegen war sofort mit dem Auto hergekommen.
Er übernahm selbst die Lauferei bei der Einweisung und sagte mehrmals zu Sudhamay: „Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Ka-kababu. Sehen Sie mich einfach als Ihren eigenen Sohn an.” Suranjan war verwirrt über die Hilfsbereitschaft. Solange Sudhamay im Krankenhaus war, erkundigte sich Belal nach seinem Zustand, ging die Ärzte in seinem Bekanntenkreis um Hilfe an, besuchte ihn, wann immer er Zeit fand und lieh der Familie das Auto für die Fahrten zum Krankenhaus. Menschen, die soviel für einen tun, sind rar. Obwohl Kajal reicher war, übernahm Rabiul fast vollständig die Kosten der Rehandlung. Plötzlich stand er vor ihm in ihrem Haus in Tikatuli und sagte: „Ich habe gehört, dein Vater ist im Krankenhaus?” Und noch bevor Suranjan antworten konnte, hatte er schon einen Umschlag auf den Tisch gelegt: „Du siehst deine Freunde zu sehr als Fremde.” So schnell er gekommen war, ging er auch, und als Suranjan den Umschlag öffnete, lagen da 5000 Taka auf dem Tisch.
Seine muslimischen Freunde mag er nicht nur wegen ihrer Hilfsbereitschaft, er ist ihnen verwandt in seinen Gefühlen und Denkweisen. Das Gefühl der Zugehörigkeit, das er bei Rabiul, Kamal und Haider empfindet, hat er bei Asim, Kajal und Jay-deb einfach nicht in dieser Stärke. Und nicht nur seine Männerfreundschaften trotzen den Grenzen der Religionszugehörigkeit - Suranjan glaubt nicht, daß er in seinem Leben jemals eine Archana, Dipti, Gita oder Sunanda so wird lieben können, wie er Parvin geliebt hat.
Suranjan hat niemals gelernt, Menschen nach ihrer Religionszugehörigkeit zu unterscheiden. In seiner Kindheit wußte er nicht einmal, daß er ein Hindu war. Als er zur Distriktschule in Mymensingh ging - es war wohl in der dritten oder vierten Klasse -, hatte er einen erbitterten Streit über einen bestimmten Unterrichtsstoff mit einem Jungen namens Khaled. Als sich der Streit zuspitzte, begann Khaled, ihn als Hundesohn, Schweinesohn, Bastard und ähnliches zu beschimpfen. Suranjan zahlte es ihm mit gleicher Münze zurück. Auf Khaleds „Schweinesohn!” antwortete Suranjan „Selber Schweinesohn”. Dann schrie Khaled: „Hindu!” . Suranjan schrie zurück: „Selber Hindu!” Er hielt Hindu für ein Schimpfwort wie Hundesohn oder Schweinesohn.
Erst als er älter wurde, verstand er, daß das Wort Hindu eine Religionsgruppe bezeichnet und er ein Mitglied dieser Religionsgruppe war. Als er alt genug war, um darüber nachzudenken, kam er zu dem Schluß, daß er zuallererst ein Angehöriger der Spezies Mensch sei und dann ein Bengale. Das Volk der Bengalen hat seinen Ursprung nicht in der Religion, und Suranjan betonte, daß die Bengalen keine.Unterschiede kannten und in Harmonie zusammenlebten. Immer wieder predigte er Freunden und der Familie, daß das Wort Bengale das genaue Gegenteil von Äuseinander-reißen bedeutet und daß die Bengalen jeden Versuch der Aufspaltung nach Religionszugehörigkeit zurückweisen müßten. Leider fanden Suranjans idealistische Vorstellungen kaum Anhänger. Die Menschen glaubten eher an die Verwandtschaft mit einem ausländischen Religionsgenossen als an die mit einem andersgläubigen Bengalen.
Heute ist der 8. Dezember. Das ganze Land streikt. Zum Streik aufgerufen hat die antifundamentalistische Bürgerbewegung Ghatak Dalal Nirmul, aber auch die größte fundamentalistische Partei, Jamaat-e Isla-mi, behauptet, sie habe aus Protest gegen die Zerstörung der Babri-Mo-schee zum Streik aufgerufen. Also Streik, denkt Suranjan, streckt sich und verläßt nach zwei Tagen sein Bett. Er will sich einmal draußen, umsehen. Seit zwei Tagen hat er seine geliebte Stadt nicht mehr gesehen. Im anderen Zimmer kauert sich Kiranmayi angsterfüllt zusammen. Suranjan kann nicht erraten, ob die Furcht auch Sudhamay erfaßt hat. Er weiß nur, daß er erklärt hat, sich diesmal nirgendwo verstecken zu wollen. Selbst wenn er sterben muß, ja, wenn die Muslime sie alle miteinander massakrieren, wird er sich nicht verkriechen. Das ist vielleicht nicht die weiseste Entscheidung, aber Suranjan ist wie sein Vater fest entschlossen, das Haus nicht aufzugeben. Maya ist auf eigene Verantwortung weggegangen, das ist ihre Sache. Mit ihrem starken Hang zum Leben hat sie bei Muslimen Zuflucht gesucht. Sie will ihr Leben unter die Obhut einer Parul Rifat stellen. Arme Maya!
Als sich Suranjan zum Ausgehen bereit macht, fragt ihn Kiranmayi erschrocken: „Wohin gehst du?”
„Ich will mal sehen, wie es in der Stadt aussieht und was mit dem Streik ist.”
„Geh nicht raus, Suro. Da kann wer weiß was passieren.”
Na und! Sterben müssen wir sowieso irgendwann. Sei nicht so furchtbar ängstlich. Eure Angst macht mich wütend”, sagt er, während er sein Haar scheitelt.
Kiranmayi zittert. Sie geht auf Suranjan zu und nimmt ihm den Kamm weg: „Hör mir zu, Suranjan. Sei nicht so leichtsinnig. Rei diesem Streik werden Läden demoliert und Tempel abgebrannt. Bleib hier! Du brauchst dir wirklich nicht anzusehen, wie es in der Stadt aussieht.”
Suranjan ist seit jeher ein unverbesserlicher Dickkopf. Warum sollte er diesmal auf sie hören? Er läßt sie einfach stehen. Im Vorderzimmer sitzt Sudhamay allein; auch er sieht sprachlos zu, wie Suranjan das Haus verläßt.
Draußen spürt Suranjan fast körperlich die beängstigende Menschenleere und geisterhafte Starre, die die Empfindung der erfrischenden Kühle des Nachmittags erdrückt. Nun bekommt er doch ein wenig Angst. Aber Suranjan hat sich nun einmal vorgenommen, sich in der Stadt umzusehen. Diesmal ist niemand gekommen, um seine Familie zu sich zu holen oder nach ihnen zu sehen, weder Belal noch Kamal oder irgend jemand anderes. Und wenn sie kämen, würde Suranjan jedenfalls nicht mitgehen. Ihm wird richtiggehend übel bei dem Gedanken, jedesmal, wenn es für ein paar Tage Ausschreitungen gibt, panisch den Hausrat von hier nach dort zu schaffen. Ein Idiot ist er gewesen, daß er vor zwei Jahren zu Kamal gegangen ist. Kommt er sie diesmal holen, so wird ihm Suranjan folgendes sagen: „Wie kann es angehen, daß ihr uns tötet und euch gleichzeitig unserer erbarmt? Tut euch lieber alle zusammen und macht folgendes: Laßt alle Hindus des Landes durch ein Erschießungskommando abknallen. Damit seid ihr eure Probleme los. Dann braucht ihr sie nicht zu töten und müßt euch auch nicht mehr dazu durchringen, sie zu retten.” Sowie Suranjan die Straße betreten hat, fangen ein paar herumstehende Jugendliche an zu rufen: „Packt den Hindu, holt ihn euch!”
Sie sind Jungen des Viertels, seit sieben Jahren sieht er sie regelmäßig, wenn er aus dem Haus geht. Er kennt auch einen oder zwei von ihnen, zum Beispiel Alam, der immer kommt, um Geld für ihren Jugendklub im Viertel zu sammeln. Suranjan singt auch auf ihren kulturellen Veranstaltungen, er wollte einigen von ihnen die Lieder von D. L. Roy und Hemanga Biswas beibringen. Immerfort Taufen sie mit mehr oder weniger triftigen Gründen bei ihm auf und nehmen ihn mit ihren Bitten: „Dada, helfen Sie mir bei diesem, Dada, bringen Sie mir das bei”, in Beschlag. Sudhamay behandelt sie schon lang kostenlos, weil sie Leute des Viertels sind. Und nun stehen sie da, beschimpfen ihn und strecken ihre geballten Fäuste ein seine Richtung.
Suranjan geht schnell in entgegengesetzter Richtung davon. Nicht die Angst treibt ihn, sondern die Scham. Er selbst schämt sich bei dem Gedanken, daß diese Jungen des Viertels ihn verprügeln wollen. Er verspürt Scham, und zwar nicht für die Prügel, die er einstecken soll, sondern für jene, die ihn verprügeln wollen. Die Scham gilt den Folterern, nicht den Opfern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!