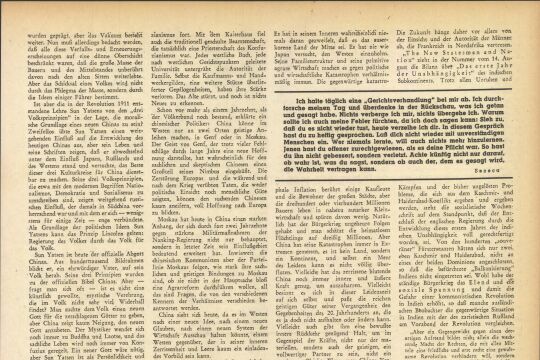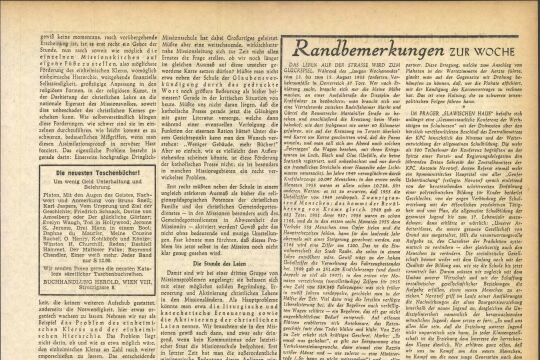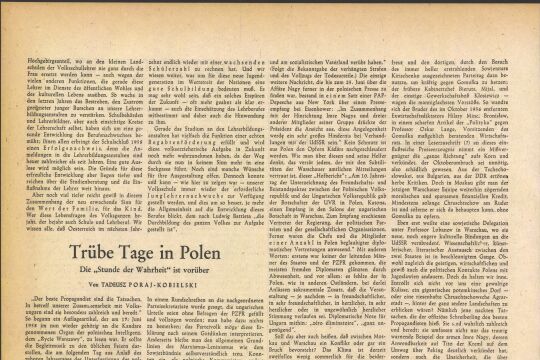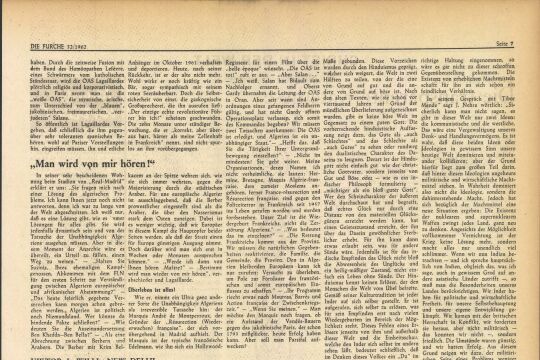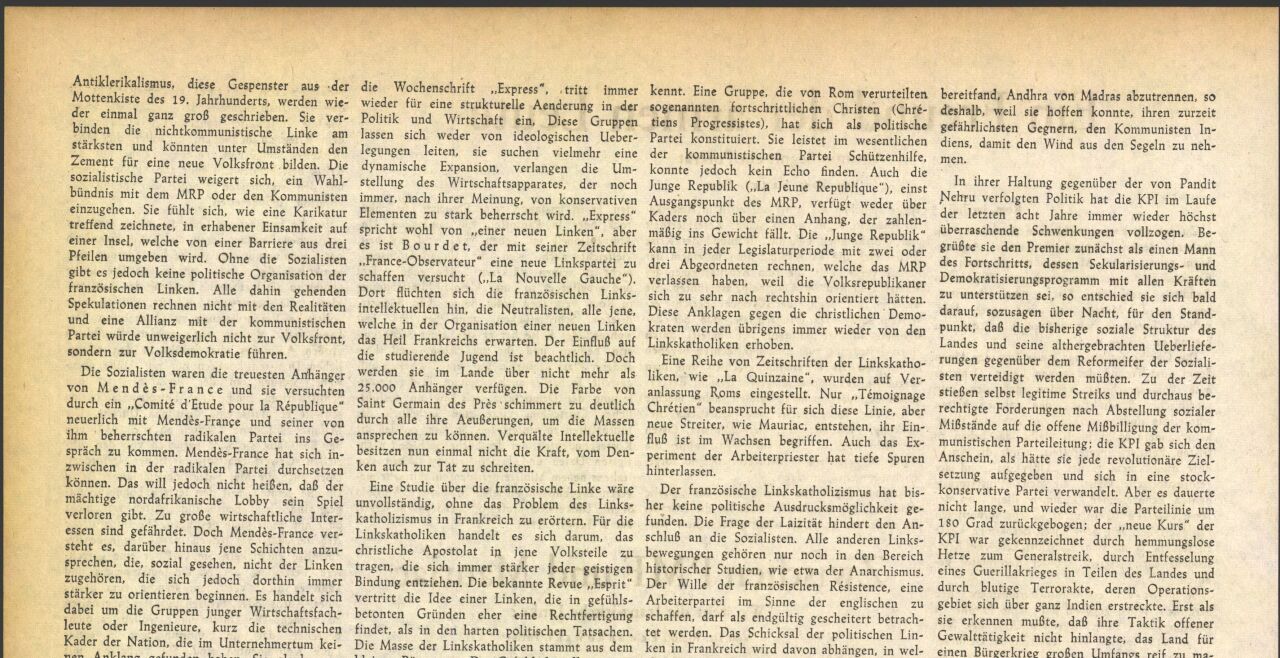
Am 18. Juli 1947 unterzeichnete König Georg VI. den heiß umstrittenen und schließlich vom Parlament zu Westminster gebilligten Plan Lord Louis Mountbattens für die Teilung des britisch-indischen Kaiserreichs. Formell war damit der Grundstein gelegt für die Errichtung der heutigen Republik Indien. Das eigentliche Fundament freilich, auf dem der Aufbau des neuen Staates vor sich gehen konnte und mußte, war eine Institution drawidischen Ursprungs, deren Anfänge sich in vorgeschichtlicher Zeit verlieren: die indische Dorfgemeinschaft. Im historischen Verlauf folgte eine Revolution der anderen; Dynastien kamen zur Macht und wurden gestürzt; Hindus, Afghanen, Mahrattas, Sikhs, Briten, lösten einander ab; aber die Dorfgemeinschaft hat alle Stürme überdauert, als eine selbstgenügsame, an der Umwelt weitgehend uninteressierte kleine Republik, obzwar ihr innerer Frieden immer wieder gebrochen wurde durch blutige kommunale Kämpfe, entsprungen aus religiösen und rassischen Gegensätzen. Auch heute noch lebt im Rahmen dieser dörflichen Einheiten, deren der indische Staat rund 400.000 umfaßt, die weit überwiegende Mehrheit, nahezu 87 Prozent, einer Bevölkerung, die sich jährlich um etwa dreieinhalb Millionen vermehrt und die Ziffer von 370 Millionen bereits überschritten hat.
Sehr begreiflich daher, daß die Regierung des selbständig gewordenen Indien ihre vordringlichste Aufgabe von Anfang an darin sah, die Existenzbedingungen auf dem flachen Land zu verbessern. Mehr als 44 Prozent der 22 Milliarden Rupien (rund 110 Milliarden Schilling), die für die Durchführung des 1951 in Angriff genommenen ersten Fünfjahresplanes veranschlagt worden waren, wurden diesem Zweck gewidmet. Die bisherigen Arbeitsfortschritte lassen erwarten, daß die im betreffenden Sektor des Planes festgesetzten Ziele programmgemäß im Laufe des nächsten Jahres erreicht sein werden. Das würde die vollendete Urbarmachung von 2,2 Millionen Hektar Dschungel und die Fertigstellung von Anlagen bedeuten, die das Ausmaß der bewässerbaren Bodenfläche in den an verheerender Trockenheit leidenden Gebieten um über vier Millionen Hektar vergrößern würde; und wei-. ter die Inbetriebsetzung des einen oder anderen der in Bau befindlichen gewaltigen hydroelektrischen Kraftwerke, die sowohl der Stromerzeugung wie der Speisung von Bewässerungskanälen dienen sollen. Auch wird bis dahin ein Ilmerziehungsunternehmen größten Stiles, dessen Zweck es ist, der ländlichen Bevölkerung in Fragen der Bodenbearbeitung und Bodenaus-nützung, der Drainage, Kanalisierung und Bewässerung, der allgemeinen Hygiene, der Kinder- und Krankenpflege, des Wohnungs- und Straßenbaues, und anderem mehr, mit Rat und Tat beizustehen, auf ungefähr 120.000 Dorfgemeinschaften ausgedehnt worden sein. Höchst beachtenswerte und in der Tat erstaunliche Leistungen, aber doch nur ein erster Anfang. So wird allein die Anlage des zusätzlich zwanzig Millionen Hektar umfassenden Bewässerungssystems, welches nötig ist, um das immer wiederkehrende Gespenst einer Hungerkatastrophe endgültig zu bannen, die angestrengte Arbeit von kaum weniger als zwanzig Jahren, nebst einem enormen Kapitalaufwand, erfordern.
Aber die schwierigsten Probleme Indiens liegen auf anderen Gebieten. Da ist vor allem das Analphabetentum, dessen Ueberwindung in den letzten fünfzig Jahren sehr geringe Fortschritte gemacht hat. Laut dem Zensus von 1901 waren damals 94,6 Prozent der Bevölkerung des Lesens und Schreibens unkundig und auch jetzt noch sind es über achtzig von hundert. Zwar besteht ein umfangreicher Plan für die Entwicklung des Schulwesens, doch bis er in die Tat umgesetzt sein kann, werden nach vorsichtiger Schätzung vierzig Jahre vergehen. Gegenwärtig jedenfalls ist die Lage so, daß etwa 60 Prozent aller Kinder zwischen sechs und elf Jahren zu keinerlei Schulunterricht gelangen. Anderseits steht das akademische Studium — Indien besitzt gegenwärtig dreißig Universitäten — auf einer hohen Stufe. Daß unter solchen Bedingungen die aus dem Westen eingeführten Formen der parlamentarischen Demokratie größtenteils eine bloße Fassade sind, hinter der sich die persönlichen Machtkämpfe berufsmäßiger Politiker abspielen, liegt auf der Hand.
Eng verknüpft mit dem Problem des Analphabetentums und eine teilweise Erklärung für dessen Hartnäckigkeit, aber politisch von noch weit größerer Tragweite, ist die Vielzahl der indischen Sprachen. Es gibt deren, Dialekte nicht mitgerechnet, 225, und manche von ihnen unterscheiden sich nicht nur so wie etwa das Englische vom Spanischen, sondern so wie englisch oder spanisch von arabisch oder persisch. Nach langen und heftigen Kontroversen wurde im Jahre 1949 vierzehn dieser Sprachen ein offizieller Status und damit die Gleichberechtigung zuerkannt; es waren dies Assami, Bengali, Gud-scherati, Hindi, Kanaresi, Kaschmiri, Malayalam, Mahrati, Oriya, Pundschabi, Sanskrit, Tamil, Telugu und Urdu. Zugleich wurde gesetzlich festgelegt, daß während einer Uebergangszeit von fünfzehn Jahren noch das Englische, nach Ablauf dieser Frist aber Hindi als allindische Amts- und Dienstsprache zu verwenden sei. Wie sich diese Regelung schließlich auswirken wird, ist noch nicht abzusehen, es erscheint aber zumindest zweifelhaft, daß sie dazu beitragen kann, bei den breiten Massen ein allindisches Nationalbewußtsein, welches ihnen heute noch durchaus fehlt, zur Entfaltung zu bringen. Gegen die englische Sprache bestand und besteht keinerlei Ablehnung; die große Menge kam auch unter dem britischen Regime kaum je mit ihr in Berührung und den Gebildeten bot ihre Kenntnis Vorteile, die anerkanntermaßen auch nach der Staatwerdung Indiens nicht geringer geworden sind. In diesen Kreisen wird die künftige privilegierte Stellung des Hindi, welches als Literatursprache weit verbreitet ist, kaum einen merklichen Widerspruch hervorrufen, aber in der Masse der Bevölkerung kann die Inkraftsetzung dieses Privilegs eine Reaktion auslösen, mit der verglichen der Sprachenkampf im alten Oesterreich als eine harmlose Spielerei erscheinen müßte. Schon das Vorgehen der telugu-sprachi-gen Minderheit in Madras, die nicht länger mit einer tamil-sprachigen Mehrheit unter einer Provinzialregierung zusammengefaßt sein wollte und die Schaffung ihrer eigenen Provinz, Andhra, forderte und erreichte, hat gezeigt, wie leicht auch in Indien aus einer sprachlichen Gemeinschaft eine Gemeinschaft im Sinne politisch-autonomistischer Bestrebungen werden kann.
Der Regierung in New Delhi hat der Entschluß, der Konstituierung dieser neuen Provinz zuzustimmen, Sorgen genug bereitet. Sie mußte sich sagen, daß die Aufteilung des Staatsgebietes und bestimmter gesetzgeberischer und verwaltungstechnischer Institutionen nach Sprachgruppen, dem im Falle Andhra gegebenen Muster entsprechend, den partikularistischen Tendenzen der einzelnen Völkerschaften einen mächtigen Auftrieb verleihen würde, und das war ein Gedanke, der ihrem sozialistischen und daher zentralistischen Konzept diametral zuwiderlief. Wenn sie sich trotzdem schließlich bereitfand, Andhra von Madras abzutrennen, so deshalb, weil sie hoffen konnte, ihren zurzeit gefährlichsten Gegnern, den Kommunisten Indiens, damit den Wind aus den Segeln zu nehmen.
In ihrer Haltung gegenüber der von Pandit Nehru verfolgten Politik hat die KPI im Laufe der letzten acht Jahre immer wieder höchst überraschende Schwenkungen vollzogen. Begrüßte sie den Premier zunächst als einen Mann des Fortschritts, dessen Sekularisierungs- und Demokratisierungsprogramm mit allen Kräften zu unterstützen sei, so entschied sie sich bald darauf, sozusagen über Nacht, für den Standpunkt, daß die bisherige soziale Struktur des Landes und seine althergebrachten Lieberlieferungen gegenüber dem Reformeifer der Sozialisten verteidigt werden müßten. Zu der Zeit stießen selbst legitime Streiks und durchaus berechtigte Forderungen nach Abstellung sozialer Mißstände auf die offene Mißbilligung der kommunistischen Parteileitung; die KPI gab sich den Anschein, als hätte Sie jede revolutionäre Zielsetzung aufgegeben und sich in eine stockkonservative Partei verwandelt. Aber es dauerte nicht lange, und wieder war die Parteilinie um 180 Grad zurückgebogen; der „neue Kurs“ der KPI war gekennzeichnet durch hemmungslose Hetze zum Generalstreik, durch Entfesselung eines Guerillakrieges in Teilen des Landes und durch blutige Terrorakte, deren Operationsgebiet sich über ganz Indien erstreckte. Erst als sie erkennen mußte, daß ihre Taktik offener Gewalttätigkeit nicht hinlangte, das Land für einen Bürgerkrieg großen Umfangs reif zu machen und damit das Sprungbrett für die Errichtung einer indisch-kommunistischen Diktatur zu gewinnen, kehrte die Partei nach schweren internen Auseinandersetzungen auf den Weg der Legalität zurück; was sie freilich nicht hinderte, ihre intensive Wühlarbeit — bezeichnenderweise vor allem in militärisch-strategisch wichtigen Grenzgebieten — mit allem Eifer fortzusetzen, noch auch darum, ihre regierungsfeindliche Propaganda weiter zu betreiben.
In letzterer Hinsicht allerdings hat sie mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen. Seitdem Jawarhalal Nehru in Moskau lieb Kind geworden ist, und solange er es bleibt, kann ihn die KPI nicht gut, ohne Verwirrung in ihren eigenen Reihen zu stiften, als verbrecherisches Ungeheuer bezeichnen, wie sie das früher zu tun pflegte. Sie spendet ihm vielmehr lautes Lob als dem Bannerträger „friedlicher Koexistenz“, indes sie emsig und mit nicht zu leugnendem Erfolg bemüht bleibt, die Grundlage ihres Anhangs unter den Massen, vor allem der Landarbeiter und Zwergbauern, zu erweitern und die Autorität der Zentralregierung zu untergraben; einerseits durch Schürung der Unzufriedenheit mit tatsächlich untragbaren sozialpolitischen Verhältnissen, anderseits durch die Propagierung partikularistischer Tendenzen unter den einzelnen Sprachgruppen. Zugleich arbeitet sie weiter daran, und auch hier mit sichtlichem Erfolg, die gesellschaftliche und intellektuelle Oberschicht zu infiltrieren. Die Teilnahme parteiungebundener Persönlichkeiten und sogar vieler ausgesprochener Gegner des Kommunismus am Allindischen Friedensrat, dem Indisch-Sowjetischen Kulturbund und anderen kommunistisch dirigierten Organisationen ist nicht eine der geringsten Früchte, die Indiens KP aus der Saat des Koexistenz-Schlagwortes geerntet hat.
Pandit Nehru ist sich der Gefahr, die seinem Lande seitens des Kommunismus droht, wohl bewußt. Daher sein Bemühen, sich durch die Art, wie er die selbstgewählte Rolle eines „Unparteiischen“ zwischen Ost und West durchführt, das Wohlwollen Moskaus zu sichern und damit, wie er glaubt, eine verläßliche Rückendeckung in seinem Kampf gegen den Vormarsch der indischen Kommunisten. Und daher auch die imperialistischen Allüren, wie sie, im Gegensatz zum proklamierten Prinzip friedlicher Koexistenz, in seiner Haltung gegenüber Pakistan, in der Frage Kaschmir, und namentlich gegenüber Portugal in Goa in Erscheinung getreten sind; sie sollen wohl ein allindisches Staats- und Nationalgefühl erwecken helfen und so zur Abwehr der kommunistischen Zersetzung beitragen. Aber die Chancen, daß diese Rechnung aufgeht, sind weniger als gering. Die Republik Indien wird erst dann zu einem konsolidierten Staat, geschweige denn zu einer Großmacht herangewachsen sein, und sie wird erst dann die Gefahr eines kommunistischen Umsturzes als gebannt betrachten dürfen, wenn das materielle und seelische Elend, an dem der überwiegende Teil ihrer Bevölkerung heute noch leidet, fühlbar gelindert ist. Hier liegt die Aufgabe, der die indische Staatsführung ihre ganze Kraft und ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zuwenden müßte.