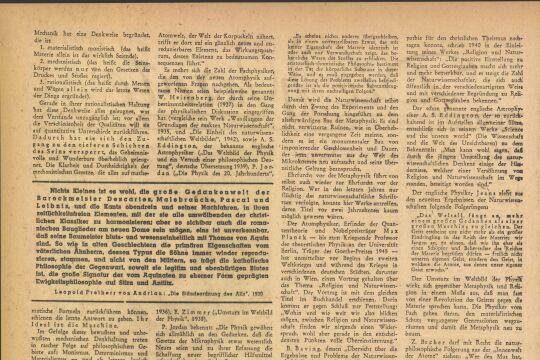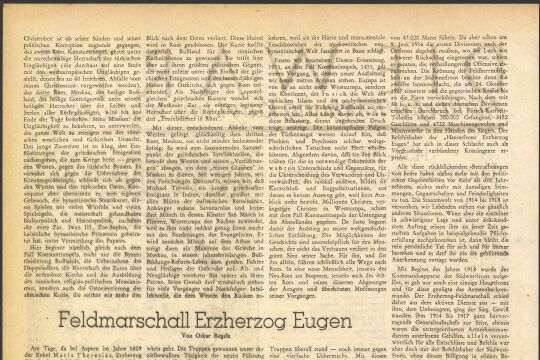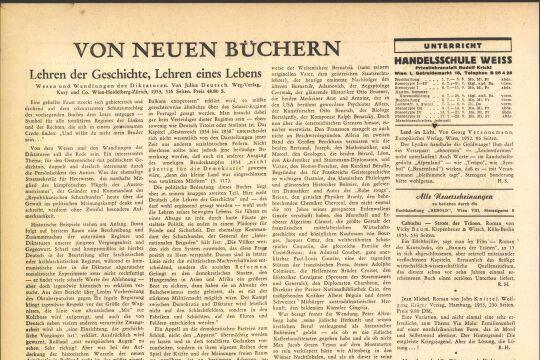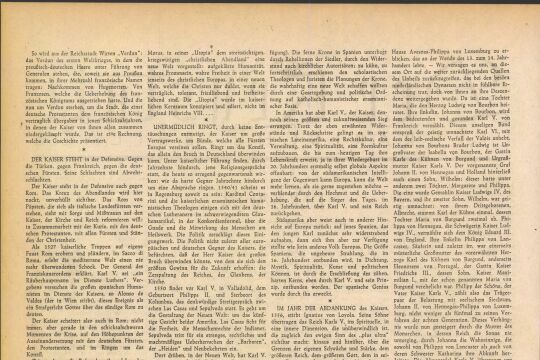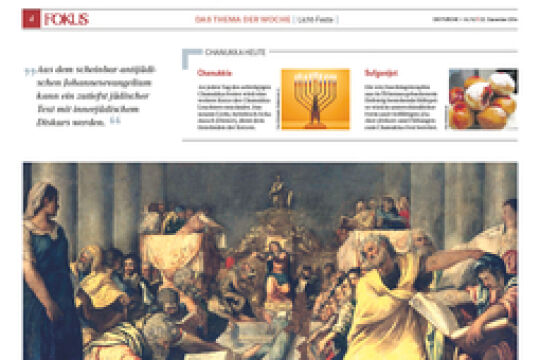Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
uber the Kaiser gut informiert
Vollkommen verzeichnet hat der amerikanische Verfasser die Porträts der Kaiserin Elisabeth und Katharina Schratts und dann natürlich wohl auch die Tragödie von Mayerling (Seite 89 ff.). Ihrem Berichterstatter ist es aufgefallen, daß der Verfasser als (Sekundär-) Quellen nur englische Übersetzungen bekannter Werke benützt, viele der wichtigsten aber anscheinend nicht zu Gesicht bekommen hat. A. J. P. Taylors „The Habsburg Monarchy“ bekommt die Note „unschätzbar“ (invaluable), (Seite 404), aber Robert Kanns Hauptwerk, „The Multinational Empire“, wird nirgendwo erwähnt; den so überaus aufschlußreichen Briefwechsel Franz Josephs mit Frau Schratt, herausgegeben, meisterlich eingeleitet und kommentiert von Jean de Bourgoing (erste Auflage bei Ullstein, eine neue Auflage vom Herold-Verlag vorbereitet) hat der Verfasser offenbar nie zu Gesicht bekommen.
Als Gegenspieler Franz Josephs und des Hauses Habsburg sieht der amerikanische Verfasser — mit Recht — weniger den unglücklichen Zaren Nikolaus II., der ja in dem hier behandelten Werk die einzige den drei anderen Dynastien „feindliche“ repräsentiert, sondern Wilhelm II., den letzten deutschen Kaiser, und das Emporkömmlingshaus der Hohenzollern. Es wird wenig Neues berichtet, was allerdings auch damit zusammenhängt, daß der durchschnittliche amerikanische Leser — und vielleicht der überdurchschnittliche angloameri-kanisthe Intellektuelle und Historiker — über „the Kaiser“ besser unterrichtet sein dürfte als über das Haus Österreich und seine vielen Völkerschaften. Ähnlich wie mit der Donaumonarchie unterläuft auch bei der Schilderung deutscher Verhältnisse dem Autor der Fehler, Deutschland zu sehr als eine Autokratie hinzustellen, in der sich die nicht-junkerlichen Klassen dem Kaiser-König und „seinen uckermär-kischen Granden“, um Heine zu zitieren, bedingungslos zu fügen hatten.
Eines aber muß gesagt werden: Taylor weiß sich bei der Darstellung Kaiser Wilhelms II. als Persönlichkeit und Regenten von jeder Verzerrung freizuhalten und zeigt seine, des Kaisers, Aktionen in den Tagen von Sarajewo bis zum Kriegsausbruch auf eine Art und Weise, die auch vor einem Feindgericht zum Freispruch des Kaisers geführt hätte, hätten ihn die Holländer tatsächlich nach Unterzeichnung des Versailler Vertrages ausgeliefert. Der Kaiser fand die serbische Antwort auf das österreichische Ultimatum durchaus befriedigend, und es war die Wilhelmstraße — Reichskanzler und Auswärtiges Amt —, die die „Kriegsgrafen“ am Ballhausplatz zu immer radikaleren Schritten drängte und dann absichtlich oder unabsichtlich — dies ist bis heute nicht ganz klar — die Lokalisierung des Konfliktes verhinderte. Weder der deutsche Kaiser noch der österreichische noch der russische Kaiser wollten den Krieg. Taylor selbst weist besonders auf den Umstand hin (Seite 220), daß Österreich nach Überreichung der Kriegserklärung an Serbien nicht sofort mobilisierte und für weitere zwei Wochen keine militärischen Operationen plante: Berchtold schien an ein Wunder in letzter Stunde zu glauben. Gerade weil die großen Monarchien keine großen europäischen Kriege seit vielen Jahrzehnten geführt hatten, wußten sie — nach Taylor — eigentlich nicht, in welches Abenteuer, in welche Katastrophen sie sich und ihre Völker gestürzt hatten. Als dann die Mobilisierungen Ihren Anfang genommen hatten, war Fatum selbst „mobilisiert“, das heißt, in Bewegung gesetzt worden: und vor allem erforderte die Technik des Krieges, dessen Romantik zu Anfang die Volksmassen überall begrüßt hatten, auch die späterhin so pazifistischen Sozialdemokraten, die tatsächliche Abdankung der Zivilbehörden und Monarchen vor den militärischen Heeresleitungen. Nicht ungeschickt zeigt Taylor, wie Kaiser Wilhelm gerade durch seinen Aufenthalt im Großen Hauptquartier zu einem bedeutungslosen Symbol wurde (Seite 239), wobei dem Verfasser auf der gleichen Seite wieder Ungenauigkeiten passieren: Während des ersten Weltkrieges mögen die Karageorgievice volksnäher als die kaiserlichen Dynastien gewesen sein, aber — der spätere König — Alexander I. war damals noch Kronprinz-Regent und Ludendorff wurde niemals mit dem Marschallstabe ausgezeichnet.
Für die Tragödie der deutschen Monarchie hat Taylor ein gutes Auge, ein scharfes Ohr: einen Hauptfehler sieht er vor allem darin, daß die deutschen Fürsten — wenn auch vielleicht nur symbolisch gemeinte — Kommändostellen bekleideten, wie übrigens auch die Erzherzoge, so daß all diesen Hoheiten anfängliche Siege und spätere Niederlagen erst kreditiert, dann debitiert wurden; der Kaiser hatte nicht den Mut, die Verschlechterung der militärischen Situation dem Hinterland bekanntzugeben. Sehr gut zeigt Taylor, daß diese „Verschlechterung“ häufig ganz simpel in einer „NichtVerbesserung“, einem „Sichgleichbleiben“ der Westfront unter ungeheuren Opfern bestand; da der viel stärkere Feind im Westen angetreten war, bedeutete die Verlegung ganzer Armeen an die Ostfront eine Verschärfung der Gesamtlage, und die großen Erfolge bei Tannenberg konnten für die späteren Katastrophen im Westen mit einigem Recht verantwortlich gemacht werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!