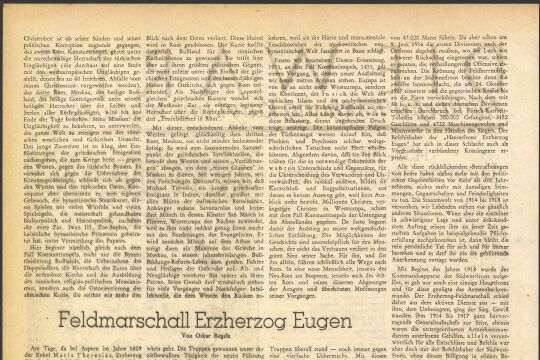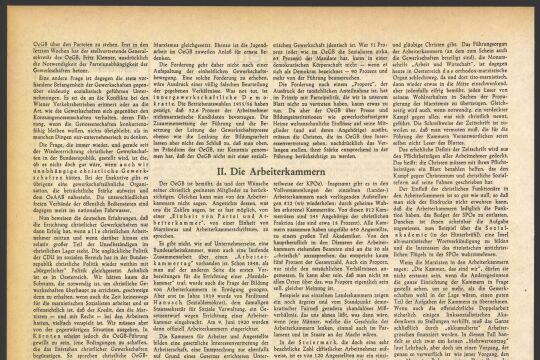In ihren Anfängen gehen die Standschützen bis auf das Jahr 1511, also bis auf Kaiser Maximilian I., zurück, und sie blieben auch noch nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Jahre 1868 als Einrichtung der Landesverteidigung von Tirol und Vorarlberg bestehen. Bis 1918 unterstanden sie dem 'Landesverteidigungskommandanten in Tirol uftd Vorarlberg, der seinen Sitz in Innsbruck hatte. Daß die Tiroler Freiwilligen aller Art durch die Jahrhunderte immer zu den besten Soldaten Oesterreichs gehörten, geht schon daraus hervor, daß sie mit Cazan zu Grießfeld und Teimer von Wiltau auch unter den Rittern des Maria-Theresien-Ordens vertreten sind. Ueber die Leistungen im Kriege 1914/1918 berichtet unter anderen R. Huchlers „Das Standschützenbataillon Dornbirn im Weltkriege“, und nun liegt Morls umgearbeitete Schilderung vor, deren Publizierung Klebelsbergs Schlern-Schriften zu verdanken ist, die bereits mit den Arbeiten von Gasteiger, Köll, Kramer, Oefner, Schemfil, Seelos und Tschurtschenthaler wertvolle Beiträge zur Militärgeschichte geliefert haben.
Als der Krieg _1914 ausbrach, da blieben vorerst bloß die Sp*rren in Tirol und Kärnten von aktiven Truppen besetzt, doch erhielt General Franz Rohr, der spätere Feldmarschall, bald den Befehl, mit den Ersatzkörpern, mit Landsturm- und Marschformationen sowie mit Gendarmerie- und Finanzabteilungen einen Grenzschutz aufzubauen, zu welchem alsbald auch die Standschützen hinzutraten. Als am 15. Mai 1915 der Krieg mit Italien bevorstand, standen 112 Bataillone, hiervon 39 Standschützen-und 15 Freiwiliigenbataillone, mit 9 Schwadronen und 49 Batterien an der Grenze, ungerechnet die permanenten Befestigungen mit ihren Besatzungen, und als dann der Krieg schon im Gange war, konnten Ende Mai an der Südwestfront 188 Bataillone, iO Standschützen- und 15 Freiwiliigenbataillone, 28 Schwadronen und 27 Pionier- und Sappeurkompanien, das waren 227.500 Mann mit 640 mobilen Geschützen, dem Feinde entgegengestellt werden. Innerhalb dieses Aufgebotes bildeten die Standschützen einen sehr beachtlichen Faktor, ohne den die erste Verteidigung nicht gelungen wäre. Auch im weiteren Verlaufe des Krieges standen sie stets auf entscheidenden Posten, und die Namen Monte Piano, Drei Zinnen, Col di Lana, Cimone oder Sieben Gemeinden sind mit jenem der Standschützen für immer rühmlichst verbunden. Hat man bisher nur wenige Einzelheiten über die Standschützen gewußt, so bietet nunmehr Morls Buch einen erschöpfenden Ueberblick. Mit Originalschilderungen von Mitkämpfern, mit weit mehr als tausend Namen von Gefallenen, Verwundeten und Ausgezeichneten, mit zahlreichen Lichtbildern und einem genauen Ortsregister stellt die mühevolle Arbeit dem Verfasser in vieler Hinsicht das beste Zeugnis aus, der dem Andenken unserer Standschützen einen großen Dienst erwiesen hat. Diese Anerkennung wollen wir aufrichtig zollen und sie bleibe abgetrennt von den nachfolgenden Einwänden, die vom Standpunkte der Geschichtsschreibung nicht unterlassen werden dürfen.
Zunächst wären einige eher unwesentliche Unrichtigkeiten anzuführen, wie sie bei jedem einen großen Stoff umfassenden Werke meist unvermeidlich sind: 32.000 Standschützen bildeten kein „kriegsstarkes Armeekorps“ (S. 16), da zu einem solchen alle höheren Stäbe, Divisions- und Brigadeverbände, alle Waffengattungen und auch der gesamte Nachschubapparat gehörten; die Bezeichnung „österreichische, ungarische und deutsche Truppen“ (S. 109) ist, streng genommen, unzutreffend; es gab nicht zehn (S 352), sondern zwölf Isonzo-schlachten; Prinz Elias von Parma war nicht „Artilleriekommandant“ (S. 354), sondern als Generalstabsoberst Abschnittskommandant; der Maria-Theresien-Orden konnte nach den Statuten niemals für eine Tat „gegen einen ausdrücklichen Befehl“ (S. 377) zuerkannt werden. Die Behauptung auf S. 127, die Erziehung der Offiziere wäre bei manchen Gegnern besser gewesen als in Oesterreich-Ungarn und Deutschland, steht im Widerspruche mit der Tatsache, daß sich die Offiziere der Mittelmächte mit ihren Truppen in Angriff und Abwehr gegen eine erdrückende Uebermacht durch 52 Monate erfolgreich behaupten konnten.
Was nun die Standschützen anbelangt, muß festgehalten werden, daß sie sich natürlich von den Heeresverbänden wesentlich unterschieden. Sie hatten zwar nicht, wie oft angenommen wird, gar keine militärische Ausbildung, denn als wohlgeschulte Schützen nahmen sie es im Schießen mit den aktiven Soldaten auf und überragten die Ersatzreserve. Was ihnen aber fehlte, war, sofern es sich um die noch nicht wehrpflichtigen Jahrgänge und um alte, ungediente Männer handelte, die exerziermäßige und disziplinare Erziehung, und das war die Ursache, weshalb es mit Angehörigen des Heeres bisweilen zu unliebsamen Auseinandersetzungen kam, die gewiß bedauerlich, doch erklärlich waren. Woher hätte z. B. ein siebenbürgischer Reserveoffizier wissen sollen, wie es sich am entgegengesetzten Ende der Monarchie mit den Standschützen militärisch verhielt? Gerade die österreichisch-ungarische Wehrmacht gab in ihrer so weitgehenden Buntheit aller Art reichlich Anlaß zu Mißverständnissen und Mißhelligkeiten, ie höheren Kommandos sind aber stets unverzüglich eingeschritten und haben auch den zu Unrecht verkannten Standschützen zu ihrem Rechte verholfen. Eine Reihe vorgekommener unerfreulicher Vorfälle zu verallgemeinern und heute nach 40 Jahren in einem Erinnerungsbuch zu unterstreichen, um Armee gegen Standschützen auszuspielen, das wäre besser unterblieben. Die Armeeoffiziere haben es in diesem Buche überhaupt nicht leicht: sie sahen die Standschützenoffiziere über die Achsel an (S. 30), sie waren ärger als der Feind (S. 32), im Stellungsbau nur „Theoretiker“ (S. 32), behandelten die Standschützen oft schlecht (S. 37), sekkierten sie oft bis aufs Blut (S. 110). Auch einzelne Truppenkörper bekommen eine schlechte Note, wie die 30,5-cm-Mörser (S. 76) oder das Rainer- Regiment samt seinem Obersten (S. 376). Von den Armeeoffizieren wird ferner gesagt, sie wären weit hinten gewesen (S. 354), und während man in München „nahezu keine Offiziere auf den Straßen“ sah, gab es in Innsbruck deren sehr viele, das soll also heißen, daß sich die österreichischen Offiziere von der Front fernhielten. Hierzu muß zur Unterrichtung des Lesers erklärt werden, daß sich Innsbruck kaum hundert Kilometer von den Kampffronten befand und im Gebirgsland Tirol den wichtigsten Durchzugspunkt von und zu der Front darstellte, daß jedoch München von der Westfront 300 und von der Ostfront 600 Kilometer entfernt war. Was hätten also dort Offiziere zu suchen gehabt? Es muß aber noch etwas anderes in Erinnerung gerufen werden, daß nämlich der österreichische Berufsoffizier unter allen Berufsständen den höchsten Blutzoll aufzuweisen hat: 119,8 Tote auf 1000 — der nächste Berufsstand (Fleischer und Selcher) erreichten 61,3 auf 1000 —. und daß von den Berufsoffizieren je Hundert doppelt so viele als nichtaktive Offiziere gefallen sind. Die Berufsoffiziere haben diese Ziffern niemals hervorgekehrt, weil-sie ihr Blutopfer als etwas ganz Selbstverständliches betrachten. An dieser Stelle sei aber darauf hingewiesen, um die Fehlmeinung von der angeblich so schlechten Haltung der Berufsoffiziere richtigzustellen. Die Standschützen können ihrerseits ebenso stolz auf ihre Verluste sein, steht doch Tirol-Vorarlberg unter den Kronländern der Monarchie mit 30,4 Toten je 1000 der Bevölkerung an vierter Stelle hinter Kärnten (36), Salzburg und Steiermark (je 31,1).
Noch schlechter als die Offiziere überhaupt kommt die höhere Führung weg. Im Stellungsbau war das Landesverteidigungskommando ungeschickt (S. 46), machte die Stellungen für den Feind auffallend (S. 24), sorgte weder für Wege noch für Artillerie und Maschinenjewehre (S. 28), „von Schützengräben keine Spur“ (S. 33), bei der Anlage von Stützpunkten „waren die Erfahrungen des modernen Krieges nicht verwertet“ (S. 216), wichtige Stellungen blieben unbesetzt (S. 103). Die höheren Kommanden taten nichts für den Geist der Truppe (S. 34), und ganz schlecht war der Generalstab, der „in keinem besonders guten Ruf“ stand (S. 352), mit den Truppen schlecht disponierte (S. 42) und sie schlecht behandelte (S. 360), unhöflich war (S. 364) und sogar am Tode Inner-k o f 1 e r s die Schuld getragen haben soll (S. 41 im Widerspruch mit S. 44). Das Armeeoberkommando („Alles ohne Kopf“, S. 374) hat beim Waffenstillstand „vollständig versagt“, die Armeekommandos „machten sich aus dem Staube“ und gingen durch (S. 374, 377). Alle diese Feststellungen zeigen, wie schwer es ist, Geschichte zu schreiben, ohne die richtigen Quellen zu benützen und die maßgebende Literatur heranzuziehen. Alles Wissenswerte über den Waffenstillstand des Jahres 1918 liegt im Wiener Kriegsarchiv für jeden bereit und grundlegende Forschungen wurden bereits veröffentlicht. So hat insbesondere Emil Ratzenhofer nachgewiesen, daß beim Waffenstillstand vom Generaloberst bis hinab zum Leutnant ebenso viele Offiziere aller Dienstgrade in Gefangenschaft gerieten, als notwendig gewesen wären, um mit der Zahl der gefangenen Soldaten volle Heereskörper zu formieren: es sind daher ebenso viele Offiziere auf ihrem Posten geblieben als verhältnismäßig Mannschaftspersonen. Nicht unerwähnt darf weiter bleiben, daß selbst Feldmarschall Conrad im Standschützenbuch eine höchst ungünstige Beurteilung erfährt: er hätte kein Vertrauen in eine Behauptung Südtirols gehabt (S. 7 u. 12), er hätte die Tiroler Befestigungen nicht richtig angelegt (S. 215), auch ei di Offensive 1916 verfehlt gewesen (S. 251). Es muß
sich gewiß jeder Feldherr der Kritik stellen, . doch muß diese fachlich fundiert sein. Es ist zwar häufig so, daß einem Feldherrn die Fachkritiker lange nicht so heftig an den Leib rücken als — ein Vorrecht der Jugend — die Leutnants und Kadetten. Trotzdem ist es nicht am Platz (S. 352), einen Reserveoberleutnant über die „Conrad-Offensive 1918“ als von einer „allgemeinen Trottulosis“ sprechen zu lassen, um so weniger, als diese Offensive von Conrads Nachfolger verantwortlich geleitet wurde. Vor allem war aber Conrad jener General, dessen langjähriger Vorbereitung der Tiroler Landesverteidigung es zu verdanken war, daß Tirol nicht schon im ersten Ansturm vom Feinde hat überrannt werden können.
Auf Seite 10 ist noch zu lesen, daß beim Soldaten „guter Hausverstand“ fachliche Schulung ersetze und daß auch die Schweiz „Hauptleute und Majore hat, die im Zivil Wirte, Bäcker, Bauern oder Kaufleute sind“. Beide Behauptungen halten einer Ueberprüfung nicht stand: die erste zu verbreiten ist für unsere wehrpflichtige Jugend verderblich, wo gerade in Oesterreich die Erinnerung an die überflüssigen Blutopfer der schlecht ausgebildeten Ersatzreserve fortlebt und der moderne Krieg vom einfachsten Soldaten zahlreiche Kenntnisse fordert, die zweite ist insofern nicht richtig, als in der Schweiz bereits das Leutnantsdekret nur nach langwieriger, sehr gründlicher und anstrengender praktischer und theoretischer Schulung erworben werden kann und bis zum Oberstdivisionär immer wieder neue Verwendungsnachweise erbracht werden müssen.
Von Anton von Morl stammt im „Tiroler Bauernkalender 1957“ der Aufsatz „Der Hofkriegsrat. Ergebnisse der militärgeschichtlichen Forschung“. Dieser Aufsatz übte ohne Erbringung wissenschaftlicher Beweise abträgliche Kritik an Conrad und dem k. u. k. Generalstab und setzte auch R a-d e t z k y herab. Mehrere Generale und Generalstabsoffiziere haben sich damals zur Wahrung der Ehre der altösterreichischen Wehrmacht zum Worte gemeldet. Nun hätte das Standschützenbuch eine willkommene Gelegenheit geboten, unterlaufene Irrtümer zu widerrufen — und wen würde das nicht ehren? Es ist leider nicht geschehen. Der Rezensent, der 1916 mit Standschützen an der Front stand und an gemeinsame Tage die erhebendsten Erinnerungen bewahrt, bedauert dies ganz besonders. Er ist aber überzeugt, daß die noch lebenden k. u. k. Standschützen in ihrer erdrückenden Mehrheit jeden Versuch ablehnen, der es unternimmt, ihren so hell und reich durch die Geschichte strahlenden Ruhm auf Kosten der alten Armee mehren zu wollen. Das haben die Standschützen nicht notwendig, und sie haben als Bestandteil dieser selben Armee sicher kein Interesse daran, an der alten bewährten Kameradschaft zu rütteln.